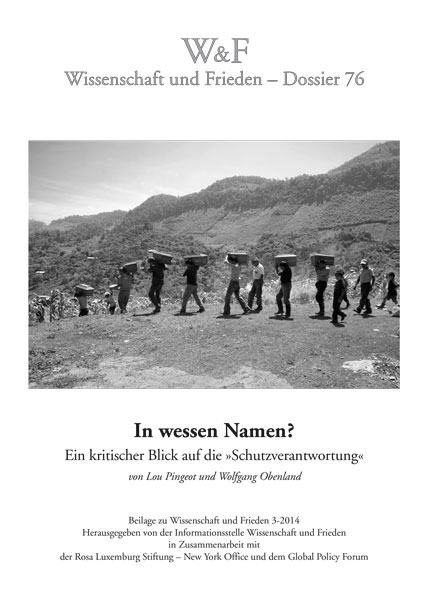In wessen Namen?
Ein kritischer Blick auf die »Schutzverantwortung«
von Lou Pingeot und Wolfgang Obenland
Alleine während der vergangenen zwölf Monate kam es zu vielfachem Eingreifen auswärtiger Mächte in Konflikte in formal souveränen Ländern: im Südsudan, in Zentralafrika, in Mali, in der Ukraine und anderswo. Diese sehr unterschiedlichen Eingriffe in sehr unterschiedliche Konfliktsituationen werden naturgemäß sehr unterschiedlich bewertet: als Unterstützung in einer Krisensituation, als Prävention in einem sich abzeichnenden Völkermord oder als aggressive Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Wann und wie aber internationales Eingreifen gerechtfertigt oder gar geboten erscheint, darüber findet spätestens seit dem Ende der 1990er Jahre eine kontroverse Diskussion unter dem Schlagwort »Schutzverantwortung« statt.
In den 1990er Jahren war die Welt mit einer Reihe bewaffneter und sehr gewalttätiger Konflikte konfrontiert, die sich nicht in das herkömmliche Schema zwischenstaatlicher Kriege einordnen ließen. Aus den unterschiedlichsten Gründen und in sehr verschiedenen geographischen Zusammenhängen eskalierten Konflikte innerhalb von Staaten und riefen Reaktionen der »internationalen Gemeinschaft« hervor – aber in sehr unterschiedlichem Ausmaß.
Die bewaffneten Auseinandersetzungen in Somalia, Ruanda, Bosnien oder dem Kosovo führten zu hitzigen Debatten darüber, wie die internationale Gemeinschaft auf interne Konflikte in formal souveränen Staaten reagieren sollte. In den genannten Beispielen hatte sie mit Mandaten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (United Nations, UN) mit wechselnden Resultaten interveniert, ohne ein solches Mandat eingegriffen oder gar nicht reagiert. Angesichts dieser gemischten Bilanz begann eine Reihe von Wissenschaftler_innen und Politiker_innen, sich für eine neue Doktrin internationaler Verantwortung einzusetzen, die Interventionen in souveräne Staaten durch die UN oder andere Staatengruppen rechtfertigen und kodifizieren sollte. In einer Rede argumentierte UN-Generalsekretär Kofi Annan 1998, das Prinzip der Souveränität könne übergangen werden, wo es der Pflicht des Sicherheitsrats entgegenstünde, Frieden und Sicherheit zu bewahren. Die Charta der UN sei nie dafür gedacht gewesen, Menschenrechte und menschliche Würde mit Füßen zu treten. Das Souveränitätsprinzip beinhalte Verantwortung, nicht nur Macht.1
Viele Regierungen aus dem globalen Süden standen dieser Idee misstrauisch gegenüber; sie drückten Bedenken aus, solche Begründungen könnten dazu führen, dass interne Auseinandersetzungen zur Rechtfertigung für interessengeleitete Eingriffe anderer Mächte dienen. Sie erinnerten daran, wie westliche Staaten unter dem Vorwand humanitärer Interventionen in der Vergangenheit ihre Kolonialreiche ausgebaut hatten.
Kofi Annan war sich dieser Bedenken bewusst und drängte die Regierungen zu einem Konsens darüber, wann und wie Interventionen autorisiert werden sollten. Als Antwort auf dieses Drängen richtete die Regierung Kanadas mit Unterstützung einiger finanzkräftiger US-Stiftungen im Jahr 2000 die »Internationale Kommission zu Intervention und staatlicher Souveränität« (International Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS) ein.
Die Kommission war prominent besetzt mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Militär und Zivilgesellschaft: Vorsitzende waren Gareth Evans, ehemaliger Außenminister Australiens, und Mohamed Sahnoun, Sonderberater des UN-Generalsekretärs und ehemaliger Sonderbeauftragter für Somalia und die Region der Großen Seen in Afrika. Das umstrittene Konzept »humanitärer Intervention« umgehend, führte die ICISS das Konzept der »Schutzverantwortung« (Responsibility to Protect, R2P) ein. Es beinhaltet im Wesentlichen drei Elemente:
1. einen Wandel im Verständnis von Souveränität als Recht von Staaten auf territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit hin zu einer Verpflichtung, die eigene Bevölkerung vor schwersten Menschenrechtsverletzungen zu schützen;
2. die Verantwortung der Staatengemeinschaft, dort zu intervenieren, wo Regierungen nicht willens oder in der Lage sind, diesen Schutz bereitzustellen; damit wird das Unterlassen, nicht die Durchführung von Interventionen begründungspflichtig;
3. die Betonung der multilateralen Natur dieser Pflicht: nicht einzelne Staaten, sondern nur Bündnisse sollten diese Verantwortung wahrnehmen können.
Diese Aspekte wurden im Bericht der ICISS in drei Konzepte heruntergebrochen: die Verantwortung zur Vorsorge (Responsibility to Prevent), die Verantwortung zur Reaktion (Responsibility to React) sowie die Verantwortung zum Wiederaufbau (Responsibility to Rebuild). Diese Konzepte wurden als Antwort auf die Frage formuliert, „wann, falls überhaupt es für Staaten angemessen ist, gegenüber einem anderen Staat Zwangsmittel – und zwar militärische – einzusetzen, um gefährdete Menschen in diesem anderen Staat zu schützen“.2
Obwohl die ICISS also betonte, dass die Schutzverantwortung auch eine Verantwortung zur Prävention und zum Wiederaufbau beinhaltet, liegt der sehr deutliche Fokus auf der »Reaktionskomponente« – oder genauer, auf deren militärischer Ausgestaltung. Es werden insgesamt sechs Kriterien vorgeschlagen, die erfüllt sein sollen, um militärische Interventionen legitim durchführen zu können:
- die richtige Autorisierung,
- ein gerechtfertigter Grund,
- die rechte Absicht,
- militärische Intervention als Ultima Ratio,
- die Proportionalität des Vorgehens und
- vernünftige Erfolgsaussichten.
Obwohl die ICISS den UN-Sicherheitsrat als höchste Legitimität spendende Autorität für solche Interventionen ansieht, schließt sie die Möglichkeit einer Autorisierung durch regionale Organisationen oder willige Mächte ausdrücklich nicht aus. Als Fälle, in denen die Verantwortung der Staatengemeinschaft greifen soll, werden solche bezeichnet, die »das Gewissen erschüttern«. Im Einzelnen werden darunter schwerste Verbrechen, wie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gefasst, aber auch Fälle, in denen Regierungen bei Naturkatastrophen nicht willens oder in der Lage sind, zu helfen.
Bei der Bewertung der Vorschläge der ICISS ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die ihrer Arbeit zu Grunde liegende Frage nicht war, wie humanitäre Katastrophen zu vermeiden oder wie Konflikte zu lösen seien. Vielmehr stellte sich die Kommission explizit die Frage: „Welche Bedingungen müssen gegeben sein, um militärische Interventionen im Fall grober Menschenrechtsverletzungen zu legitimieren?“ Wie wir zeigen werden, hat diese Fragestellung die Diskussionen über die »Schutzverantwortung« für Jahre bestimmt.
Nach der Veröffentlichung des ICISS-Berichts 2001 und umfangreichen Bemühungen seiner Unterstützer_innen nahm R2P schnell seinen Weg durch die Instanzen der UN. Das Abschlussdokument des Weltgipfels von 2005 beinhaltet in drei knappen Paragraphen das Konzept, allerdings in stark eingeschränkter und modifizierter Form. So wurde die Verpflichtung zur Intervention hier nur noch zur »Bereitschaft«, die uneingeschränkte Autorität des Sicherheitsrats wurde nicht angetastet und Fälle, in denen Interventionen gerechtfertigt werden, wurden auf die völkerrechtlich klarer gefassten Fälle von Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begrenzt.3
Seither nimmt R2P einen wichtigen Platz in den Diskussionen bei den UN und darüber hinaus ein, u.a. durch regelmäßige Berichte des Generalsekretärs und in Resolutionen des Sicherheitsrats. Diverse Akteure beriefen sich auf R2P während der Darfur-Krise, im Zusammenhang mit den Konflikten in der Demokratischen Republik Kongo, in Mali, Libyen und Syrien. Die Anwendung des Konzepts auf diese sehr realen Krisen deckte die Kernfragen zu R2P sehr schnell auf: Bietet es wirklich neue und effektive Antworten auf massenhaftes Töten? Kann es missbraucht werden, um die Interessen der Intervenierenden durchzusetzen anstatt Menschenrechte zu schützen? Im Zuge des NATO-Bombardements in Libyen, das unter expliziter Berufung auf R2P durchgeführt wurde, argumentierten Beobachter_innen, die Intervention habe gegen Sicherheitsratsresolutionen verstoßen, weil sie anstelle des eigentlichen Ziels, dem Schutz der Zivilbevölkerung, den Sturz Gaddafis und die Einsetzung einer neuen Regierung bezweckte.4 Der Schluss lag nahe, dass die Kampagne in Libyen dem Konzept der Schutzverantwortung einen schweren Schlag versetzt habe und dass es in Zukunft schwieriger sein würde, sich auf R2P zu beziehen oder Konsens über militärische Interventionen herzustellen.
Wir möchten hier der Frage nachgehen, ob das Konzept einer Schutzverantwortung vor Missbrauch geschützt werden kann oder ob es grundsätzlichere Schwächen beinhaltet. Dazu werden wir Argumente für und gegen R2P beleuchten und untersuchen, wer hinter diesen Argumenten steht. Diese Analyse, so hoffen wir, kann dazu beitragen, sich ein umfassendes Urteil über dieses Konzept und seine rasante Karriere zu verschaffen.
Die positiven Seiten von R2P
Das Konzept der Schutzverantwortung soll der Beantwortung einer keinesfalls trivialen Frage dienen: Kann die Staatengemeinschaft sich allgemeingültige Regeln geben für Fälle, in denen das Leben vieler unmittelbar in Gefahr ist, die eigentlich zuständige Regierung aber entweder nicht in der Lage oder willens ist, diese Situation zu beheben? R2P bietet eine Reihe mehr oder weniger innovativer Antworten und erinnert an bestehende Pflichten auf internationaler und nationaler Ebene. Allerdings bleibt das eigentliche Novum des Konzepts die Einführung militärischer Intervention als legitimes Mittel, auch wenn ihm bestimmte konzeptionelle Hürden in den Weg gestellt werden.
So widersetzt sich R2P richtigerweise dem in sich widersprüchlichen Begriffspaar »humanitäre Intervention« und gibt damit denjenigen recht, die die Gefahr begründet sehen, dass humanitäre Aktivitäten militarisiert werden. Obwohl sich R2P nicht völlig von dem Konzept der humanitären Intervention freimachen kann, stellt es doch seine politischen Implikationen in Frage. Die ICISS bemerkt dazu in ihrem Bericht, schon die Verwendung des positiv konnotierten Begriffs »humanitär« verschleiere die eigentlich Frage, ob bzw. wann eine Intervention gerechtfertigt sei.
Indem das Konzept der Schutzverantwortung argumentiert, Souveränität sei eine Verpflichtung, werden wichtige Prinzipien des Menschenrechtssystems aufgegriffen, und es wird betont, dass Staaten Verpflichtungen gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern haben. Mit R2P wird außerdem hervorgehoben, dass der internationalen Gemeinschaft eine Rolle dabei zukommt, einzelne Staaten bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu unterstützen, insbesondere durch ökonomische, soziale und politische Maßnahmen. Das Abschlussdokument des Weltgipfels von 2005 sagt entsprechend, die Staatengemeinschaft habe die Pflicht, „den Staaten beim Aufbau von Kapazitäten zum Schutz ihrer Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit behilflich zu sein und besonders belasteten Staaten beizustehen, bevor Krisen und Konflikte ausbrechen“ (§139).
Im Bewusstsein der Wankelmütigkeit der internationalen Reaktionen auf die humanitären und politischen Krisen der 1990er Jahre wird im Rahmen des Konzepts R2P versucht, mehr Konsistenz herzustellen. Es soll ein Rahmen geschaffen werden, der klarstellt, wer wann wie unter welchen Umständen intervenieren soll. Indem die Umstände definiert werden, unter denen die internationale Gemeinschaft im Falle humanitärer Notlagen Verantwortung übernehmen soll, zielte die ICISS darauf ab, es den Mitgliedern der UN schwerer zu machen, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Die Fallstricke von R2P
Diesen Zielen und Ansätzen wird das Konzept der Schutzverantwortung allerdings nicht gerecht. Das Konzept, das sich für viele mittlerweile – je nach Standpunkt – zu einer Norm bzw. einer Doktrin gewandelt hat, hilft nicht dabei, Konflikte zu verstehen oder zu lösen, sondern kann sogar kontraproduktiv wirken. Es legt den Fokus auf die falschen Instrumente – und es öffnet politischer Manipulation Tür und Tor.
R2P hat Abgrenzungsprobleme
Über die genaue Ausrichtung von R2P, über die Rolle militärischer Intervention, darüber, in welchen konkreten Fällen R2P bislang überhaupt angewandt worden sei, gibt es sehr viel Disput, auch unter Verfechter_innen des Konzepts. Viele behaupten von sich, die eigentliche Bedeutung der Doktrin zu verteidigen und sie gegen »Feinde« und »falsche Freunde« zu schützen. Gareth Evans zum Beispiel, einer der Autor_innen des ICISS-Reports, versucht diejenigen zu korrigieren, „die von sich behaupten, Freunde von R2P zu sein“, aber „den ideologischen Kritikern in die Hände spielen […] indem sie an R2P nur in militärischen Zusammenhängen denken“.5
Meinungsverschiedenheiten zwischen Unterstützern von R2P sowie die inhaltliche Nähe zum Konzept humanitärer Intervention unterstreichen die Unklarheiten des Konzepts. Während einige R2P und »humanitäre Intervention« synonym gebrauchen und ersteres nur für eine neue Art halten, über letzteres zu sprechen, behaupten andere, beides habe nichts miteinander zu tun.
Die zwiespältige Rolle des ICISS-Reports im breiteren Diskurs um R2P trägt zu dieser Konfusion bei. Im Gegensatz zum Abschlussdokument des Weltgipfels von 2005 wurde der ICISS-Report nie von Regierungen ratifiziert oder auch nur begrüßt, und er ist auch nicht Teil des offiziellen Verständnisses der UN von R2P. Die Konzepte und Definitionen der ICISS durchdringen aber die Diskurse rund um R2P. Selbst anerkannte Wissenschaftler_innen verwischen die klaren Unterschiede zwischen dem Verständnis der ICISS und den UN. Genau so geht es vielen Unterstützer_innen aus der Zivilgesellschaft: „Es ist schwer zu sagen, ob die Zunahme [der zivilgesellschaftlichen Unterstützung für R2P] einen menschenrechtlichen Konsens über militärische Interventionen als letztes Mittel im Namen des Schutzes der »Menschenrechte« widerspiegelt oder lediglich Unterstützung für die unumstrittene Idee, dass Staaten, ob allein oder gemeinsam mit anderen, immer darum bemüht sein sollten, Zivilisten zu schützen.“ 6
Diese fehlende Klarheit macht es den R2P-Verfechter_innen einfach, Kritik an der Doktrin mit dem Verweis auf Missverständnisse zurückzuweisen. In Fällen, in denen (vielfach unpopuläre) militärische Interventionen mit R2P gerechtfertigt wurden, wird das von den R2P-Befürworter_innen als Fehlinterpretation oder Missbrauch bezeichnet. In Fällen, in denen Vermittlungsbemühungen erfolgreich waren, wie zum Beispiel Kofi Annans diplomatischer Einsatz in Kenia 2008, wird das als ein Beispiel von R2P verkauft, obgleich Annans Initiative ohne R2P ebenso denkbar war und keinerlei Einschränkung der kenianischen Souveränität beinhaltete. Dieses elastische Verständnis von R2P erlaubt die Assoziierung von R2P mit Erfolgen und die Abgrenzung zu Misserfolgen gerade so, wie es für die Verfechter_innen am bequemsten ist.
R2P rechtfertigt den Einsatz von Gewalt
Die Konfusion rund um R2P lässt sich am besten anhand der Auseinandersetzung um die Rolle militärischer Intervention in der Doktrin illustrieren. Einige Verfechter_innen von R2P argumentieren, militärische Gewalt sei lediglich eine von mehreren Komponenten und habe nie im Mittelpunkt gestanden, andere sehen sie sehr wohl als den Kern von R2P.7
Ein genauerer Blick auf die Entstehungsgeschichte von R2P unterstützt die Meinung letzterer. Der Aufbau des ICISS-Reports zeigt eine eindeutige Unausgewogenheit zwischen militärischen Optionen und anderen Instrumenten. Unter der Überschrift »Verantwortung zur Reaktion« gehen gerade einmal zwei Seiten Text auf nicht-militärische Möglichkeiten ein, während sich ganze sieben Seiten deutlich differenzierter mit militärischen Szenarien befassen.
Anstatt sich auch damit zu befassen, welche Effekte durch militärische Abenteuer verursacht werden können, vertreten R2P-Befürworter_innen die Ansicht, die eigentliche Gefahr gehe von zu wenigen militärischen Interventionen aus.8 Dieser nicht problemorientierte Umgang mit militärischen Mitteln übergeht das Eskalationspotential, das mit vielen Interventionen verbunden ist, sowie die Wahrscheinlichkeit ziviler Opfer, Schäden an Infrastruktur und viele weitere negative Auswirkungen militärischen Eingreifens. Dieser blinde Fleck im R2P-Diskurs ist hoch problematisch, bedenkt man den mehr als zweifelhaften Erfolg bisheriger »humanitärer Interventionen«. So bezeugt ein Grundlagenpapier für die ICISS die zivilen Opfer der Interventionen in Somalia und im Kosovo sowie die dadurch ausgelösten Flüchtlingsbewegungen und das Missverhältnis von militärischen zu wirklich humanitären Bemühungen.9
Die zentrale Rolle militärischer Intervention wird noch offensichtlicher, berücksichtigt man, dass fast alle nicht-militärischen Elemente der Doktrin bereits in Form anderer Instrumente existieren. Es gibt bedeutende Überschneidungen zwischen den unter R2P diskutierten Präventionsinstrumenten und den eher traditionellen Mechanismen der Friedenssicherung. Selbst R2P-Unterstützer_innen geben zu, dass der Abschnitt zu Prävention des ICISS-Berichts „kurz, konfus und wenig originell“ sei.10 R2P bietet also wenig Neues im Vergleich zu bestehenden Instrumenten – außer eben der Schaffung vermeintlicher Legitimation für bewaffnete Interventionen.
Aber selbst wenn militärische Interventionen nicht im Zentrum von R2P stehen sollten, bedeutet die Bereitstellung dieses Instruments als eines unter vielen eine relevante Gewichtung. Militärische Intervention neben anderen Möglichkeiten der Konfliktprävention und der Unterstützung friedenschaffender Maßnahmen einzubeziehen, verschiebt den Fokus der Doktrin hin zu der Option gewaltsamer Interventionen. In einem System, in dem die Anwendung militärischen Zwangs die einzige funktionelle Kapazität darstellt, wird sie zur einzigen Option: „Der militärische Aspekt bleibt das brauchbarste Element der Doktrin, weil es das einzige ist, das sowohl kohärent als auch praktikabel ist.“ 11
R2P setzt Klarheit voraus, wo es die nicht geben kann
R2P basiert auf einer Reihe von Kernannahmen, die nähere Betrachtung erfordern, obwohl sie selbstverständlich klingen. R2P beruft sich beispielsweise auf ein Konzept der »internationalen Gemeinschaft«, das nicht wirklich gut zu umreißen ist und Fragen zum Verständnis von und Umgang mit der Wirklichkeit aufwirft. Teilweise wirkt das Verständnis globaler Politik und der Mechanismen hinter Konflikten im R2P-Diskurs naiv oder sogar weltfremd.
Die Doktrin insinuiert beispielsweise, dass in Fällen eines »massenhaften Verlusts von Menschenleben« (large scale loss of life) oder »das Gewissen erschütternden Situationen« (conscience-shocking situations) Fakten klar auf dem Tisch liegen und Täter klar zu identifizieren seien. Nur dann könnte militärische Gewalt eingesetzt werden, um Opfer zu schützen und Täter aufzuhalten. Gerade in umkämpften und oftmals chaotischen Situationen ist es aber sehr schwierig festzustellen, wer eigentlich was tut und in welchem Ausmaß für welche Taten verantwortlich gemacht werden kann. Diese Komplexität zeigt sich beispielsweise im syrischen Bürgerkrieg. Der Einsatz chemischer Kampfstoffe stand zwar fest, wer diese eingesetzt hat, ist in der »internationalen Gemeinschaft« aber bis heute umstritten.12
Angesichts solcher Streitfälle, die in praktisch jeder Krisensituation vorkommen dürften, stellt sich die Frage, wer die »internationale Gemeinschaft« eigentlich ist. Im R2P-Diskurs wird der Begriff schnell zum Synonym für die »guten Mitglieder der internationalen Gemeinschaft« oder noch enger für die westliche Welt, vor allem die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich.
R2P öffnet die Tore für subjektive Interpretationen und selektive Anwendungen
Die Diskussionen rund um R2P sind hochgradig moralisch aufgeladen, wodurch die Diskussion objektiverer Konzepte, wie Legalität, zu Fragen von »richtig« und »falsch« verschoben wird.13 Illustriert wird dieser Wandel durch die Verschiebung im R2P-Diskurs von ansatzweise definierten und umrissenen Tatbeständen, wie Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu »massenhaften Gräueltaten« (mass atrocities). Dieser Begriff ist aber weder rechtlich etabliert noch klar definiert. Der Moralismus spiegelt sich auch in dem immer wieder verwendeten Begriff der »das Gewissen erschütternden Situationen« (conscience-shocking situations), der im Bericht der ICISS und von R2P-Vertreter_innen immer wieder gebraucht wird.
Diese Moralisierung der Debatte über die Begrifflichkeiten schafft ein Umfeld, in dem die Infragestellung einer militärischen Intervention schnell dazu führen kann, R2P-Kritiker_innen in eine Ecke mit Massenmördern zu rücken. R2P-Vertreter_innen nehmen für sich allzu oft moralische Überlegenheit in Anspruch und nutzen diesen Anspruch dazu, Kritiker_innen als gewissenlos und in überkommenen Denkmustern verhaftet zu brandmarken, denen ein legalistisches Verständnis von Souveränität wichtiger sei, als das Wohlergehen von Menschen. Dass oft von den »Feinden« von R2P die Rede ist, ist unter diesem Gesichtspunkt nicht unbedeutend.
Die begriffliche Verschiebung von mehr oder weniger klar definierten Konzepten zu moralisch aufgeladenen erlaubt auch das Ausweichen auf Argumentationen jenseits des Völkerrechts. So wird von vielen R2P-Verfechter_innen unterschieden zwischen legal und legitim mit Argumenten wie „was gesetzlich verboten ist, mag doch das Gewissen verlangen“ und „was legal ist, ist noch lange nicht legitim“.14 Ohne solide Kriterien aber wird Legitimität zu einer Frage subjektiver Bewertung.
Die Theorie vom »gerechten Krieg«, die im ICISS-Bericht in Form der sechs Kriterien für den legitimen Einsatz militärischer Gewalt aufgegriffen wird (s.o.), setzt diese Moralisierung fort. Die sechs genannten Kriterien scheinen unabhängig vom internationalen Recht zu existieren und sind nur schwer objektiv zu belegen. Wie soll zum Beispiel sichergestellt sein, dass die Absichten, die hinter einer Intervention stehen, die »rechten« sind, dass damit menschliches Leid beendet oder abgewendet werden könne? Zwar wird im ICISS-Bericht eingestanden, dass es naiv sei, zu glauben, dass „das humanitäre Motiv das einzige ist, das intervenierende Staaten antreibt“.15 Dass diese Einschränkung das Kriterium der »rechten Absicht« aber Makulatur werden lässt, wird nicht erkannt. Auch die anderen Kriterien lassen sich auf diese Art hinterfragen.
R2P ist kontraproduktiv
Die Betonung moralischer Wertungen verschleiert ein klares Verständnis von Konflikten und Gewalt. Während ständig Bezug genommen wird auf den Holocaust oder den Völkermord in Ruanda, um den eigenen Behauptungen Gewicht zu verleihen, hilft der Bezug auf diese sicherlich wichtigen historischen Beispiele nicht zwingend dabei, gegenwärtige und sehr spezifische Fälle von Gewaltausbrüchen zu verstehen oder zu verhindern. Die Betonung dieser sehr extremen Fälle verstellt ein Verständnis von Gewalt, indem es „die volle Komplexität von Konflikten und inter-ethnischen Beziehungen einhegt in ein eindimensionales Modell, das unausweichlich auf Völkermord schließt und die verschiedenen instrumentellen politischen Logiken der Gewalt allein auf böse Motive reduziert“.16
Obwohl im R2P-Diskurs die Täter von Menschenrechtsverletzungen und Tötungen als unersättlich und irrational gebrandmarkt werden, trifft das nicht unbedingt auf alle Fälle zu. Individuen dürften tatsächlich oft von politischen oder anderen Motiven angetrieben sein. Wird die Anwendung von Gewalt als Instrument zur Durchsetzung eigener Interessen wahrgenommen, schafft das den nötigen Spielraum für Verhandlungen, für Friedensgespräche und den Einsatz diplomatischer Mittel, wie z.B. finanzielle Anreize oder Wirtschaftssanktionen. Fasst man einen Konflikt dagegen in Kategorien von »gut« und »böse«, versteht man Täter als psychopatische Massenmörder, die nicht ruhen werden, bevor die gegnerische Seite ausgelöscht ist, werden diese Optionen hinfällig. Wird ein diskursiver Kontext geschaffen, in dem Täter_innen nur als Nachfolger_innen der Nazis oder der Hutu-Milizen begriffen werden, kommen Kompromissmöglichkeiten oftmals gar nicht mehr zur Sprache – und es besteht die Möglichkeit, dass Konflikte weiter eskalieren.17
Auch die ständige Wiederholung des Satzes von militärischer Intervention als letztes Mittel kann kontraproduktive Resultate erzeugen. Allein die Möglichkeit des Eingreifens einer fremden Macht kann zur präventiven Aufrüstung gegen als technologisch weit überlegen wahrgenommene Interventionskräfte beitragen oder im Konfliktfall zur Eskalation führen. Mahmoud Mamdani und andere warnen vor scheinbar einfachen Lösungen, die langfristige, auf Kompromissen basierende und damit stabile Konfliktlösungen verhindern und vor allem eindeutige Verlierer_innen hervorbringen, die sich dazu gezwungen sehen können, so lange wie möglich Gewalt auszuüben.18 Die Möglichkeit militärischer Intervention kann außerdem den perversen Effekt haben, dass Gruppen geradezu animiert werden, Konflikte zu eskalieren, wenn sie sich von einer Intervention Vorteile versprechen.19
Die fehlende Universalität von R2P
Auch wenn R2P das Potential hat, zu einer universellen Doktrin zu werden, ist sie doch nicht universell anwendbar. Selbst im ICISS-Bericht wird anerkannt, dass militärische Interventionen gegen den Willen einer der Vetomächte im UN Sicherheitsrat oder gegen andere Mächte kaum aussichtsreich ist. Optimistisch schränken die Autor_innen aber ein: „[D]ie Tatsache aber, dass es nicht in allen Fällen, in denen dies gerechtfertigt wäre, zu Interventionen kommen kann, ist kein Grund dafür, niemals zu intervenieren.“ 20 Solche Vorbehalte unterminieren den beanspruchten Status von R2P als einer entstehenden Norm internationalen Rechts.
Es wird praktisch niemals im Einflussgebiet der Großmächte zu Interventionen unter dem Banner von R2P kommen, und doch sind es genau diese Großmächte, die über die Fähigkeiten verfügen, solche Interventionen glaubhaft vorzutragen. Auch das wird im ICISS-Bericht anerkannt: „Die UN haben keine eigenen Militär- oder Polizeikräfte, […] in Zukunft werden Partnerschaften der Fähigen, der Willigen und Wohlmeinenden – und der ausreichend Autorisierten – in zunehmendem Maße gebraucht.“ 21
Mit R2P wird folglich eine Situation geschaffen, in der nur diejenigen Mächte dazu in der Lage sind, den militärischen Teil der Doktrin umzusetzen, die sich niemals davor fürchten müssten, dass er gegen sie selbst zur Anwendung käme. David Rieff formuliert das so: „Eine Doktrin der Intervention, die gleichzeitig moralische Superiorität und Universalität für sich beansprucht, derzufolge aber die Intervenierenden immer aus dem Globalen Norden und die Intervenierten immer aus dem Globalen Süden kommen, bringt keinen moralischen Fortschritt; sie ist der geopolitische Status quo.“ 22
R2P ist politisch bequem
Von den R2P-Befürworter_innen wird kaum jemals die Tatsache angesprochen, dass Großmächte für Verstöße gegen die Vorgaben von R2P nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Hingegen werden kleinere Staaten schnell für Kritik an oder Widerstand gegen R2P angeprangert, und es werden ihnen dunkle Motive unterstellt. In einer Rede im Jahr 2007 kritisierte Gareth Evans diejenigen scharf, die er als »Feinde« von R2P bezeichnet. Er unterstellte, die Angriffe gegen die Norm „stammen aus Ländern, die weiterhin etwas zu verbergen haben oder sich ihres Benehmens im Inland schämen sollten; deshalb sind sie so überaus zurückhaltend dabei, die Grenzen ihrer Souveränität anzuerkennen“.23
Wichtige Staaten (v.a. Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA) und verschiedene Nichtregierungsorganisationen (NRO) haben die Unterstützung von R2P zum Maßstab für Verantwortlichkeit und Führungskraft erhoben. In diesem Zusammenhang wird die Opposition aufstrebender Mächte dazu missbraucht, ihre Ansprüche zu diskreditieren. In einer Kolumne für die Huffington Post argumentierte der Geschäftsführer der »Global Coalition for the Responsibility to Protect«, einem Netzwerk von Unterstützer_innen der Norm, in Bezug auf ein mögliches Eingreifen in Libyen, „die IBSA-Länder [Indien, Brasilien und Südafrika, zu der Zeit Mitglieder des UN Sicherheitsrats] möchten ihre Fähigkeit beweisen, als permanente Mitglieder in einem reformierten und erweiterten UN-Sicherheitsrat bereit zu stehen. Ihre Bilanz bezüglich R2P ist bisher allerdings eher unausgewogen.“ 24 UN-Botschafter der westlichen Mitglieder im Sicherheitsrat verwendeten ähnliche Formulierungen, um die IBSA-Länder als irrelevant oder unerfahren zu kennzeichnen und sie damit als ungeeignet für den Sicherheitsrat abzuqualifizieren.
R2P zu einem Maßstab für Relevanz oder Verantwortung zu machen, ist ein beliebtes Instrument der (westlichen) Großmächte, um aufsässige Widersacher auf Linie zu bringen und gleichzeitig wichtige Fragen auszublenden, zum Beispiel nach der Legitimität oder Repräsentativität des UN-Sicherheitsrats oder nach der Funktion des Vetos. Außerdem dient diese Haltung dazu, die eigenen politischen Interessen zu verwischen.
R2P ist elastisch und undurchsichtig
Verfechter_innen von R2P argumentieren immer wieder, das in der Norm vertretene Verständnis von »Verantwortung« führe dazu, dass die Problembeschreibung von einem »Recht zu intervenieren« zu einem »Recht auf Schutz« für die Bevölkerung verschoben wird. R2P umgeht allerdings die Frage, wer diejenigen rechenschaftspflichtig machen soll, die mit diesem Schutz beauftragt werden. Mächte aus dem Ausland müssen nicht mit Konsequenzen rechnen, wenn sie nicht intervenieren, oder für die Art und Weise, in der sie intervenieren. Während beispielsweise die Menschenrechtsmechanismen zumindest ansatzweise dazu in der Lage sind, Staaten zur Erfüllung ihrer »Schutzverantwortung« anzuhalten, gibt es für die unter R2P vorgeschlagenen Schritte keine vergleichbaren Institutionen. Auch wenn manchmal anderes behauptet wird: Durch R2P wird kein einklagbares Recht auf Schutz durch die internationale Gemeinschaft geschaffen.
Die Betonung von Konzepten wie »Legitimität« anstatt harter, legal definierter Kriterien zur Rechtfertigung von Interventionen macht Rechenschaftspflichten unter R2P schwer greifbar. Wie können Regierungen dafür verantwortlich gemacht werden, wenn sie sich nicht an solchen Kriterien orientieren? In einem Hintergrunddokument für den ICISS-Bericht heißt es zu der Frage, wann militärische Optionen berücksichtigt werden sollten: „[E]s ist sicher nicht so, dass alle verfügbaren Möglichkeiten tatsächlich ausgeschöpft und gescheitert sein müssen, sondern vielmehr so, dass alle anderen Möglichkeiten ernsthaft in Erwägung gezogen wurden.“ 25 Wie aber wissen wir, dass andere Optionen tatsächlich »ernsthaft« erwogen wurden? Wird es Sanktionen gegen Akteure geben, die dieser Sorgfaltspflicht nicht nachkommen? Während der Krise in Libyen wurden Friedensangebote von Seiten Gaddafis von den drei westlichen Vetomächten im Sicherheitsrat zurückgewiesen, ohne ihnen ernsthaft nachzugehen, vielmehr wurden militärische Optionen bevorzugt. Für dieses Verhalten wurde aber bis heute niemand zur Verantwortung gezogen. Solange es kein rechtliches Verfahren zu Prüfung von Sicherheitsratsbeschlüssen gibt, ist es unwahrscheinlich, dass die Großmächte für eventuelles Fehlverhalten zur Verantwortung gezogen werden.
R2P verbreitet ein problematisches Geschichtsverständnis
Trotz des Anspruchs an R2P, eine universelle Norm zu bieten, wird von den Verfechter_innen oftmals ein eher eklektisches Geschichtsverständnis vertreten. Zur argumentativen Untermauerung der Doktrin werden in der Regel der Holocaust und der Massenmord in Kambodscha, Ruanda und Srebrenica angeführt. Während diese Beispiele sicher wichtig und dramatisch sind, ist die Beschränkung auf sie doch tendenziös und führt zu Missverständnissen in der Analyse von R2P.
Warum wird in der Debatte zum Beispiel nie über den Völkermord in Guatemala gesprochen, obwohl dieser Fall – neben den oben genannten – offiziell und in Gerichtsurteilen als Völkermord bezeichnet wird? Untersuchungen ergaben, dass während des Bürgerkriegs (1960-1996) hunderttausende Maya den Strafmaßnahmen des guatemaltekischen Militärs zum Opfer gefallen waren26 – die Unterstützung der US-Regierung für das guatemaltekische Militär ist übrigens gut dokumentiert.27
Auch der Timor-Leste-Konflikt spielt in den Diskussionen um R2P nur eine untergeordnete Rolle. Nach Angaben der timoresischen »Empfangs-, Wahrheits- und Versöhnungskommission« kamen während der indonesischen Besatzung (1974-1999) wenigstens 100.000 Menschen durch Unterernährung oder Gewalt ums Leben. Um sich das Ausmaß dieser Zahlen klarzumachen, muss man bedenken, dass in Timor-Leste 1974 gerade einmal 660.000 Personen lebten. Trotzdem wurde die indonesische Regierung während ihrer Besatzung von den USA, von Australien und dem Vereinigten Königreich unterstützt. Dabei hätte die Besetzung von Timor-Leste einfach verhindert werden können, vor allem durch die USA. Der Abbruch wirtschaftlicher und militärischer Kooperationsprojekte durch internationale Investoren oder Institutionen hätte die Regierung Suharto schwer getroffen und wahrscheinlich zu einem Rückzug der indonesischen Truppen geführt.28
Diese Beispiele werden von R2P-Befürworter_innen selten angeführt, weil sie nicht in das Freund-Feind-Schema von R2P passen. Obwohl manchmal auf Beispiele verwiesen wird, in denen Großmächte sich auf die Seite mordender Regime geschlagen haben – sei es aus politischen oder aus ökonomischen Gründen –, wird der Fokus doch auf den »unmoralischen« Beobachter gelenkt, der es unterlässt, zu handeln oder Verbrechen anderer zu verhindern. Samantha Powers einflussreiches Buch »A Problem from hell: America in the Age of Genocide«, in dem es in erster Linie um das Versagen der USA geht, Völkermorde zu verhindern (anstatt sie aktiv zu unterstützen), illustriert dieses Phänomen sehr plastisch. Diese Geschichtsinterpretation erlaubt es Gareth Evans zu behaupten, der Westen habe bei den größten Verbrechen Saddam Husseins weggesehen.29 In Guatemala und Timor-Leste haben die Großmächte aber mitnichten weggesehen, sondern im Gegenteil Gewalttaten sogar noch unterstützt.
Es ist abwegig, davon auszugehen, dass Großmächte im Angesicht schwerer Menschenrechtsverletzungen nichts täten – das ist aber eines der zentralen Argumentationsmuster der Krisen- und Konfliktanalysen, denen R2P zugrunde liegt. Nach der ICISS-Version von R2P spielen Großmächte zwar gelegentlich auch eine Rolle bei den Konfliktursachen, im Wesentlichen scheinen diese aber eher »da draußen« zu liegen, in armen Ländern mit ethnischen oder religiösen Konflikten, ererbten Feindseligkeiten und diktatorischen Regimen. Die vielfachen Querverbindungen dieser Regierungen zu westlichen Staaten werden dabei konsequent ignoriert.
R2P stellt die falschen Fragen
Die historischen Beispiele implizieren, dass R2P als Konzept keine Antworten für das Verständnis scheinbarer Inaktivität von Regierungen bei massiven Menschenrechtsverletzungen liefert. Die Doktrin kennt nur die Optionen, nichts zu tun oder (militärisch oder nicht-militärisch) zu intervenieren. In Wirklichkeit halten sich die Großmächte kaum jemals komplett heraus. Anstatt sich über die Rolle der Großmächte Gedanken zu machen, fragt der ICISS-Bericht nach »ethischen Ansätzen« bei Interventionen und nach der Debatte zwischen Interventionist_innen und Anti-Interventionist_innen, was die Sache in eine theoretisch konfuse Richtung lenkt.
R2P postuliert ein Entweder-Oder von Souveränität und (militärischer oder nicht-militärischer) Intervention und ignoriert dabei, dass Souveränität noch nie Interventionen verhindert hat, wenn diese im Interesse der Großmächte lagen. Obwohl der ICISS-Bericht zugibt, dass die Norm der Nichtintervention im 20. Jahrhundert viele Male gebrochen wurde, wird kein Widerspruch darin gesehen, dass R2P Souveränität als Haupthindernis beim Schutz von Menschenrechten versteht.
Die Reduktion der Souveränität auf ein Hindernis für den Schutz von Leben führt in der R2P-Diskussion zu oft zu den falschen Fragestellungen. Die fehlende Bereitschaft zur Intervention in der Vergangenheit hat ihre Ursache im mangelnden Interesse der Großmächte – bzw. im Interesse, Krisen bewusst fortbestehen zu lassen –, nicht im überbordenden Respekt vor der Souveränität eines Landes. Für dieses Problem hat R2P keine Lösung parat. Wie kann ein internationales System geschaffen werden, das auf gewaltsame Konflikte reagiert, solange die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats kein Interesse daran haben, Gewalt zu beenden, oder gewaltsame Konflikte sogar gezielt befördern?
Ein Hintergrundbericht für die ICISS gesteht ein, dass hier eine Diskrepanz besteht: „Das fehlende Glied in der Präventionskette ist der politische Wille. Die allermeisten Studien führen das Ausbleiben von Interventionen auf den fehlenden politischen Willen zurück.“ 30 Weil R2P keine Rechenschaftspflichten für die Großmächte vorsieht – auch nicht für mangelnde Interventionsbereitschaft –, kann die Doktrin auch keinen politischen Willen generieren. Stattdessen macht sie es einfacher, ohnehin geplante und gewollte Interventionen zu rechtfertigen.
Anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie man das internationale System so reformieren könnte, dass der Schutz von Menschenleben möglich ist, wird versucht, mit R2P eine extreme Option zu etablieren (militärische Interventionen), wo das bestehende System versagt. Dabei ist dieses »letzte Mittel« automatisch auch das einzige, solange das System so dysfunktional bleibt wie bisher.
Die »Politische Ökonomie« von R2P
Ein Blick auf die wichtigsten Architekt_innen und Unterstützer_innen von R2P hilft zu verstehen, wo das Konzept seinen Ausgangspunkt hatte, was die dahinterliegenden Absichten waren und wie es sich weiterentwickelt hat. Die Unterstützer_innen hatten oft ein und denselben politischen und ideologischen Hintergrund, was sich in dem Konzept niederschlug. Und der Rekurs auf historische Fälle, in denen Regierungen das »humanitäre Gewissen« zur Rechtfertigung von Krieg, Besatzung und Kolonialismus nutzten, sollten misstrauisch machen, ob R2P heute nicht in ähnlicher Weise manipulativ eingesetzt wird.
Auf staatlicher Ebene wurde R2P zuerst von Mitte-links-Regierungen unterstützt, z.B. von der liberalen Regierung Kanadas unter Jean Chrétien und der britischen Labour-Regierung unter Tony Blair. Tatsächlich hing die Unterstützung für R2P auf einzelstaatlicher und internationaler Ebene von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung ab. In Kanada nahm die Unterstützung für R2P schnell und dramatisch ab, nachdem mit Stephen Harper 2006 ein konservativer Premier das Ruder übernommen hatte. Auch die US-Regierung unter Bush stand dem Konzept ablehnend gegenüber, weil sie Bedenken hatte, R2P könne den Einsatz von Gewalt durch die USA reglementieren und die außenpolitische Souveränität einschränken. Unter Präsident Obama hingegen wird das Konzept entschieden befürwortet. 2012 setzte die US-Regierung einen Ausschuss zur Verhinderung von Gräueltaten (Atrocities Prevention Board) ein, um sicherzustellen, dass der Prävention von Völkermord und massenhaften Gräueltaten in der US-Regierung höchste Priorität zukommt.
Die Orientierung an Positionen der linken Mitte zeigt sich auch bei den NRO, die eine wichtige Rolle dabei spielten, das Konzept R2P auf internationaler und nationaler Ebene zu verbreiten und zu bewerben. Diese Organisationen verwandten viel Zeit und Mühe darauf, R2P in offiziellen UN-Dokumenten zu verankern und Mitgliedsstaaten dazu zu bringen, R2P in ihren Resolutionen zu berücksichtigen. Das »Institut für Globale Politik der Bewegung der Weltföderalisten« (World Federalist Movement-Institute for Global Policy, WFM-IGP) war eine der treibenden Kräfte hinter der Verbreitung von R2P bei den UN und darüber hinaus. 2009 war das Institut an der Gründung der »Internationalen Koalition für die Schutzverantwortung« (International Coalition for the Responsibility to Protect) beteiligt. Diese Koalition will den vermeintlichen normativen Konsens für R2P stärken, das Verständnis der Norm verbessern, sich für eine Stärkung der Kapazitäten zur Konfliktprävention und für die Beendigung von Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einsetzen und NRO dazu mobilisieren, sich auf Staatsebene für Aktionen zum Schutz von Menschenleben einzusetzen. Mit dem »Globalen Zentrum für die Schutzverantwortung« (Global Centre for the Responsibility to Protect) wurde 2008 erstmalig eine Organisation gegründet, die sich speziell dafür einsetzt, dass R2P umgesetzt und operationalisiert wird. Auch unter NRO, die sich in humanitären Krisen engagieren, fand R2P ein positives Echo, zum Beispiel bei Oxfam, Human Rights Watch, Refugees International, International Save the Children Alliance und Care. Sie setzen sich in ihrer politischen und Menschenrechtsarbeit für R2P ein. Man kann dennoch nicht davon sprechen, dass R2P unter NRO universelle Unterstützung erfährt.
Auch Akademiker_innen spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung von R2P. Viele hochkarätige Unterstützer_innen kamen von den Eliteuniversitäten an der US-Ostküste. Vor allem an der Universität Harvard konzentrierten sich Schlüsselpersonen für das Konzept der R2P, z.B. der kanadische Forscher und ehemaligen Politiker Michael Ignatieff (eines der Mitglieder der ICISS und meinungsstarker Unterstützer von R2P), Samantha Power, die gegenwärtige Botschafterin der US-Regierung bei den Vereinten Nationen, und Anne-Marie Slaughter, Professorin in Harvard und Princeton. Weitere wichtige Wissenschaftler waren Gareth Evans, ehem. Außenminister Australiens und nun Präsident der Australischen Nationaluniversität in Canberra, und Thomas Weiss, Geschäftsführer des Ralph-Bunche-Instituts für Internationale Studien an der City University New York, wo auch das »Global Zentrum für Schutzverantwortung« untergebracht ist.
Ein Regierungsprojekt
Auch wenn heute viele zivilgesellschaftliche Organisationen R2P unterstützen und verbreiten, war das Projekt zu Beginn eine Initiative von Regierungen. Anfangs schlug dem Bericht der ICISS großes Misstrauen entgegen, weil NRO befürchteten, das Konzept könnte zur Legitimierung von militärischer Gewalt missbraucht werden. Die kanadische Regierung spielte eine Schlüsselrolle dabei, das zu ändern. Sie trat an WFM-IGP heran und brachte das Institut dazu, eine Reihe von Konsultationen mit anderen NRO durchzuführen, um herauszufinden, was diese über das Konzept dachten.31 Daraufhin initiierte WFM-IGP das Projekt »Responsibility to Protect – Engaging Civil Society« (etwa: Ein Dialog mit der Zivilgesellschaft über R2P), um andere Organisationen in die Verbreitung von R2P mit einzubeziehen. Ein Bericht von WFM-IGP über das Projekt unterstreicht die enge Einbindung der kanadischen Regierung während des gesamten Prozesses. Er besagt, dass „Vertreter der kanadischen Regierung […] an mehreren der von WFM-IGP organisierten Runden Tische teilnahmen und sich während des Konsultationsprozesses auch bei mehreren Anlässen individuell mit WFM-IGP trafen“.32
Dieses Beispiel zeigt, dass Geld von Regierungen eine wichtige Komponente bei der Verbreitung von R2P innerhalb der Zivilgesellschaft war. Manche Regierungen zeigten sich besonders großzügig: 2009 stellte die australische Regierung für einen Vierjahreszeitraum insgesamt 4,5 Millionen AU$ bereit, um das Konzept R2P regional und global weiter zu verbreiten.33
Die Architekt_innen von R2P waren sich stets bewusst, dass Unterstützung aus der Zivilgesellschaft für die Legitimierung des Konzepts unerlässlich war, vor allem, wenn es um die militärische Option ging. Schon der ICISS-Bericht bezeichnet NRO als die „internationalen Akteure, denen“ neben den Medien und regionalen Akteuren „beim Thema Intervention eine immense Rolle zukommt“. Der Bericht nennt auch die wichtige Funktion der Zivilgesellschaft bei der Rechtfertigung des Einsatzes von Gewalt. Es wird erwähnt, NRO seien manchmal zurückhaltend, Zwangsmaßnahmen öffentlich zu befürworten. Dabei sei es für Regierungen und internationale Organisationen schwierig, diese anzuwenden, wenn die öffentliche Unterstützung dafür fehle.34
Während der »humanitären Interventionen« der 1990er Jahre und der Ausarbeitung von R2P zeigten sich einige NRO offen für eine interventionistische Politik. Seit den 1990er Jahren wurden militärische Interventionen vermehrt unter Bezug auf die Menschenrechte gerechtfertigt, meist ohne wesentlichen Widerstand von Menschenrechtsorganisationen. Durch die Begründung militärischer Interventionen im Duktus der Menschenrechte und der Morallehre wurden einige NRO offener für die Möglichkeit, Gewalt einzusetzen. Auch gibt es nun eine größere Übereinstimmung zwischen solchen Staaten, die R2P unterstützen und entsprechende Interventionen durchführen könnten, und Teilen der Zivilgesellschaft.
Widerstand gegen R2P
R2P-Unterstützer_innen weisen Kritik an dem Konzept gewöhnlich zurück, indem sie auf angebliche Missverständnisse oder ein antiquiertes Verständnis von »Souveränität« verweisen. So wird oft behauptet, die Opposition gegen R2P komme nur von einer kleinen Minderheit von Regierungen, die verdächtige Motive für ihre Ablehnung hätten. Thomas Weiss zum Beispiel schreibt, dass „die allgemeine Debatte über die Schutzverantwortung bei den Vereinten Nationen oft vom diplomatischen Geschick einiger weniger Dritte-Welt-Länder verzerrt wird“.35
So verlaufen die Frontlinien in der internationalen Diskussion natürlich nicht. Aber tatsächlich gibt es keine einhellige Unterstützung für R2P, auch wenn die »Schutzverantwortung« z.B. Eingang in das Abschlussdokument des Weltgipfels von 2005 fand. Die Formulierungen dort unterscheiden sich beträchtlich von denen im ICISS-Bericht, sind knapp gehalten und können sogar als Untermauerung des Status quo verstanden werden. Selbst R2P-Verfechter_innen können nicht bestreiten, dass bei dem Gipfel „weit weniger erreicht wurde, als erhofft“.36 Einige, darunter Gareth Evans, geben zu, dass verschiedene UN-Mitgliedstaaten ihre Zustimmung zum Abschlussdokument trotz der abgeschwächten Inhalte inzwischen bereuen. Besonders die Ambiguitäten des Konzepts und die Frage des Einsatzes von Gewalt werden hinterfragt.
Einwände vonseiten Chinas, Russlands, Pakistans, Indiens, Bangladeschs, Indonesiens, Malaysias, Ägyptens, Boliviens, Venezuelas oder Ecuadors (um nur einige der Staaten zu nennen, die Vorbehalte gegen R2P vorgebracht haben) werden häufig als reflexhafte Reaktionen wenig demokratischer Regime abqualifiziert. Seltener wird erwähnt, dass auch hoch angesehene Menschenrechtsorganisation, wie Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF), gewichtige Kritik an R2P üben. 2010 veröffentlichte »CRASH«, das Forschungszentrum von MSF, einen langen Artikel, der erklärt, warum MSF R2P ablehnt. Der Artikel bringt die Befürchtung zum Ausdruck, dass sich hinter R2P lediglich die Doktrin des »gerechten Krieges« verberge und das Konzept letztendlich zu einer Legalisierung einer neuen Form des Imperialismus führe. Der Artikel führt aus, dass der Einsatz bewaffneter Gewalt, auch als letztes Mittel, praktisch immer menschliches Leid hervorrufe. „Wenn es der Zweck humanitärer Aktionen ist, die Verwüstungen des Krieges einzugrenzen, dann taugen sie nicht dazu, neue Kriege zu rechtfertigen“.37 MSF ist nicht die einzige Organisation, die sich von R2P abgrenzen möchte. Gerade humanitäre Organisationen, die in Krisengebieten arbeiten, sind sich des Risikos bewusst, das entsteht, wenn ihre Arbeit mit einem solchen politischen, höchst umstrittenen Konzept in Verbindung gebracht wird.
Widerstand hat sich auch dort formiert, wo man das vielleicht am wenigsten erwartet hätte: Bürger_innen einiger Länder, deren Regierungen die Doktrin am stärksten unterstützen, sind gegenüber dem Konzept sehr misstrauisch und zurückhaltend. Die »Legitimitätskrise« von R2P wurde besonders deutlich, als im syrischen Bürgerkrieg eine militärische Intervention kurz bevorzustehen schien: Das britische Parlament stimmte gegen eine Intervention, und auch der US-Kongress lehnte sie ab. Solche Zweifel an R2P werden oft als Isolationismus abgetan, selbst R2P-Unterstützer_innen müssen aber zugeben, dass sich Bürger_innen manipuliert fühlen, wenn zu hartnäckig auf »moralische Pflichten« verwiesen wird.
R2P im historischen Kontext
R2P wird gerne als großer Fortschritt in den internationalen Beziehungen präsentiert, das Konzept hat aber viele historische Vorbilder. Wenn zum Beispiel Gareth Evans behauptet, eine instinktiv kritische Haltung zum Einsatz militärischer Gewalt sei traditionell ein Charakteristikum der politischen Linken,38 dann übersieht er die lange Geschichte der links-liberalen Unterstützung für Kolonialismus und militärische Interventionen.
Es gibt einige historische Beispiele dafür, dass »humanitäre« Gründe von progressiven, im liberalen Milieu zu verortenden Gruppen herangezogen wurden, um die koloniale Besatzung von Territorien zu rechtfertigen. Viele Völkerrechtler des 19. und 20. Jahrhunderts sahen den Kolonialismus nicht nur als historische Notwendigkeit, dessen schrecklichste Folgen gemildert werden sollten, sie postulierten auch eine moralische Pflicht, eine weltweite Föderation souveräner Staaten zu bilden, die von humanitären Gesetzen geleitet sein sollte.39 Viele Humanitarist_innen und Philantropist_innen argumentierten dafür, »die Wilden« müssten auf den Status zivilisierter Völker gehoben werden, bevor sie vom Schutz durch das Völkerrecht profitieren könnten. Diese Geschichte wird im Diskurs um R2P oft ignoriert. Es wird unterschlagen, dass fortschrittliche Gruppen im Sinne kolonialer Interessen mobilisiert wurden und dass diese die Idee unterstützten, der Kolonialismus würde Menschen aus Ignoranz, Rückständigkeit und Elend befreien.
Der Schatten dieser Geschichte hängt tief über R2P. Selbst die Sprache der Kolonisator_innen der vorigen Jahrhunderte scheint in den Diskussionen um R2P Widerhall zu finden. Im ICISS-Bericht zum Beispiel findet sich das Verständnis von militärischer Besatzung als Prozess der Zivilisierung wieder: „Neben der, hoffentlich stattfindenden, Beseitigung oder zumindest weitgehenden Minderung der Hauptursachen des ursprünglichen Konflikts und der Wiederherstellung eines Maßes an guter Regierungsführung und wirtschaftlicher Stabilität, kann eine solche [Besatzungs-] Periode die Bevölkerung auch an demokratische Institutionen und Prozesse heranführen, falls es diese in ihrem Land zuvor nicht gegeben hat.“ 40 In Kenntnis dessen, was in Irak nach der US-geführten Invasion vor sich ging, kann man diese Vorhersage nur für bitter ironisch halten.
Im Gegensatz zu liberalen und mitte-links zu verortenden Gruppen und Akteuren wiesen konservative Politiker_innen R2P zwar überwiegend zurück. Aber es gibt eine Überschneidung zwischen den Hoffnungen der Links-Liberalen und der Konservativen. Der Diskurs um R2P hat viele Parallelen zum Diskurs um Terrorismusbekämpfung. Das Konzept der zerfallenden Staaten, die Gefahren für die internationale Ordnung, die angeblich von ihnen ausgehen, und das Konzept der präemptiven Intervention sind zentral sowohl im Diskurs um R2P als auch im »Krieg gegen den Terror«. Beide machen Anleihen bei der Doktrin des »gerechten Krieges«.
Mit R2P hat eine Moralisierung militärischer Interventionen stattgefunden. Indem liberale und links der Mitte zu verortende Intellektuelle R2P weiter verbreiten und verfechten, tragen sie zu einer gefährlichen Remilitarisierung der internationalen Beziehungen bei. Dies ist keine Fehlinterpretation von R2P, es ist vielmehr in der Formulierung des Konzepts von Anfang an angelegt.
Schlusswort
Mit R2P wird keine Antwort auf die eigentlich zentrale Frage gegeben: Wie lassen sich massive Menschenrechtsverletzungen und massenhaftes Morden vermeiden, und wie kann man angemessen darauf reagieren? Das Konzept bleibt zu vage, es basiert auf ungeprüften und unrealistischen Grundannahmen, stellt nicht die richtigen Fragen, dreht sich am Ende doch nur um die als letztes Mittel ausgegebene militärische Intervention. R2P ist vor allem deswegen so gefährlich, weil das Konzept Argumente und Vorschläge vermischt und weil es unumstrittene Vorstellungen (dass Staaten eine Verantwortung gegenüber ihren Bürger_innen haben) mit höchst umstrittenen verwebt (dass militärische Intervention ein geeignetes und angemessenes Mittel sei, um Bürger_innen zu schützen). R2P ist nicht nur offen für Missbrauch, sondern öffnet dem Missbrauch Tür und Tor.
Bestenfalls ist R2P ein Werkzeug, um die Aufmerksamkeit auf entstehende Krisen und ihre möglichen Folgen zu lenken. Schlechtestenfalls lenkt R2P von der schwierige Frage nach der eigenen Rolle in Konflikten und nach der Mitverantwortung für Konfliktursachen ab. R2P könnte zu einer moralintriefenden Haltung führen, die die Tür für komplizierte und mühsame Verhandlungslösungen verschließt, während sie Protagonist_innen vermeintlich einfacher, martialischer Lösungen eine Bühne bietet und Applaus sichert.
Anstatt ein Prinzip der internationalen Beziehungen gegen ein anderes auszuspielen – Souveränität und Nicht-Intervention gegen Menschenrechte – und anstatt militärische Interventionen als (wenn auch letztes) Mittel der Politik zu stärken, ist es dringend notwendig, mehr Aufmerksamkeit und Kapazitäten darauf zu verwenden, dass Situationen, in denen diese zum Einsatz kommen könnten, gar nicht erst entstehen. Anstatt darüber zu schwadronieren, dass eine militärische Intervention als letztes Mittel nicht von vornherein verworfen werden dürfe, sollte daran gearbeitet werden, vielversprechende Ansätze zur Verhütung von Krisen im internationalen System zu stärken. Diese erfüllen alle der von R2P postulierten Funktionen, ohne die Prinzipien der friedlichen Konfliktbeilegung und der gleichrangigen Souveränität der Staaten zu verletzen.
Jede_r würde zustimmen, dass dabei der Fokus eindeutig auf der Verhinderung und Prävention von gewaltsamen Konflikten und Katastrophen liegen muss. Um diesen Fokus zu gewährleisten, darf aber nicht gleichzeitig über Reaktionen (vor allem gewaltsame) auf Konflikte diskutiert werden. So wird lediglich Konfusion geschaffen, und es werden Kompromissmöglichkeiten verbaut. Weiterhin schließen sich angesichts knapper Ressourcen im internationalen System (man denke nur an die Finanzsituation der Vereinten Nationen) die Fähigkeiten zum Aufbau sowohl von Präventions- als auch von militärischen Reaktionsfähigkeiten wechselseitig aus. Zuletzt wird mit der Formulierung einer Verantwortung der internationalen Gemeinschaft (was internationale Organisationen mit einschließt) dazu beigetragen, dass Institutionen und Akteure, die zuvor als Vermittler und neutrale Instanzen bereitstanden, in die Rolle von Konfliktparteien gedrängt werden. Auch das wird kaum zu Deeskalation beitragen.
Mit R2P wird eine sehr begrenztes Set von Mechanismen der Konfliktprävention verbreitet, das in der Praxis auf militärische Eskalation hinauszulaufen droht. Obwohl beispielsweise der ICISS-Bericht akzeptiert, dass Präventionsbemühungen komplex sind, und obwohl viele wichtige Aspekte (z.B. die Bedeutung der Partizipation der Zivilbevölkerung) angesprochen werden, bleibt es doch bei der reinen Nennung – es werden praktisch keine Vorschläge gemacht, wie diese Aspekte verwirklicht werden könnten. Anstatt aber dafür nur vage Hinweise zu liefern, die Möglichkeiten von und Bedingungen für militärische Interventionen hingegen detailliert auszuarbeiten, ist es unbedingt notwendig, mehr Kapazitäten für strukturelle Veränderungen bereitzustellen, die die Ursachen von Konflikten beseitigen könnten. Bereiche, in denen wenigstens Reformen, wenn nicht gar grundlegender Wandel dringend angezeigt sind, sind beispielsweise: die verbindliche Regulierung transnationaler Konzerne (in Bezug auf ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten, aber auch was ihre menschenrechtlichen Pflichten angeht); die extraterritorialen Pflichten von Staaten in Bezug auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte; internationale Kooperation, die die strukturellen Ursachen von Armut tatsächlich beseitigt; die krisenanfälligen und strukturelle Ungleichheit befördernden Finanz- und Handelssysteme; die Beseitigung illegaler und illegitimer Finanzflüsse (zum Beispiel aus Steuervermeidung und -hinterziehung); Ernährungssouveränität; Klima- und Umweltpolitik; Kontrolle des Waffenhandels; und eine Reform hin zu einem tatsächlich multilateralen und funktionalen internationalen System unter dem Dach der UN.
Um es noch einmal in wenigen Worten zusammenzufassen: Mit R2P wird die falsche Antwort auf falsche Fragen gegeben, die auf einer verkürzten Problemanalyse aufbauen. Es ist darum nicht zielführend – und wir hoffen, dafür die Argumente geliefert zu haben –, sich der einzelnen Mängel des Konzepts und seiner praktischen Anwendung Stück für Stück anzunehmen, zum Beispiel indem höhere Hürden für militärische Interventionen formuliert werden. Stattdessen sollten die vorhandenen, knappen Ressourcen darauf verwendet werden, zivile Mittel der Konfliktprävention und -lösung auszubauen. Dieser Weg hat sicher nicht die bestechende Einfachheit und scheinbare Stringenz von R2P. Bestehende und noch zu schaffende Alternativen werden aber mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer friedlichen Welt beitragen als jedes noch so weiterentwickelte oder reformierte Konzept der Schutzverantwortung.
Anmerkungen
1) Kofi Annan (1998): Ditchley Foundation Lecture XXXV. 26.06.1998.
2) ICISS (2001): The Responsibility to Protect – Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ottawa. S. VII.
3) Eine Zusammenfassung der Unterschiede der R2P-Definitionen nach ICISS und dem Abschlussdokument des Weltgipfels von 2005 enthält Hugh Breakey (2012): The Responsibility to Protect: Game Change and Regime Change. In: Charles Sampford et al. (eds): Norms of Protection: Responsibility to Protect, Protection of Civilians and Their Interaction. Geneva: United Nations University Press, S.11-39.
4) Eine Umfassende Bewertung der Libyen-Intervention bietet Reinhard Merkel (2011): Die Intervention der NATO in Libyen – Völkerrechtliche und rechtsphilosophische Anmerkungen zu einem weltpolitischen Trauerspiel. Zeitschrift für Strafrechtsdogmatik, 10/2011, S.771-783.
5) Gareth Evans (2007a): Responsibility to Protect in 2007: Five Thoughts for Policy Makers. Presentation to Panel Discussion on The Responsibility to Protect: Ensuring Effective Protection of Populations under Threat of Genocide and Crimes Against Humanity, Program to Commemorate 1994 Rwandan Genocide. 14.04.2007. New York: United Nations.
6) Christine Bell (2012): Who Let the Dogs Out? R, R2P. Human Rights and Human Welfare – an online journal of academic literature review. Roundtable.
7) Gareth Evans (2007b): Delivering on the Responsibility to Protect: Four Misunderstandings, Three Challenges and How To Overcome Them. Address to SEF Symposium 2007, The Responsibility to Protect (R2P): Progress, Empty Promise or a License for »Humanitarian Intervention«. 30.11.2007. Bonn: Stiftung Entwicklung und Frieden. Thomas Weiss (2007): Humanitarian intervention: ideas in action. Cambridge: Polity, S.106.
8) Vgl. z.B. Thomas Weiss (2006): R2P after 9/11 and the World Summit. Wisconsin International Law Journal, 24:3. S.741-760.
9) Thomas Weiss/Don Hubert (2001): The responsibility to protect: research, bibliography, background. Ottawa: International Development Research Centre. S.97, 113.
10) Alex Bellamy (2009): Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities. London: Wiley. S.52.
11) David Rieff (2011a): Saints Go Marching In. National Interest, 21.06.2011.
12) Einen Eindruck von der Komplexität der Situation geben die Artikel von Seymour Hersh: Whose Sarin? London Review of Books, 35:24, S.9-12 und The Red Line and the Rat Line. London Review of Books, 36:8, S.21-24.
13) Zu dem hier diskutierten Aspekt siehe für eine umfassendere Darstellung und Diskussion Peter Rudolf (2013): Schutzverantwortung und humanitäre Intervention: Eine ethische Bewertung der »Responsibility to Protect« im Lichte des Libyen-Einsatzes. SWP-Studie. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik.
14) Michael Ignatieff (2013): How to Save the Syrians. New York Review of Books Blog, 13.9.2013.
15) ICISS, a.a.O., S.35.
16) Alex de Waal et al. (2012): How Mass Atrocities End: An Evidence-Based Counter-Narrative. Fletcher Forum of World Affairs, 36:15, S.15-31.
17) Ebd.
18) Mahmood Mamdani (2013): The Logic of Nuremberg. London Review of Books, 35:21, S.33-24.
19) de Waal (2012), a.a.O.
20) ICISS, a.a.O. S.37.
21) Ebd., S.52.
22) David Rieff (2011b): R2P, R.I.P. New York Times, 7.11.2011.
23) Evans (2007a), a.a.O.
24) Simon Adams (2012): Emergent Powers: India, Brazil, South Africa and the Responsibility to Protect. Huffington Post, 20.09.2012.
25) Weiss/Hubert (2001), a.a.O., S.150.
26) Suzanne Jonas (2009): Guatemala: Acts of Genocide and Scorched-Earth Counterinsurgency War. In: Samuel Totten/William Parsons (eds.): Century of Genocide. New York/London: Routledge, S.355-394, hier 381.
27) Elizabeth Malkin (2013): Trial on Guatemalan Civil War Carnage Leaves Out U.S. Role. New York Times, 16.05.2013.
28) Brad Simpson (2005): „Illegally and Beautifully“: The United States, the Indonesian Invasion of East Timor and the International Community, 1974-76. Cold War History, 5:3, S.281-315.
29) Gareth Evans (2003): The Responsibility to Protect: When It’s Right to Fight. Progressive Politics, 31.7.2003.
30) Weiss/Hubert (2001), a.a.O., S.42.
31) Doris Mpoumou (2010): Role of Civil Society in Advancing the Responsibility to Protect. Opening remarks. Early Warning for Protection: Technologies and Practices for the Prevention of Mass Atrocity Crimes, November 3-4, 2010. Phnom Penh: Oxfam.
32) Word Federal Movement – Institute for Global Policy (2003): Civil Society Perspectives on the Responsibility to Protect. New York:WFM – IGP, S.8.
33) Australian Minister for Foreign Affairs and Trade: Media Release – Attachment. Australian Responsibility to Protect Fund – Final Results of R2P Fund Selection Committee. 25 September 2009.
34) ICISS (2001), a.a.O., S.73.
35) Thomas Weiss (2011): Thinking about global governance: why people and ideas matter. London.
36) Bellamy (2009): a.a.O., S.91.
37) Fabrice Weissman (2010): Not In Our Name: Why Médecins Sans Frontières Does Not Support the Responsibility to Protect. In: Criminal Justice Ethics, 29:2, S.194-207.
38) Evans (2003), a.a.O.
39) Martti Koskenniemi (2002): The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press..
40) ICISS (2001), a.a.O., S.44.
Lou Pingeot ist Politikwissenschaftlerin und war von 2010 bis 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin von Global Policy Forum in New York. Seit 2014 ist sie freie Mitarbeiterin von Global Policy Forum und Doktorandin an der McGill University in Montreal.
Wolfgang Obenland ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Programmkoordinator beim Global Policy Forum in Bonn.