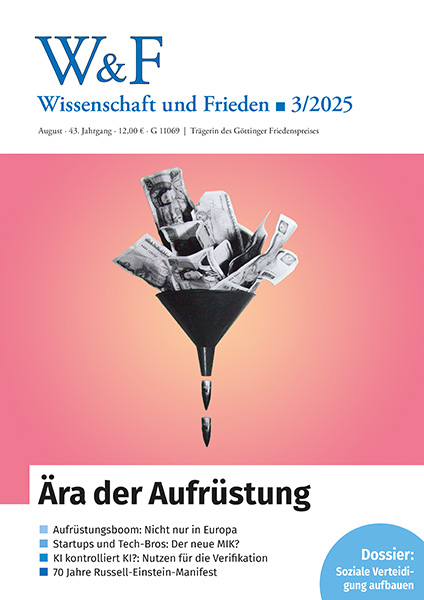Soziale Verteidigung aufbauen
Drei Jahre Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«
von Jochen Neumann, Marie-Christin Barleben, Stephan Brües, Martin Arnold, Julia Kramer und Jan Stehn
Herausgegeben vom Bund für Soziale Verteidigung e.V. (BSV) und der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden e.V. (IWIF)
erscheint als Beilage zu W&F 3/2025
Unsere »Zeitenwende«
Soziale Verteidigung voranbringen
von Jochen Neumann
Ich war geschockt, als Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 die »Zeitenwende« proklamierte – drei Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine. Mit einem Sondervermögen in Höhe von 100.000.000.000 € sollte eine massive militärische Aufrüstung finanziert werden. Inzwischen hat die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz finanzielle Mittel in unvorstellbarer Höhe beschlossen, um die Bundeswehr und uns als Gesellschaft hochzurüsten. In den Worten des Bundesverteidigungsministers Pistorius müssen wir als Gesellschaft »kriegstüchtig« werden.
Ich habe mich an diesem Sonntag im Februar 2022 gefragt, warum so viele Politiker*innen, aber auch viele Menschen um mich herum, in Waffenlieferungen für die Ukraine oder der militärischen Aufrüstung in Deutschland die Lösung sehen.
Es gibt da sicher viele Erklärungsansätze. Als Politikwissenschaftler weiß ich um die systemischen Faktoren, die politischen Machtverhältnisse und die Profitinteressen der Rüstungsindustrie. Von entscheidender Bedeutung ist für mich jedoch eine sozialpsychologische Erklärung, warum so viele Menschen und Gesellschaften auf militärische Verteidigung vertrauen: Unsere Sozialisierung, vor allem auch der Geschichtsunterricht in der Schule, ist davon geprägt, dass es nicht nur legitim ist, sich mit Gewalt gegen Gewalt zu wehren, sondern vermeintlich auch erfolgreich.
Dabei ist das faktisch falsch. Es gibt unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass in den letzten 100 Jahren gewaltfreier Widerstand erfolgreicher war als gewaltsamer (vgl. Stehn in diesem Dossier, S. 26).
Es handelt sich jedoch nicht einfach nur um eine Art »Bildungslücke«, die wir mit Bildungsarbeit füllen könnten. Es braucht mehr. Wir können auch nicht nur fordern: „Nein zu Krieg und Aufrüstung“. Es braucht mehr.
Es braucht das Erleben einer funktionierenden Alternative zur militärischen Verteidigung. So wie wir im Wendland nicht nur „Nein zu Atomkraft“ gesagt haben, sondern auch Pioniere für alternative Energiequellen geworden sind, müssen wir auch jetzt die Alternativen aufzeigen und leben. Die Alternative zu Militär und Aufrüstung muss umgesetzt werden, erlebbarer und bekannter werden. Diese Alternative nennt sich »Soziale Verteidigung« (vgl. Barleben in diesem Dossier S. 3 zur Definition und Herkunft des Konzepts).
Dieses Ziel, Soziale Verteidigung nicht nur bekannter zu machen, sondern in die Tat umzusetzen und so für mehr und mehr Menschen erlebbar zu machen, hat sich die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« gesetzt (vgl. Neumann in diesem Dossier S. 6 zur Gründung, Zielsetzung, dem Aufbau und dem Modellregionen-Ansatz der Kampagne).
Am Tag als von Bundeskanzler Scholz die »Zeitenwende« ausgerufen wurde, habe ich zu meiner Frau gesagt, dass ich wohl nicht mehr erleben werde, dass wir das wieder rückgängig machen. Es ist schwer, zuversichtlich zu bleiben, gegen den Trend zu arbeiten und zu erleben, wie die Hochrüstung Schritt für Schritt umgesetzt wird. Ich habe aber gleich dazu gesagt, dass es meine Generation sein muss, die jetzt dagegen hält.
Die Berichte und Reflexionen aus den Modellregionen in Berlin-Moabit, am Oberrhein und im Wendland sowie der Regionalgruppe in Essen machen Mut und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind (vgl. die Beiträge von Barleben S. 11, Brües S. 8, Neumann S. 15 und Arnold S. 20. in diesem Dossier). Konkrete lokale Handlungskonzepte für Soziale Verteidigung werden entwickelt – im Übrigen nicht nur für den Fall eines militärischen Angriffs von außen, sondern auch für die Bedrohung von innen wie eine rechtsextremistische Machtübernahme (vgl. Neumann in diesem Dossier S. 19).
Es gibt zahlreiche historische Beispiele aus aller Welt, die zeigen wie die Menschen sich gewaltfrei verteidigt haben. Meist geschah dies spontan, ohne Vorbereitung, und dennoch sehr erfolgreich. Wie sehr würden sich die Erfolgschancen noch steigern lassen, wenn wir uns als Gesellschaft systematisch darauf vorbereiten würden, uns sozial zu verteidigen? Dafür bräuchte es sicher auch keine hunderte Milliarden Euro.
Wie wir Soziale Verteidigung in unserer eigenen Gesellschaft aufbauen können, können wir auch von anderen Bewegungen aus dem Globalen Süden lernen (vgl. Kramer zum zivilen Widerstand, gegenseitiger Fürsorge und kollektiven Sicherheitsstrategien im Sudan in diesem Dossier, ab S. 23). Es bleibt noch viel zu tun. Aber im Grunde sind wir es, die eine wahre »Zeitenwende« voranbringen: Die Abkehr von der militärischen Verteidigung hin zur Sozialen Verteidigung.
Was heißt Soziale Verteidigung?
von Marie-Christin Barleben
Soziale Verteidigung (SV) bezeichnet ein Konzept des gewaltfreien, gesellschaftlichen Widerstands gegen Unterdrückung und Aggression. Sie nutzt dabei die Methoden aktiver Gewaltfreiheit und zivilen Ungehorsams.1 Anders als der zivile Ungehorsam zieht sie ihren Anlass aber nicht aus dem Aufbegehren gegen bestehende, legale staatliche Strukturen, Maßnahmen oder Gesetze, sondern ist als Alternative zu militärischer Verteidigung auf den Widerstand im Fall einer illegitimen Machtübernahme – wie eines Krieges oder Putsches – ausgerichtet. Sie ist auch zu unterscheiden von der Zivilen Verteidigung, welche sich auf den Bevölkerungsschutz im Kriegsfall bezieht. »Sozial« ist dabei eine doppelte Beschreibung. Zum einen verweist »Sozial« darauf, dass die Akteure in einem solchen Szenario nicht einzelne Spezialkräfte (wie Soldat*innen) sind, sondern die Gesamtbevölkerung eines Landes betroffen ist, zum anderen ist das Ziel weniger die Verteidigung von Grenzen, als vielmehr die Verteidigung sozialer Errungenschaften und Werte.
Zur Historie des Ansatzes
Die Idee des gewaltfreien Widerstandes ist seit der Antike belegt. Für die Moderne wird zumeist Gandhi als zentrale Figur und »Satyagraha« als maßgebliche Haltung benannt (Arnold 2011). In Deutschland ist in den letzten Jahren die Diskussion um den methodisch eng verwandten zivilen Ungehorsam vor allem durch die Proteste der Protestbewegung »Letzte Generation vor den Kipppunkten« neu entbrannt. Dies gilt allerdings noch nicht für die SV, die die Hochzeit ihrer theoretischen Reflexion in den 1980er Jahren hatte und mit Ende des Kalten Krieges nahezu vollständig sowohl aus dem öffentlichen Diskurs als auch aus der systematischen Erörterung innerhalb der Friedens- und Konfliktforschung verschwand.
Es können insgesamt drei Entwicklungsphasen des Konzeptes der Sozialen Verteidigung abgegrenzt werden (vgl. Lammers und Schweitzer 2023).
- Schon vor dem 1. Weltkrieg lassen sich Anfänge der Reflexion nachweisen, z.B. William James »The Moral Equivalent to War« von 1910. In den 1930er Jahren entstanden dann mehrere Entwürfe zu gewaltfreiem Widerstand und v.a. Gandhis Salzmarsch und seine Aufrufe sich gewaltfrei gegen Nazideutschland zu wehren, machten den Ansatz bekannt.2
- In den 1950er-70er Jahren erfolgte die theoretische Entwicklung des Konzeptes, beginnend mit der Studie »Defence in the Nuclear Age« des britischen Offiziers Stephen King-Hall. Es folgten bald explizite Friedensforscher, die zumindest namentlich hier einmal Erwähnung finden sollen: Gene Sharp, Johan Galtung, Quincy Wright, April Carter, Adam Roberts, Gernot Jochheim, Anders Boserup und Andrew Mack.
- In den 1980er wurde die deutsche Debatte dann vor allem von Theodor Ebert vorangetrieben, während zugleich Basisbewegungen (Graswurzelaktivist*innen) begannen an der praktischen Gestaltung zu arbeiten (vgl. Ebert 1991).
Die von Lammers und Schweitzer angeführte vierte Phase, die einen neuen Aufschwung seit 2022 konstatiert, zeigt sich bislang höchstens in vereinzelten Aktivitäten. Zwar hat sich der Bund für Soziale Verteidigung (BSV) dem Thema wieder verstärkt zugewandt und bereits in einigen einschlägigen Publikationen formuliert, aber die größere Platzierung des Themas im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs ist bisher noch nicht gelungen. Anders ist das bei der Erforschung konzeptionell offener gehaltenen gewaltfreien Widerstands, der spätestens seit der wegweisenden Studie »Why Civil Resistance Works« von Erica Chenoweth und Maria J. Stephan (2011) verstärkt in den Fokus rückte. Die Autorinnen konnten nachweisen, dass im untersuchten Zeitraum 1900-2006 gewaltfreie Aufstände mehr als doppelt so oft erfolgreich waren wie die gewaltsamen, ihre Ziele zu erreichen (Chenoweth und Stephan 2011, vgl. dazu auch Stehn in diesem Dossier, S. 26).3
Grundlagen der Sozialen Verteidigung
SV beruht auf der Annahme, dass jede Herrschaft auf ein Minimum an Kooperation der Beherrschten angewiesen ist. Fällt diese Kooperation weg, verliert das Regime den Rückhalt und ist zum Scheitern verurteilt. Ziel von Sozialer Verteidigung ist es deshalb immer, diese Machtlogik zu brechen (Sharp 1971, S. 26f.). Eine militärische Besatzung kann immer nur einen geringen Anteil an Führungspersonen durch ihre eigenen Leute ersetzen und ist ansonsten darauf angewiesen, dass die Bevölkerung Grundstrukturen des täglichen Lebens aufrechterhält. Die Autorität lässt sich dabei auf verschiedenen Wegen unterminieren, je nachdem welche Gruppe adressiert wird. Anders als bei militärischer Verteidigung, die von Soldat*innen, also Spezialist*innen, getragen wird, kann sich jede Person nach ihren jeweiligen Möglichkeiten am Widerstand beteiligen, es braucht dazu keine besonderen physischen oder technischen Fähigkeiten. Dies kann sogar unvorbereitet gelingen, eine gezielte Vorbereitung durch Trainings auf Möglichkeiten des gewaltfreien Widerstands ist trotzdem sinnvoll.
Grundmotivation hinter dem Ansatz der Sozialen Verteidigung ist, dass nicht Grenzen, sondern gemeinsame Werte und Güter wie Freiheit, Gemeinschaft, Demokratie, Familie, aber auch Infrastruktur verteidigt werden, die in einer konventionellen militärischen Auseinandersetzung kaum zu schützen sind. Auch wenn der Ansatz nicht per se anti-staatlich oder anti-national zu verstehen ist, so versteht er doch die Verteidigung nicht als an klassischen Elementen der Staatenlehre (Volk, Territorium, Staatsgewalt) orientiert.
Die Methoden sind dabei überaus vielfältig, Gene Sharp listet in seinem zentralen Werk zu dieser Frage allein 198 verschiedene Formen des Widerstands auf (Sharp 2014, S. 101-108). Dazu gehören direktere bzw. sichtbarere Formen wie die öffentliche Rede, Streiks und Demonstrationen ebenso wie indirektere oder auch versteckte Methoden von der Nichtzusammenarbeit und dem Boykott bis hin zu alternativen Regierungsstrukturen im Untergrund. Zwei der zentralen Methoden und ihre Wirkweisen sollen im Folgenden kurz an zwei historischen Beispielen verdeutlicht werden.
Dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration
1940 besetzten deutsche Truppen Norwegen. Eine der ersten Regierungsmaßnahmen betraf die Reform des Bildungssystems im NS-ideologischen Sinne. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der Lehrer mit großer Unterstützung der Bevölkerung. Diese weigerten sich, die neuen Maßnahmen umzusetzen, verweigerten den Eid auf die NS-Ideologie und sprachen auch mit den Schüler*innen darüber. Trotz Einschüchterung, Deportation in Konzentrationslager und vereinzelter Todesfälle hatte der Widerstand Bestand und Erfolg: Die Nationalsozialisten konnten die geplante Schulreform nicht durchsetzen und die Lehrer wurden freigelassen (vgl. zum gewaltfreien Widerstand in Norwegen: Skodvin 1971).
Bei dieser Methode der »Dynamischen Weiterarbeit ohne Kollaboration« – wie Theodor Ebert (1981) sie nannte – wird eine unrechtmäßige Herrschaft nicht anerkannt und ihre Gesetze und Verfügungen also nicht befolgt, gleichzeitig aber auch nicht der Dienst quittiert – der neue Machthaber wird also quasi »ignoriert«. Der Grund für den Erfolg ist simpel. Ein Besatzungsregime kann nur einen kleinen Teil an Beamt*innen austauschen, hauptsächlich sind sie auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Dies verschafft der besetzten Bevölkerung schon einen rein zahlenmäßigen Vorteil, sich über die befohlenen Maßnahmen entsprechend hinwegzusetzen.
Gewaltfreie Massenproteste und Zersetzung der Armee
Das zweite Beispiel stammt aus der Ukraine. Am 26. März 2022 marschierte die russische Armee in Slawutytsch ein, tötete drei Menschen und verhaftete den Bürgermeister (Daza 2022, S. 18). Die 25.000 Einwohner*innen demonstrierten daraufhin spontan auf dem zentralen Platz, sangen die Nationalhymne und forderten die Freilassung des Bürgermeisters. Trotz Drohgebärden der russische Soldat*innen blieb die Menge standhaft und gewaltfrei. Nach Verhandlungen wurde der Bürgermeister freigelassen und die russischen Truppen verließen den Ort nach nur zwei Tagen. Hier spielt insbesondere die Mentalität der russischen Soldat*innen eine Rolle. Das gerade zu Beginn des Krieges in Russland verbreitete Narrativ, demnach die Russ*innen als Befreier*innen in die Ukraine einmarschierten, wurde massiv in Zweifel gezogen und bereitete die Basis für Verhandlungen.
Widerstand als gemeinschaftliches Handeln
Beide Beispiele beruhen auf Zusammenhalt und Kooperation unter der Zivilbevölkerung. Dies bildet die Grundlage von Sozialer Verteidigung und kann im Vorhinein eingeübt werden. Hierbei helfen Nachbarschaftsnetzwerke als dezentrale und autonome Handlungseinheiten (vgl. dazu Barleben in diesem Dossier, S. 11). Darüber hinaus können Methoden der Selbstvergewisserung dieses Gemeinschaftsgefühl stärken. Hierzu bieten sich neben großen Demonstrationen auch kleine Symbole an. So trugen die norwegischen Lehrer Büroklammern am Sakko, in Thailand ist seit einigen Jahren die gelbe Gummiente zum Protestsymbol geworden und in Russland werden grüne Bänder als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg in der Öffentlichkeit angebracht. So signalisieren die Protestierenden sich gegenseitig, dass sie nicht allein sind und stärken ihr Durchhaltevermögen.
Auch können solche Symbole die Macht der Aggressoren unterwandern, denn die Verfolgung und Entfernung ist mühsam und langwierig, gleichzeitig wird die Ahndung solcher Aktionen im In- und Ausland zumeist als unverhältnismäßig wahrgenommen, was das Regime in der öffentlichen Anerkennung schwächt.
Widerstandsformen den Zielen anpassen
Neben diesen symbolischen Aktionen geht es grundsätzlich darum, zu verhindern, dass die Kriegsziele der Aggressoren erreicht werden. Diese zu analysieren kann dabei helfen, geeignete Methoden der Verteidigung zu finden. Allerdings ist es häufig schwierig, die wahren Ziele zu identifizieren und von vorgeschobenen, publikgemachten Zielen zu unterscheiden. Auch werden sich die Kriegsziele im Laufe des Konflikts verändern.
Dennoch lassen sich wesentliche Hinweise geben: Geht es um Machtausdehnung, Einverleibung von Arbeitskraft oder Ressourcengewinnung eignen sich Methoden des Boykotts oder der »dynamischen Weiterarbeit ohne Kollaboration«, denn solange die Bevölkerung des angegriffenen Landes zur Erreichung der Kriegsziele notwendig ist, hat sie auch Macht.4 Ein weiteres bekanntes Mittel des gewaltfreien Widerstandes sind Streiks bis hin zum Generalstreik. Als erfolgreichstes Beispiel wird hier zumeist die Niederschlagung des Kapp-Putsches erwähnt, erfolgreich durch einen viertägigen Generalstreik und die Verweigerung der legitimen Regierung, einen Kompromissvorschlag der Putschisten anzuerkennen (Boserup und Mack 1983, S. 101ff.). Allerdings ist – vor allem bei einem Generalstreik, aber auch bei Streiks in relevanten Versorgungsbereichen – ein immenser Schaden für die Bevölkerung zu erwarten, weswegen diese nur als kurzfristiges, deutliches Zeichen eingesetzt werden sollten. Dabei sind sie deutlich besser gegen Putschversuche im Inneren als gegen Angriffe von außen geeignet, da Armeen ihre eigene Versorgung für gewöhnlich mitführen und somit von einem Streik weniger oder zumindest später betroffen wären, als die eigene Bevölkerung.
Dies spricht auf einen längeren Zeitraum gesehen deutlich für die Weiterarbeit ohne Kollaboration zumindest in den für die alltägliche Versorgung wichtigen Bereichen. In anderen wären auch vereinzelte Streiks oder eine bewusste Verlangsamung der Arbeit bis zur völligen Ineffizienz als Methoden des gewaltfreien Widerstandes über einen längeren Zeitraum denkbar. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich langsames Arbeiten nur schwer durch Repressionen bekämpfen lässt, wodurch es die Autorität der Machthabenden zusätzlich diskreditiert.
Eine weitere Möglichkeit wäre Sabotage. Es ist sehr umstritten inwiefern die Beschädigung oder auch Zerstörung von Gebäuden, Infrastruktur oder anderen Gegenständen als Teil eines gewaltfreien Widerstandes betrachtet werden sollte und inwiefern es diesem nützt. Andreas Malm (2022) stellt in seinem Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft sprengt« sogar die These auf, dass jeder erfolgreiche, gewaltfreie Protest von einem radikalen, gewaltsamen Zweig profitiert hätte, da sich die Regierungen infolgedessen gezwungen sähen, mit der gewaltfreien Seite in Verhandlungen zu treten, um eine Eskalation zu verhindern. Diese These, die sich nicht auf SV im engen Sinne bezieht, wird durchaus kritisch diskutiert. Lammers und Schweitzer z.B. warnen in Anlehnung an die Begrifflichkeit von Brian Martin vor einem »Backfire«-Effekt, wenn Gewalt durch die Verteidiger*innen von den Angreifer*innen als Legitimation für Gewaltanwendung genutzt wird (Lammers und Schweitzer 2023).
Bei allen genannten Methoden ist darauf hinzuweisen, dass sie grundsätzlich für alle möglichen Forderungen eingesetzt werden können und natürlich – genau wie gewaltsame Verteidigung – keinen hundertprozentigen Schutz vor Gewalt bieten.
Dabei rufen die erwähnten Methoden unterschiedlich Gefahrenpotentiale auf. So ist die Gefahr bei der Weiterarbeit ohne Kollaboration, dass bei sehr öffentlichem Widerstand eine zu kleine Gruppe an »Weiterarbeitenden« durch das militärische Regime ausgelöscht werden kann – und so viele Tote kaum Widerstandserfolg gegenüberstehen. Je kleiner also die Gruppe der an einer Stelle Widerstand leistenden Menschen ist, umso größer muss die Unterstützung öffentlich sein oder das widerständige Tun klandestiner oder weniger auffällig (bspw. durch extrem langsames Arbeiten).
Erfolgreicher gewaltfreier Widerstand wie in der Ukraine kann zu Frustration bei den Aggressoren führen und Gewalteskalationen, wie z.B. in Butscha, hervorbringen. Auch deshalb ist die direkte Ansprache von Soldat*innen eine wichtige Methode, die aufgrund ihres hohen Anspruchs dringend vorher eingeübt werden muss.
Um die Effektivität von SV zu steigern und ihre Einsatzkriterien auszuhandeln, bedarf es einer organisierten Vorbereitung. Diese bietet sich in doppelter Hinsicht an: Zum einen stärkt der Aufbau einer funktionierenden Sozialen Verteidigung die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, zum anderen haben eine Vielzahl der Investitionen zugleich einen direkten gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen. Dafür braucht es sowohl weitere Forschung als auch praktische Umsetzungsinitiativen. Die praktische Arbeit erfolgt bei Wehrhaft ohne Waffen momentan in Modellregionen und Regionalgruppen, die durch lokale Ansätze ausprobieren, wie SV organisiert und vorbereitet werden kann.
Anmerkungen
1) Zur Theorie und Geschichte des zivilen Ungehorsams vgl. z.B. Braune 2023.
2) Dabei ist Gandhis Aufforderung an die Juden, sich gewaltfrei gegen die Nazis zu verteidigen, keinesfalls unproblematisch, was sich schon in der Buber-Gandhi-Kontroverse zeigte.
3) Für eine kritische Diskussion der dieser Forschung zugrundeliegenden Datensätze und einer Erweiterung um neuere Datensätze, siehe Nennstiel 2024.
4) Schwierig wird es, wenn dies nicht mehr zutrifft. Es ist fraglich inwiefern SV in einem Vernichtungskrieg oder im Falle eines Genozides von außen wirksam sein kann. Dies gilt nicht für innerstaatliche Vernichtung einzelner Bevölkerungsgruppen, hier ist öffentlicher Protest, Schutzbegleitung, Manipulation und aktives Verstecken höchst wirkungsvoll.
Literaturverzeichnis
Arnold, M. (2011): Gütekraft: Ein Wirkungsmodell aktiver Gewaltfreiheit nach Hildegard Goss-Mayr, Mohandas K. Gandhi und Bart de Ligt. Baden-Baden: Nomos.
Boserup, A.; Mack, A. (1983): Krieg ohne Waffen: Studie über Möglichkeiten u. Erfolge sozialer Verteidigung ; Kapp-Putsch 1920/ Ruhrkampf 1923/ Algerien 1961/ ČSSR 1968. Hamburg: Rowohlt.
Braune, A. (Hrsg.) (2023): Ziviler Ungehorsam: Texte von Thoreau bis Extinction Rebellion. Durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Ditzingen: Reclam.
Chenoweth, E.; Stephan, M.J. (2011): Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press.
Daza, F. (2022): Ukrainian Nonviolent Civil Resistance in the face of war: Analysis of trends, impacts and challenges of nonviolent action in Ukraine between February and June 2022. Barcelona: ICIP & Novact.
Ebert, Th. (1981): Dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration. Graswurzel Revolution 56/1981, S. 28-30.
Ebert, Th. (1991): Die Entwicklung des Konzepts der Sozialen Verteidigung in Deutschland. In: Ebd. (Hrsg.): Soziale Verteidigung: konstruktive Konfliktaustragung; Kritik und Gegenkritik. Militärpolitik-Dokumentation 80/81. Frankfurt a.M.: Haag und Herchen, S. 3-30.
Lammers, Ch.; Schweitzer, Ch. (2023): Soziale Verteidigung. Fortentwicklung des Konzepts als originärer Beitrag der Friedensforschung. In: W&F 2023/1, Dossier »Quo vadis, Friedensforschung?«, S. 13-16.
Malm, A. (2022): Wie man eine Pipeline in die Luft jagt: Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen. Berlin: Matthes & Seitz.
Nennstiel, J. (2024): Jenseits von NAVCO. Neue Datensätze zu zivilem Widerstand. W&F 3/2024, S. 12-15.
Sharp, G. (1971): Die Technik der gewaltlosen Aktion. In: Ebd.: Gewaltloser Widerstand gegen Aggressoren. Probleme, Beispiele, Strategien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 26-49,
Sharp, G. (2014): Von der Diktatur zur Demokratie: ein Leitfaden für die Befreiung. München: C.H.Beck.
Skodvin, M. (1971): Gewaltloser Widerstand in Norwegen während der deutschen Besetzung. In: Roberts, A. (Hrsg.): Gewaltloser Widerstand gegen Aggressoren. Probleme, Beispiele, Strategien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 87-107.
Marie-Christin Barleben ist evangelische Theologin, Pfarrerin und Friedensaktivistin.
Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«
Wir wollen Soziale Verteidigung voranbringen
von Jochen Neumann
Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« (WoW) (wehrhaftohnewaffen.de) wurde im Sommer 2022 von rund 30 Menschen gegründet, die das Konzept der Sozialen Verteidigung voranbringen und mit Leben füllen wollen. Anlass war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 und die von der Bundesregierung ausgerufene »Zeitenwende« sowie die damit verbundene massive Aufrüstung. Gleichzeitig bereiten uns antidemokratische, menschenverachtende Gruppierungen und Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien große Sorgen, die durch die aufgedeckten Putschvorbereitungen aus der Reichsbürger-Szene im Dezember 2022 noch bestärkt wurden.
Soziale Verteidigung verstehen wir entsprechend als ein Konzept für einen gewaltfreien Widerstand, der eine Gesellschaft wirksam gegen einen militärischen Überfall von außen, aber auch gegen einen gewaltsamen Staatsstreich von innen schützen soll.
Das Ziel der Kampagne lautet:
„Soziale Verteidigung ist in der Öffentlichkeit als wirksame Alternative in der sicherheitspolitischen Diskussion bekannt und in einer Vielzahl von (»Modell«‐) Regionen wird die Umsetzung Sozialer Verteidigung vorbereitet und eingeübt.“
Die Strategie der Kampagne beruht auf der Einschätzung, dass erstens ein erheblicher Teil der Menschen nicht überzeugt ist, dass die militärische Aufrüstung mehr Sicherheit und Frieden in Europa bringen wird, aber gleichzeitig keine Alternative dazu möglich zu sein scheint. Zweitens hat sich aber auch gezeigt, dass Soziale Verteidigung als bisher nur theoretisches Konzept nicht überzeugend für die Menschen ist. Die »WoW«-Kampagne setzt daher auf die Umsetzung Sozialer Verteidigung in der Praxis – in der eigenen Stadt, Kommune oder Region. In direkten Gesprächen mit den Menschen im eigenen lokalen Kontext wollen wir herausfinden: Was wollen die Menschen in unserer Gesellschaft verteidigen (und weiterentwickeln)? Wie geht das am besten, militärisch oder sozial? Was bedeutet das konkret für ihren Lebenszusammenhang?
Die Kampagne setzt daher auf regionale Gruppen und »Modellregionen« mit dem folgenden Ziel:
„Soziale Verteidigung wird als Handlungskonzept in der (Modell-)Region für den lokalen Kontext diskutiert, konkretisiert, eingeübt und in Form einer Selbstverpflichtung für den Verteidigungsfall von einer breiten Mehrheit der Menschen, die in der Modellregion leben oder arbeiten, unterstützt.“
Derzeit (Stand: Juli 2025) gibt es drei Modellregionen in Berlin-Moabit, am Oberrhein und im Wendland (vgl. dazu die entsprechenden Beiträge in diesem Dossier), sowie eine wachsende Zahl an Regionalgruppen und regionalen Ansprechpersonen in Augsburg, Essen, Freiburg, Hildesheim, Leine-Aller-Tal, Minden, Oberpfalz und Ulm (vgl. Karte 1).
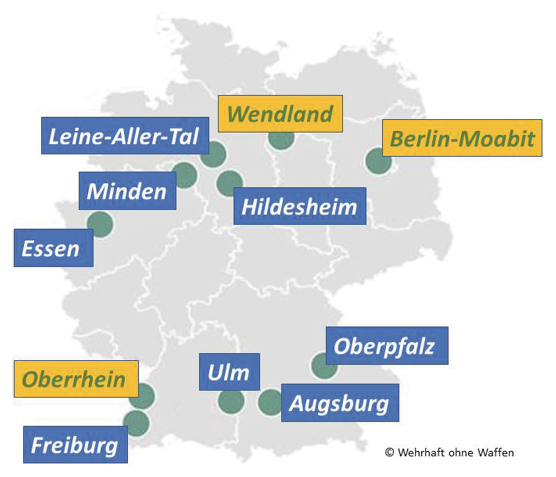
Karte 1: Übersicht der aktiven Regionalgruppen sowie Modellregionen für Soziale Verteidigung.
Der Fokus der Kampagne liegt bewusst zunächst auf Deutschland, weil wir in unser eigenen Gesellschaft Soziale Verteidigung voranbringen, aber nicht anderen diese »vorschreiben« wollen. Gleichzeitig gibt es bereits Aktive in den Niederlanden und die Kampagne und ihre Mitglieder sind international vernetzt und bereits grenzüberschreitend tätig – exemplarisch wird das insbesondere in den drei Modellregionen durch die Zusammenarbeit mit französischen Initiativen am Oberrhein und den internationalen Partnerschaften der REFO in Berlin-Moabit (Irak, Palästina und Kamerun) sowie die der KURVE Wustrow im Wendland (u.a. Sudan, Myanmar und Ukraine) deutlich.
Organisatorischer Aufbau der Kampagne
Die »WoW«-Kampagne ist offen für alle Menschen, die sich für Soziale Verteidigung engagieren wollen (vgl. Abb. 1). Der Initiativkreis der Kampagne1 ist so etwas wie die offizielle Versammlung der Mitglieder, die sich zweimal im Jahr treffen – einmal im Frühjahr online und einmal im Herbst in Präsenz. Hier werden strategische, inhaltliche, personelle und finanzielle Fragen gemeinsam beraten und entschieden sowie eine Steuerungsgruppe gewählt. Die Steuerungsgruppe entspricht in etwa einem Vereinsvorstand und trifft sich alle zwei Wochen digital, um zwischen den großen Treffen die Geschicke der Kampagne zu steuern sowie die hauptamtliche Kampagnenkoordination bei der Umsetzung der Beschlüsse und neu aufkommenden Fragen zu begleiten.
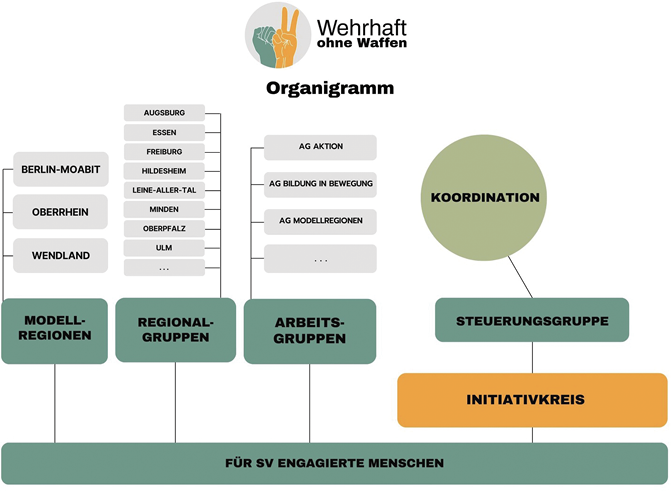
Abb. 1: Organigramm der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«
Neben den drei Modellregionen und der zunehmenden Zahl an Regionalgruppen haben und bilden sich immer wieder Arbeitsgruppen, die sich aus bundesweit Aktiven zusammensetzen und sich regelmäßig online treffen. Die relativ neu gegründete AG »Aktion« will beispielsweise gemeinsame, aber dezentrale Aktionsformen entwickeln und umsetzen. So können auch Menschen und Gruppen mit uns aktiv werden, an deren Orten sich noch keine Modellregion oder Regionalgruppe gebildet hat.
Neu Interessierte können sich bei der Kampagnenkoordination melden, um Unterstützung zu erhalten – zum Beispiel um einen Vortrag oder Workshop am eigenen Ort zu organisieren, um bei einer AG mitzumachen oder um das Starter-Paket zu erhalten, das viele Hintergrundinformationen und praktische Tipps für den Aufbau einer lokalen Gruppen bereithält.
Reflexion über Risiken und Nebenwirkungen
Im Sinne des »Do No Harm-Ansatzes« (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 2022) achten wir bereits in der Planung von Aktivitäten auf mögliche Risiken bzw. unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Wir haben dabei u.a. das Folgende erkannt und reflektiert wie wir darauf präventiv reagieren können:
- (Re-)Produktion von Feinbildern:
Durch das Thematisieren von Bedrohungen könnten wir unbeabsichtigt Feindbilder (z.B. des »bösen Russen«) verstärken. Hier achten wir darauf, dass wir ein differenziertes Bild vermitteln und Verallgemeinerungen vermeiden (z.B. explizit Beispiele für Protest und zivilen Widerstand in der russischen Gesellschaft einbringen). Ferner fokussieren wir nicht nur auf wahrgenommene Bedrohungen, sondern vor allem auch auf die Potentiale sozial-ökologischer Transformationsprozesse in unserer Gesellschaft.
- Konflikte mit Akteuren, deren Interesse es ist, militärische Strukturen, militaristische Denkweisen und ökonomischen Profit zu erhalten:
Durch die Entwicklung und Umsetzung einer Alternative zur militärischen Verteidigung werden Konflikte mit Akteuren entstehen, deren Interessen es ist, militärische Strukturen, militaristische Denkweisen und ökonomischen Profit zu erhalten. Hier müssen wir bei fortschreitendem Erfolg unserer Kampagne mit starkem Gegenwind durch deren Lobbyarbeit, aber auch mit Desinformation rechnen.
- Integration in militärische Verteidigungsstrategie:
Durch das Vorbereiten und Einüben Sozialer Verteidigung könnten wir den Boden bereiten für eine Integration des Ansatzes in die militärische Verteidigungsstrategie.2 Hier betonen wir, dass wir eine Kombination mit militärischer Verteidigung im selben Gebiet ablehnen und uns nicht für eine staatliche Verteidigungsstrategie vereinnahmen lassen, da die Wirkung Sozialer Verteidigung geschwächt und die Menschen, die gewaltfreien Widerstand leisten, gefährdet würden. Wir wissen gleichzeitig um die abgrenzende Wirkung der Betonung eines gewaltfreien Ansatzes. Hier gehen wir insbesondere in der Bildungsarbeit am Beispiel der Sabotage in die Diskussion über legitime Gewalt und strategische Gewaltfreiheit.
- Stärkung von Separatismus / regionalem Nationalismus:
Durch den lokalen Ansatz der Kampagne könnten wir unbeabsichtigt regionalen Separatismus bis hin zu »regionalem Nationalismus« befördern, wenn sich die Idee der Sozialen Verteidigung im lokalen Kontext durchsetzt, aber nicht gesamtgesellschaftlich. Hier wollen wir mit einer Vielzahl an Modellregionen entgegenwirken, die bundesweit und in unterschiedlichen Kontexten (wie Stadt-Land, Süd-Nord, Ost-West und grenzüberschreitend) die Menschen von Sozialer Verteidigung überzeugen.
- Stärkung von wenig inklusiven Institutionen:
Durch einen starken Fokus auf etablierte, wenig inklusive Institutionen könnten wir unbeabsichtigt deren gesellschaftliche Position und exklusive Zusammensetzung verstärken. Hier wollen wir durch den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung auch eine Auseinandersetzung mit Ausgrenzung und Diskriminierung in diesen Institutionen anstoßen.
Im Bewusstsein dieser möglichen Risiken und unbeabsichtiger Nebenwirkungen setzen wir uns tatkräftig dafür ein, Soziale Verteidigung mit Leben zu füllen und bekannter zu machen.
Anmerkungen
1) Wer im Initiativkreis mitwirken und mitentscheiden will, muss sich zum Sachkonsens der »WoW«-Kampagne bekennen.
2) Das sogenannte «Resistance Operating Concept« der NATO (Fiala 2020) setzt bereits auf die Einbeziehung des Widerstands der Zivilgesellschaft und Wirtschaft im Falle einer Überlegenheit des angreifenden Militärs.
Literatur
Fiala, O. (2020): Resistance Operating Concept (ROC). Joint Special Operations University (u.S.), MacDill Air Force Base, Florida.
Friedrich-Ebert-Stiftung (2022): Thema im Fokus: Do No Harm – Ein Ansatz für die Projektarbeit in NPOs. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
Jochen Neumann war von 2004 bis Mitte 2025 Geschäftsführer der KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. Er hat die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« mitgegründet und hat neben der Koordination der Modellregion Wendland seit Juli 2025 auch die Koordination der bundesweiten Kampagne übernommen.
Die Modellregion Oberrhein
Eine Chronik und Reflexion für 2023-2025
von Stephan Brües
Als im Juni 2022 die Kampagne für Soziale Verteidigung – das heutige »Wehrhaft ohne Waffen« – in Essen gegründet wurde, war Stefan Walther vom Verein Friedenswege e.V. / Chemins de Paix dabei (siehe Kasten nebenan). Der Ansatz der Kampagne, Soziale Verteidigung (SV) in Regionen mit Leben zu füllen, begeisterte ihn.
Stefan Walther stellte daraufhin einen Antrag an die Steuerungsgruppe der bundesweiten Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«, dass sein Verein eine »Modellregion Oberrhein« organisieren wolle (vgl. Karte 1 für den Überblick über die Modellregion). Nach der Zustimmung zum Begehr stellte diese Modellregion mich ab dem 1. Januar 2023 für 10 Stunden pro Woche an, auch wenn ich nicht in der Region Oberrhein, sondern in der Nähe von Heidelberg wohne. Nun galt es also, die Idee einer Modellregion für die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« (WoW) mit Leben zu füllen.

Karte 1: Die grenzübergreifende Modellregion Oberrhein
Kick-Offs an drei Orten
Das begann mit einem ersten Treffen am 24. Februar 2023, als 20 Personen aus Initiativen im Elsass, Freiburg, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe zusammenkamen, die Ziele der bundesweiten Kampagne und der zu etablierenden Modellregion Oberrhein besprachen und erste Ideen aus den anwesenden Orten austauschten.
Für das erste Jahr wurden die folgenden Ziele von WoW am Oberrhein beschlossen:
- Einen funktionsfähigen Initiativ- bzw. Koordinationskreis Oberrhein-Region aufzubauen, der kommunale Basisgruppen und Austauschprozesse koordiniert.
- Die Organisation von 10 internen Veranstaltungen zur Sozialen Verteidigung, d.h. den Zielgruppen SV niederschwellig nahezubringen und um deren Unterstützung zu werben.
- Die Organisation von 10 öffentlichen Veranstaltungen (5 in Offenburg, 5 an anderen Orten). Dies konnten Vorträge, Filmabende, Lesungen oder auch Beiträge auf Kundgebungen sein.
- Mindestens fünf Medienberichte über SV in der Region zu platzieren.
Die von der Modellregion ausgemachten Zielgruppen waren zunächst einmal Jugend- und Umweltgruppen, Gewerkschaften und Kirchengemeinden. Damit sollten drei wichtige zivilgesellschaftliche Gruppen angesprochen werden, von denen die notwendige Offenheit für die Thematik erwartet wurde. Die Jugend war jene Gruppe, die an dem ersten Treffen nicht präsent war. All diese sollten über einen niedrigschwelligen Einführungsworkshop zu Sozialer Verteidigung angesprochen werden. Er basierte auf den Fragen „Was wollt Ihr verteidigen? – Was bedroht das Verteidigungswerte?“ und sollte anhand von Inputs zu Prinzipien und Methoden der SV erstens gewaltfreie Wege aufzeigen und zweitens Handlungskonzepte in Bezug auf jene Bedrohungen, die die jeweilige Gruppe für besonders dringlich hält, entwickeln helfen.
Zugleich wurde das Ziel der bewegungsübergreifenden Vernetzung benannt. Es wurde beschlossen, den Kontakt zu Initiativen der Energiewende und der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) aufzunehmen sowie vorhandene Kontakte mit Bildungswerken zu vertiefen (Evangelische Erwachsenenbildung EEB, Kathol. Bildungswerk, lokale Volkshochschulen).
An diesem Kick-Off-Treffen nahm eine Journalistin teil, die einen Artikel über den Abend mit einem werbenden Charakter veröffentlichte. Ein erster Erfolgsschritt auf dem Weg zur Modellregion.
Im Laufe des März fanden zwei weitere Treffen statt: eines im Elsass im Maison Jean Goss in Wimmenau, wo sich etwa 10 Aktive aus der Bewegung für eine gewaltfreie Alternative (MAN), der Christ*innen gegen Folter (ACAT), der Ev. Kirche in Elsass-Lothringen (UEPAL), der Arche-Bewegung und Le Soc (Pflugschar-Bewegung aus dem Umfeld des französischen Versöhnungsbunds) trafen. Sie planten auf diesem Treffen einen »Train-the-Trainer«-Workshop in Strasbourg mit Tobias Pastoors, bei dem mit dessen Einführungsworkshop zu Sozialer Verteidigung gearbeitet werden sollte: Neben mir und Stefan Walther nahmen elsässische Mitglieder von MAN, UEPAL und dem Campus Centre Monod teil.
Zugleich wurde von den elsässischen Aktiven der MAN eine Vortragsveranstaltung auf der Biofachmesse in Colmar organisiert. Auf dieser Messe wurde eine Offenheit für die Thematik der Sozialen Verteidigung erwartet – und nicht enttäuscht: Immerhin 35 Menschen kamen, um etwas über Soziale Verteidigung, u.a. am Beispiel des Ruhrkampfes, zu hören. Ich habe dabei einen von mehreren Inputs gegeben – und u.a. auf die Modellregion Oberrhein, den Workshop und die Unterstützungserklärung für SV hingewiesen.
Seither hat es leider keine solche deutsch-französischen Veranstaltungen mehr gegeben – abgesehen von den deutsch-französischen Friedensmärschen in Kehl und Strasbourg 2024 und 2025. Letzterer war uns wichtig, da er die deutsch-französische Aussöhnung symbolisierte, die ja der visionäre Ausgangspunkt und die Besonderheit der Modellregion Oberrhein ist.
Etablierung und Herausforderungen
Beim zweiten Vernetzungstreffen Ende März 2023 in Freiburg waren ein Dutzend Personen anwesend. Das Treffen diente einem Austausch Freiburger Gruppen (Friedensinstitut, Pax Christi Freiburg, Peace4 Future Freiburg, die Initiative Friedensstadt Freiburg und das Freiburger Friedensforum) mit Offenburger und Elsässer Gruppen.1
Viele kleine Schritte hin zu einer größeren Sichtbarkeit wurden im Nachklang dieser Treffen unternommen: Ein erster Weg in die Offenburger Öffentlichkeit geschah mit einer Rede auf dem dortigen Ostermarsch. Auch die Informationsverbreitung wurde aktiver angegangen: Alle sechs bis acht Wochen erscheint ein Newsletter zur Modellregion und SV allgemein, der an ca. 75 Personen im gesamten Gebiet zwischen Elsass und Freiburg versandt wird.
Zudem fanden verschiedene Workshops in Baden-Baden, Offenburg, Zell am Harmersbach, Freiburg, Lörrach, Friedrichshafen und Achern statt. Die Modellregion wurde zunehmend in der gesamten Region verbreitet. Insgesamt wurden dabei etwa 150 Menschen erreicht.
Der Trägerverein der Modellregion »Oberrhein«
Friedenswege e.V./Chemins de Paix ist ein Netzwerk von Friedensorten. Sie liegen zwischen
- Karlsruhe (Arbeitsstelle Frieden der Badischen Landeskirche),
- Offenburg (Töne des Friedens, Liebfrauenhof, Synagoge Kippenheim, Friedenskreuz Bühl),
- Freiburg (Friedensinstitut der Ev. Pädagogischen Hochschule) und dem
- Elsass (Maison Jean Goss, Maison bzw. Museum Albert Schweitzer in Gunsbach bzw. Kaysersberg, ABC Climont, ein Projekt der evangelischen Kirche Elsass-Lothringen, Versöhnungskirche Strasbourg, MAN Elsass, Campus Centre Monod Colmar etc.)
Ziel des Vereins ist es laut ihrem Leitbild, „Projekte zu initiieren, die sich im Dreiländereck Frankreich-Deutschland-Schweiz (…) für Frieden und Gewaltfreiheit engagieren. Dem Beispiel der Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland folgend und im Sinne Albert Schweitzers soll die Ehrfurcht vor allem Leben im Blick behalten werden.“ So will der Verein ein Ort für Dialog und Bildung und das vielfältige Musizieren der »Töne des Friedens« sein, ein Ort des Erinnerns und Gedenkens, der Kunst und der Kreativität, der Andachten und Konzerte.
Eine Struktur für die gesamte Region?
Nach den ersten Kick-Off-Treffen ging es bei der Umsetzung unserer Ziele darum, einen funktionsfähigen »Koordinationskreis Oberrhein« aufzubauen, der kommunale Basisgruppen und Austauschprozesse koordinieren könnte. Die Idee dahinter war, dass an vielen Orten Basisgruppen entstehen, die an Themen arbeiten, die für sie besonders relevant sind. Das Konzeptmodell (siehe Abb. 1) umfasste sowohl ortsbezogene als auch thematische Gruppen. Die jeweiligen Gruppen sollten dann zum Austausch und für die Koordination der Modellregion Vertreter*innen in einen Koordinations-Kreis entsenden.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Koordinationskreises
Der Aufbau dieser Koordinationsstruktur begann im Mai 2023. Es sollten sowohl thematische Handlungsfelder identifiziert werden, an denen Aktive arbeiten wollen, als auch Menschen gefunden werden, die für Austauschprozesse und gegenseitiges Lernen in besagtem Koordinations-Kreis mitarbeiten würden.
Zu den Themen, die genannt wurden und zu denen ortsübergreifend in der Folge gearbeitet werden sollte, gehörten die Energieresilienz und der Aufbau und Schutz dezentraler Medien. Zudem sagten die meisten, dass der Schwerpunkt zunächst auf die Vernetzungsarbeit an der Basis gelegt werden sollte, bevor auf die kommunalen Institutionen zugegangen werden würde. Während sich die Kontakte zu Energiegenossenschaften und der SoLaWi nicht in konkreten Kooperationen niederschlugen, gab es eine AG »Schutz der Medien«, die einen ersten Entwurf für ein Seminar für das ver.di-Bildungsswerk Baden-Württemberg konzipierte. Es hätte noch mit Inhalten gefüllt werden sollen. Leider haben zwei der drei AG-Mitglieder nach einer inhaltlichen Kontroverse (s.u.) die AG verlassen und die Arbeit kam in der Folge zum Erliegen.
Letztlich konnte jedoch die Vernetzung der gesamten Region in einer zentralen Infrastruktur nicht realisiert werden. Aktive aus Karlsruhe und Freiburg stellten ihr Engagement aufgrund anderer inhaltlicher Prioritäten, aber auch wegen der räumlichen Entfernung, ein. Daraus ergab sich in der Folge eine Konzentration auf den Raum Offenburg-Kehl.
Handlungskonzepte oder Praxis?
Schon früh war die Idee entwickelt worden, aus den Bedrohungsszenarien Handlungskonzepte zu erstellen, die Anleitungen enthalten sollten, mit denen man im Bedarfsfall auf das entsprechende Szenario reagieren würde können.
Um zu einem solchen Konzept zu gelangen, schlug ich in der Rolle des Koordinators der Modellregion vor, zum einen die Prinzipien und Methoden der SV als Werkzeugkasten zu nutzen und zum anderen auch auf Aktionsplanungs-Tools und ein Akteursmapping zurückzugreifen. Über diesen Weg wollten die Aktiven jedoch nicht zum Ziel gelangen: Sie empfanden dieses strukturierte Vorgehen als theoretische Übung und nicht als eine Voraussetzung für effiziente praktische Aktivitäten. Sie wollten einfach direkt praktische Umsetzungen anpacken – z.B. den Deutsch-Französischen Friedensmarsch Kehl-Strasbourg planen und das »Fest des Schützenswerten« (s.u.).
Das Fest des Schützenswerten
Die Aktiven wollten SV praktisch machen, also organisierten wir ein Friedensfest im Sommer 2024. Wir nannten es »Fest des Schützenswerten«, bei dem zivilgesellschaftliche Initiativen eingeladen waren, um sich einerseits zu präsentieren, andererseits aber um sich gegenseitig kennenzulernen und für weitere Projekte zu vernetzen. Das Schützenswerte (Werte, Bedürfnisse, gesellschaftliche und politische Errungenschaften usw.) sollte gefeiert werden, zugleich überlegt werden, wie wir das Schützenswerte gegen Bedrohungen schützen können.
Wie sich das gestaltete: In einem Bürgerpark mit Sozial- und Familienzentrum und einem Musikpavillon kamen für einen Nachmittag und Abend etwa 150 bis 200 Menschen zusammen. Neben lokalen Friedensgruppen präsentierten der Fahrradverband ADFC, die Gewerkschaft ver.di, das »Offenburger Netzwerk für Nachhaltigkeit« (ONN) und die »Bildungswerkstatt zur Unterstützung der Bio-Musterregion Mittelbaden+« ihre Arbeit. Daneben war eine Märchenerzählerin vor Ort, es gab einen Vortrag des ehemaligen Offenburger Kulturamtsleiters zu einer Skulptur im Bürgerpark und zwei Baumbegehungen durch den BUND. Auch das gemeinsame Liedersingen und eine symbolische Ver»netz«ungsaktion mit einem Fadenknäuel, das die Essens- und Infostände miteinander verband, waren Teil des Programms. Und am Ende gab es auch Livemusik.
Die Besucher*innen konnten an einer Stellwand ihre Antworten auf drei Fragen notieren, die im Zentrum des Festes standen: Was finde ich schützenswert? Was bedroht das Schützenswerte? Was mache ich schon jetzt, um dieser Bedrohung zu begegnen?
Diese drei Fragen standen jedoch nicht nur am Tag des Festes selbst im Fokus. Bereits in der Vorbereitungszeit hatte der Leiter des Katholischen Bildungswerks die drei Fragen an die Mitstreiter*innen im ONN gestellt und einige interessante Antworten erhalten. In diesem Rahmen hatten sich so auch die Umweltgruppen und Bildungswerke, die am Fest teilnahmen, vorab und erstmalig mit diesen Fragen befasst. Das Bildungswerk zur Bio-Musterregion Mittelbaden+ ist mit einer Aktiven im Aktivenkreis engagiert und gibt Infos aus den Treffen in ihre Organisation weiter.
Auch auf dem Fest wurde der einführende Workshop zur SV angeboten. Er entwickelte sich an diesem Tag zu einem Gespräch von fünf Personen über den gewaltfreien Widerstand im Ukraine-Krieg und über die Frage des Bevölkerungsschutzes allgemein.
Der Versuch, über ein Fest die für SV zentrale Frage des »Schutzes von Werten« (vgl. Barleben in diesem Dossier, S. 3) niederschwellig zu transportieren und in der Gesellschaft zu platzieren, ist insgesamt gelungen. Symbolisiert wurde das nicht zuletzt dadurch, dass der aktivistische Kölner Liedermacher Gerd Schinkel vom Titel des Festes zu einem Lied inspiriert wurde. Auch die Zeitungen haben positive Berichte veröffentlicht. Doch die Tiefe der Verankerung von SV am Fest selbst und die daraus entstehenden Konsequenzen für die Region sind als eher gering einzustufen. Ähnliche Aktivitäten sollen daher in der Zukunft regelmäßig und eventuell dezentraler stattfinden, wie die Auswertung auf dem anschließenden Aktiventreffen ergab. Ein zweites solches Fest wird am 03. Oktober 2025 stattfinden, die Räume sind reserviert, die Vorbereitungen beginnen.
Kontroverse stärkt die Aktivengruppe
Einige Aktive, die im Zuge des Festes zu uns stießen, waren unsicher, ob ihre politischen Positionen zu WoW passen. In einem Positionsbarometer wurden daraufhin verschiedene Positionen zu aktuellen politischen Debatten (Atomwaffen, Rüstungsausgaben, Einschätzung zur SV und Ziviler Konfliktbearbeitung, Ukraine) so abgefragt, dass auch differenzierte Meinungen möglich waren. Zwei Personen haben diese Barometer nicht goutiert. Sie haben in der Folge die Gruppe verlassen, da aus ihrer Sicht zu viele (fast ein Drittel) der Anwesenden unter Umständen für Waffenlieferungen und mehr Rüstungsausgaben eintraten. Wie sollten diese Menschen – so fragten sie – in einer Gruppe agieren, die sich »Wehrhaft ohne Waffen« nennt?
Auf dem nächsten Treffen haben alle Aktiven jedoch betont, dass sie die Idee der Sozialen Verteidigung, die Verbreitung von »gewaltfreien Alternativen« und eine »konstruktive Friedensarbeit« weiterhin stärken und sich für Dialoge und konstruktive Kommunikation einsetzen wollen – unabhängig davon, wie sie persönlich beispielsweise zu Waffenlieferungen an die Ukraine stehen. Somit hat die verbliebene Gruppe gleichermaßen ihren Zusammenhalt und ihre thematische Fokussierung gestärkt. Die Furcht, dass jene Aktive, die für Waffenlieferungen an die Ukraine eintreten, die übrigen kompromittieren wollten, stellte sich als unbegründet heraus.
Abschließende Reflexion
Die Modellregion Oberrhein in ihrer ursprünglichen Form umfasst ein großes Gebiet. Es hat sich jedoch nicht als praktikabel erwiesen, die gesamte Modellregion in eine Koordination einzubeziehen. So liegt der Kern der Modellregion mittlerweile in der Umgebung von Offenburg und Kehl. Zu den anderen Orten besteht weiterhin ein regelmäßiger Informationsaustausch (z.B. über den Newsletter), aber keine aktive Mitarbeit.
Auch die grenzüberschreitende Arbeit, die ein wichtiger Anknüpfungs- und Motivationspunkt war, erwies sich langfristig als schwierig zu realisieren: Die Aktiven im Elsass waren nach den Auftaktveranstaltungen im Frühjahr 2023 zwischenzeitlich nicht gut zu erreichen. Ein Grund dafür kann sein, dass einige Aktive in eher abgelegenen Orten im Elsass wirken, sodass ein gegenseitiger Besuch von Veranstaltungen schwierig ist. Ausnahmen sind der Ostermarsch Kehl-Strasbourg und die jährlichen Präsenztreffen von Friedenswege e.V. Insgesamt sind deren Mitglieder damit aber keine wirklich aktive Basis für die Aktivitäten von WoW am Oberrhein.
Ungünstig wirkt sich zudem aus, dass ich als Koordinator nicht in der Region wohne und persönlich dort nicht vernetzt bin. Ich komme stets von außen, kann nicht mal spontan zu Menschen oder Gruppen in der Region fahren, um etwas zu besprechen usw. Dies mindert die Intensität der Arbeit an der Modellregion, da sie mit größerem Aufwand verbunden ist.
Während die angestrebten Handlungskonzepte, z.B. zur Energieresilienz oder zum Schutz der Medien, bisher nicht realisiert werden konnten, hat das »Fest des Schützenswerten« im Juni 2024 die Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Gruppen ebenso vorangebracht wie auch einen ersten inhaltlichen Einstieg in Soziale Verteidigung ermöglicht.
Anhand der erwähnten Kontroverse um das Positionsbarometer konnten wir erkennen, dass es unter den Aktiven Menschen gibt, die zwar persönlich keine Alternative zu Waffenlieferungen an die Ukraine oder Ausgaben für die Bundeswehr sehen, aber den Friedensgedanken und die Idee der Wirksamkeit von Sozialer Verteidigung hochhalten und an dieser Vision mitarbeiten möchten. Sie sind sicher nicht die einzigen. Für sie müssen wir offen sein, sollte eine flächendeckende und umfassende Verankerung von SV in der Gesellschaft möglich werden.
Ein Ansatzpunkt für die zukünftige Arbeit sollte der Bevölkerungsschutz sein. Der Widerspruch zwischen den Mitteln der militärischen Verteidigung und dem Schutz der Bevölkerung ist besonders gut nachvollziehbar. Angeregt durch die Informationen aus der bundesweiten Kampagne und durch die ermutigenden Berichte aus der Regionalgruppe Essen (siehe Arnold in diesem Dossier, S. 20) beginnt sich auch in der Modellregion Oberrhein etwas in dieser Hinsicht zu regen. Hoffentlich können wir einige Erfahrungen in die geplante internationale Konferenz zur Sozialen Verteidigung in Strasbourg einbringen, die die Bewegung für eine gewaltfreie Alternative (MAN) mit anderen im November 2026 organisieren will.
Aller Anfang ist schwer, zumal es ja keine Blaupause für unsere Vorhaben gibt. Wir lernen im Tun und der Reflexion.
Anmerkung
1) In der Folge haben sich die Freiburger Aktiven mit ihrer Initiative »Friedensstadt Freiburg« aus der Modellregion »WoW am Oberrhein« zurückgezogen, wobei weiterhin ein enger Informationsaustausch besteht und gegenseitig für Veranstaltungen geworben wird. Zudem habe ich später einen Workshop in einer Freiburger Kirchengemeinde gegeben und war bei einer wichtigen ersten öffentlichen Aktion des Bündnisses »Friedensstadt Freiburg« präsent.
Stephan Brües ist Koordinator von WoW am Oberrhein, Mitglied der Steuerungsgruppe der bundesweiten Kampagne und Ko-Vorsitzender des Bund für Soziale Veteidigung. Die hier vertretene Analyse und Meinung ist seine persönliche – und nicht die des Vereins Friedenswege e.V..
„Wenn in Berlin die Lichter ausgehen, gehen sie bei uns an“
Die Reformationskirche Berlin-Moabit als Leuchtturmprojekt
von Marie-Christin Barleben
Seit Ende 2022 versuchen wir in der Modellregion Berlin-Moabit am Standort der REFO Moabit e.V., Soziale Verteidigung (SV) zu erlernen und vorzubereiten. Die REFO Moabit ist ein Konvent am, um und in der Reformationskirche in Berlin-Moabit in dem 40-60 Menschen »Kirche im Kiez« leben.1 Mit spirituellen, sozialen und politischen Projekten und Angeboten wirken wir in den Kiez hinein und versuchen, Impulse von außen aufzunehmen. Mitten in der Hauptstadt gelegen ist die REFO ein hervorragender Ort, um SV in Großstädten einzuüben. Dazu haben wir einen Ansatz entwickelt, der ein umfassendes Verständnis von Sicherheit voraussetzt und als Antwort darauf Resilienz in verschiedenen Bereichen einsetzen möchte.
Nachdem wir zunächst versucht haben, SV als eigenständiges Konzept bekannt zu machen und durch theoretische und praktische Workshops eine aktive Gruppe aufzubauen, wurde uns nach und nach klar, dass wir unseren Ansatz breiter denken müssen, wenn wir in unserer »Bubble« Anknüpfungspunkte schaffen wollen. Es wurde uns auch bewusst, dass SV nicht nur Vorbereitung im Sinne von Haltung und Methoden bräuchte, sondern auch einen physischen Ort. Um sich verteidigen zu können, braucht es einen Schutzort und Treffpunkt, es braucht Wasser, Strom, Wärme, Kommunikationsmittel. Wir erkannten: SV ist nicht nur ein abstraktes Netzwerk, sondern lokal verortet. So begannen wir nachzudenken, wie eine solche Vorbereitung aussehen könnte und kamen schließlich zu einem neuen Namen für unser Projekt: »ResilienzZentrum Moabit«. Hochgegriffen, irritierend durch das großgeschriebene Z und deutlich weiter als »nur« SV.
Doch was bedeutet Resilienz? Als »resilient« wurden ursprünglich in der Physik Stoffe bezeichnet, die auch nach extremer Dehnung wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehrten. In der Psychologie und Soziologie werden Personen als resilient bezeichnet, die auch nach schweren, potentiell traumatischen Erlebnissen in der Lage sind, ihr Leben ohne dauerhafte Beeinträchtigungen fortzusetzen. In den letzten Jahren ist eine Ausdehnung der Anwendung des Begriffes sowohl auf Gesellschaften als auch auf Infrastruktur zu beobachten. In Bezug auf den Klimawandel geht es unter dem Mantel der Resilienz beispielsweise um die Anpassung an Risiken und Folgen globaler Erwärmung, eine resiliente digitale Infrastruktur hingegen ist gewappnet gegen Hackerangriffe und deren Folgen. Hier zeigt sich die enge Verbindung von Resilienz und Katastrophenschutzplänen, wie es auch in der Resilienzstrategie der Bundesregierung Niederschlag fand. Dabei hat sich eine Bedeutungsverschiebung ergeben. Resilienz meint weniger eine Rückkehr in den Ursprungszustand, sondern eine Form von Stressresistenz, die es ermöglicht mit Ausnahmesituationen umgehen zu können und Katastrophen zu überleben. In dieser Verwendung taucht der Begriff dann auch in Kombination mit »Demokratie« auf.
In Zeiten des zunehmenden Rechtspopulismus und -extremismus in Politik und Gesellschaft ist die Förderung einer »resilienten Demokratie«, die sich also gegen extremistische Tendenzen als resistent und wehrhaft erweist, unabdingbar (vgl. auch Neumann in diesem Dossier, S. 19).
SV kann zwar auch spontan erfolgreich angewendet werden, der präventive Aufbau bietet sich aber in doppelter Hinsicht an (vgl. Barleben in diesem Dossier, S. 3). Zum einen stärkt der Aufbau einer funktionierenden SV die Verteidigungsfähigkeit, zum anderen haben eine Vielzahl der für SV zu erbringenden Investitionen zugleich einen direkten gesellschaftlichen oder auch ökologischen Nutzen.
Das »ResilienzZentrum Moabit« beinhaltet dabei drei Bereiche: resiliente Demokratie, resiliente Infrastruktur und resiliente Beziehungen. Darin ist SV ein Teilbereich der resilienten Demokratie, die sich ebenfalls um gewaltfreie Konfliktlösung und Zivilen Widerstand bemüht. Soziale Verteidigung ist dann die Handlungsoption der resilienten Demokratie im Angriffsfall. Resiliente Infrastruktur und resiliente Beziehungen bilden die Unterstützungsstrukturen.
Resiliente Beziehungen
Der Aufbau von SV braucht Vorbilder und Unterstützer*innen. Hierbei können internationale Beziehungen helfen. Dabei können Veranstaltungen mit Friedensorganisationen und NGOs neue Verbündete anziehen und als Beispiele ausgewertet werden. Wir konnten in der REFO gute Erfolge mit internationalen Gruppen wie z.B. »Combatants for Peace« oder »Tent of Nations« erzielen. Aber auch mit Zeitzeug*innenberichten über die Friedliche Revolution in der DDR wie auch aus dem Nahen Osten. Historische Dokumentationen über das Ende der Herrschaft von Slobodan Milošević in Jugoslawien, Ferdinand Marcos auf den Philippinen oder Widerstand gegen den Nationalsozialismus haben sich ebenfalls als Ausgangspunkt für Diskussionen um die eigene Verantwortung und Möglichkeiten bewährt. Auf der anderen Seite sind internationale Beziehungen in Falle eines Angriffskrieges oder eines Putsches wichtig, damit eine innere SV auch von außen Unterstützung erfährt. Die Rolle von Drittstaaten ist unserer Auffassung nach in jedem Fall auch für SV relevant. Das mag zunächst verwirrend erscheinen, wenn sonst betont wird, dass SV eben keine Verteidigung nationaler Grenzen darstellt, sondern die darin gelebten Werte und Lebensweisen. Doch in einer Welt von Nationalstaaten meinen wir, dass auch SV mit den Eigenschaften dieses Systems umgehen sollte. Dies ist umso relevanter, als auch Institutionen, wie die UN oder das Völkerrecht, zwischen Staaten vereinbart sind. Das macht einen Umgang mit externen Staaten unumgänglich.
Resiliente Infrastruktur
Für die SV ist im Bereich der resilienten Infrastruktur vor allem eine dezentrale, autarke Versorgung relevant. Es ist für einen Aggressor bedeutend schwerer, die Stromversorgung zu übernehmen, wenn diese dezentral über unabhängige Einspeisegeräte und Verteilerpunkte organisiert wird, als über ein zentrales Kraftwerk. Hier bieten vor allem die erneuerbaren Energien eine großen Flexibilität. So sollte beim Ausbau von Solaranlagen in Städten darauf geachtet werden, dass die einzelnen Einspeiser im Notfall auch in der Lage sind, den Strom nicht ins allgemeine Stromnetz einzuspeisen, sondern als Direktversorger der angeschlossenen Verbrauchergeräte zu fungieren. So gedacht ist unser Ziel, dass in der REFO die Lichter angehen, wenn sie in Berlin ausgehen. Ähnliches gilt für Wärme- und Wasserversorgung. Der Umbau in diesem Bereich hilft somit auch im Falle von Naturkatastrophen und ist zugleich Teil einer notwendigen Transformation in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit.2
Die Bedeutung einer dezentralen, resilienten Infrastruktur ist in Berlin bereits innerhalb des Feuerwehr-Forschungsprojekts »Kat-Leuchttürme« von 2012-2015 ausführlich bearbeitet worden. Entsprechende Katastrophenschutz-Leuchttürme wurden seitdem in der ganzen Stadt eingerichtet. Diese sollen die Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung im Katastrophenfall sichern (vgl. Berliner Feuerwehr 2016). Perspektivisch möchten wir die REFO ebenfalls zu einem solchen »Leuchtturm« ertüchtigen und als nicht-staatlichen Anlaufpunkt etablieren, erste Gespräche mit dem Bezirk haben bereits stattgefunden.
Ein anderer Aspekt ist die Nahrungsversorgung. Während in den ländlichen Regionen zumeist noch eine Grundversorgung mittels umliegender landwirtschaftlicher Betriebe denkbar ist, ist das für eine Großstadt wie Berlin kaum umsetzbar. Selbst eine effiziente Nutzung möglicher Flächen durch sogenanntes Urban Gardening könnte die notwendigen Lebensmittel nicht bereitstellen. Trotzdem ist hier ein großes Potential für Gemeinschaftsprojekte gegeben, die zwar nicht zentral auf SV fokussieren, aber diese im Kontext von Umweltbildung und Gemeinschaftsförderung mitbedenken. Zudem ist das Begrünen »toter Flächen« in der Großstadt als Anpassungsstrategie an die Herausforderungen des Klimawandels ohnehin wichtig, um das Erhitzen der Stadt zu verlangsamen.
Wir konnten bereits erste Vernetzungserfolge mit dem Anbau von Gemüse auf unserem Balkon erzielen und planen daran anknüpfend in der Zukunft weitere Workshops zu Anbau und Zubereitung unseres eigenen Gemüses. Dabei streben wir längerfristig auch eine Kooperation mit der von uns betriebenen Kindertagesstätte an. Dadurch lässt sich Umweltbildung mit Gemeinschaftsaufbau und SV verknüpfen. Im Zuge solcher Projekte ist auch die Möglichkeit der Wasserrückgewinnung und -speicherung z.B. in Regentonnen oder Zisternen ein weiterer Schritt hin zu einer nachhaltigeren, resilienteren Stadt (vgl. Schwägerl 2024). Auch hier sind Nachbarschaftsprojekte denkbar, die sich der Wasserrückgewinnung und Stadtbegrünung widmen.
Der Bereich der resilienten Infrastruktur bietet sich somit neben der technischen Resilienz auch als Anknüpfungspunkt für Vernetzung (soziale Resilienz) in zweifacher Hinsicht an. Zum einen kann hierüber der Kontakt zum Bezirk oder auch zur Kommune sowie zu den Institutionen des Katastrophenschutzes (THW, Feuerwehr, DRK, etc.) aufgebaut werden, zum anderen ist der sofortige Nutzen im Bereich des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung gut erkennbar und kann somit eine Brücke in die Klimabewegungen hinein sein.
Wahlbeeinflussung, »Fake-News« und Hackerangriffe haben die Sensibilität für die Sicherheit bzw. Manipulierbarkeit digitaler Infrastruktur in den letzten Jahren erhöht – und auch sie ist Teil der hier veranschlagten Resilienzstrategie. Für SV ist Kommunikation zwischen den einzelnen Verteidiger*innen sowie mit Drittstaaten enorm wichtig, weshalb der Aufbau einer resilienten Kommunikationsstruktur absolut basal ist. Dabei ist es sinnvoll, auch systemische Redundanzen vorzuhalten (z.B. Telefon, Radio, Internet). Auch hier könnten Workshops oder ähnliches angeboten werden und neue Interessierte gewonnen werden. Aus Zeit-, Kapazitäts- und Interessensgründen haben wir uns in der REFO in diesem Bereich bisher nicht weiter ausprobiert.
Resiliente Demokratie
Eine wichtige Basis der SV ist ein starker zivilgesellschaftlicher Zusammenhalt. Um diesen zu befördern, braucht es (Nachbarschafts-)Netzwerke und starke zivilgesellschaftliche Institutionen, wie beispielsweise Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Kultur- oder Sportvereine. An mit diesen Institutionen verbundenen Orten versammeln sich Menschen, die sich über Aktivitäten oder Wertvorstellungen verbunden fühlen. Es gibt dort etablierte Kommunikationswege und man unterstützt sich zumeist gegenseitig. Dies ist im Verteidigungsfall besonders wichtig, da hier zum einen eine Selbstvergewisserung und Stärkung der Verteidiger*innen stattfindet und zum anderen gegenseitige Unterstützung organisiert werden kann, wenn Einzelne besonderen Repressalien ausgesetzt sind.
Darüber hinaus sind starke zivilgesellschaftliche Institutionen und Netzwerke auch eine Investition in eine resiliente Demokratie, denn in und durch diese Institutionen ergeben sich Möglichkeit zum Meinungsaustausch wie auch zur aktiven Beteiligung am demokratischen Diskurs. Des Weiteren sind soziale Anlaufstellen (Tafeln, Stadteilzentren, Arche, etc.) wichtige Protagonisten, um soziale Ungerechtigkeiten aktiv auszugleichen, und als Bildungseinrichtungen sind sie auch Orte des »demokratischen Lernens«. Die REFO versteht sich nicht nur als geistlicher Ort, sondern will auch Bildungs-, Kultur- und Kunstraum sein. Um sowohl die Konventsmitglieder als auch immer neue Akteure anzuziehen und zu vernetzen, setzen wir auf »Community-Building«.
Wir verbünden uns mit Nachbarschaftsinitiativen, planen gemeinsam Feste, sind Teil von Netzwerken – all diese Strukturen würden auch im Verteidigungsfall als Unterstützungsnetzwerk helfen. Da es sich bei diesen allerdings häufig um eher politisch linke Communitys handelt, haben wir in der REFO die Erfahrung gemacht, dass das Thema »Verteidigung« zunächst auf Ablehnung stößt. Der Resilienzansatz konnte uns helfen, hier besser ins Gespräch zu gehen, da er Ansatzpunkte jenseits problematisch aufgeladener Begriffe bietet. So konnten wir durchdringen zu Positionen, die ungefähr so lauteten: „Ja, ich will auch sehr viel verändern, aber ich will das demokratisch entscheiden und nicht diktatorisch aufgezwungen bekommen.“ Aus dieser Haltung heraus haben wir in der REFO z.B. eine Reihe zu »Konflikt- und Friedensfähigkeit« organisiert. Dort gab es über sieben Wochen hinweg einmal pro Woche einen Vortrag, der Facetten von Friedensethik und -theorie vorstellte. Durch das niederschwellige Angebot konnten viele Personen erste Einblicke gewinnen, zusätzlich wurde die Vernetzung gefördert. Solche niederschwelligen und kurzen Angebote bieten sich als Anknüpfungspunkte an. Zur Vertiefung organisieren wir zusätzlich immer wieder Tages- oder Wochenendworkshops. Besonders unser »Resonanzraum«, bei dem wir ein Wochenende zu einem Thema außerhalb Berlins im Kloster Heiligengrabe verbringen, bietet eine tolle Möglichkeit sowohl für inhaltlichen Austausch als auch für soziale Interaktion. Der Resonanzraum funktioniert so, dass jede*r einen Slot aus seiner*ihrer Perspektive gestaltet. Auf diese Weise kommen alle mit ihren Kompetenzen und Themen vor, Menschen lernen voneinander und erfahren Selbstwirksamkeit. In Tagesworkshops haben wir uns bereits mit Diversität auseinandergesetzt und planen, Argumentationsworkshops anzubieten. Auch Workshops zur Gewaltprävention, Diskriminierungssensibilität oder Machtmissbrauch sind denkbar.
Auch praktisch ausgerichtete Workshops zu Widerstandsmethoden oder gemeinsame Demo-Besuche oder auch die Organisation von eigenen Demonstrationen stärken den Zusammenhalt, die Demokratie und helfen dabei, Fähigkeiten zu erlangen, die auch für SV relevant sind. Somit lassen sich eine linke progressive Protest- und Demokratiekultur und der Aufbau von SV verbinden.
Eine besondere Stellung kommt in einer resilienzorientierten SV außerdem dem Bereich der Kunst und Kreativität in einem weiten Sinne zu. Musik, bildende Kunst, Theater und Performances können sowohl gemeinschaftsstärkend als auch autoritätsunterwandernd genutzt werden. Nicht ohne Grund wird in Diktaturen häufig versucht, die Kunstfreiheit einzuschränken und z.B. das öffentliche Abspielen von Musik zu untersagen, oder versucht, die Kunstszene durch staatskonforme Kunst zu kontrollieren. Das kollektive Archiv des Kunst- und Kulturbetriebs bietet schon jetzt einen riesigen Schatz an subversiven Methoden und Ideen. In der REFO konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Künstler Jens Reulecke bereits mehrere Ausstellungen durch entsprechende Veranstaltungsreihen begleiten.3 Durch den Bezug zu den Bildern und Installationen konnten in den Gesprächen neue Blickwinkel auf Frieden und Resilienz entstehen, auch verbunden mit einem emotional-ästhetischen Zugang.
Zusätzlich stärkt eigenes künstlerisches Arbeiten die Kreativität und Improvisationsfähigkeit, was im Ernstfall hilfreich bei der Lösungsfindung sein kann. Unter Improvisation verstehe ich dabei die typisch menschliche Fähigkeit, in unvorhersehbaren Situationen auf bekanntes Wissen und Fähigkeiten zuzugreifen und dieses dann situativ neu arrangiert anzuwenden.4 Die Idee der Alltagsimprovisation ist auch die Grundlage der Feuerwehr in Deutschland. Nach wie vor ist für die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr eine abgeschlossene Handwerksausbildung erforderlich. Die Idee dahinter ist, dass trotz allen Trainings jeder Einsatz individuell ist und neben den Fähigkeiten der Brandbekämpfung eine große Menge an weiteren Fähigkeiten und Ideen benötigen kann. Je mehr Personen ihr je individuelles Wissen zusammenbringen, um eine Lösung zu entwickeln, umso größer das Improvisationskapital. Dabei handelt es sich um keine naive, spontane »Bastelei«, sondern eine situationsgebundene, lösungsorientierte Wissensanwendung. Die Stärkung dieser Fähigkeiten ist somit in allen Bereichen ein Beitrag zum Resilienzaufbau. Dabei lässt sich der in den letzten Jahren beobachtbare DiY- und Upcylingtrend als Anknüpfungspunkt nutzen. Die REFO verfügt über eine gute ausgestattete Werkstatt, viel Platz und viele Menschen mit handwerklichen Fähigkeiten. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, in Zukunft verstärkt auch Workshops zu Holzbearbeitung o.ä. anzubieten, auch der Umbau der REFO hinzu einem nachhaltigen, energieautarken Gebäude ist viel mit Eigenleistung verbunden und ermöglicht so gemeinschaftliches Handwerken.
Neben diesen Projektideen aus dem weiteren Umfeld von resilienzorientierter Sozialer Verteidigung lassen sich auch noch Workshops zu konkreten Fähigkeiten durchführen. Zu nennen sind hier Argumentationstrainings gegen rassistische, extremistische und populistische Sprüche, wie auch Courage-Trainings und Konfliktdeeskalationsübungen. Darüber hinaus lassen sich einzelne Methoden des gewaltfreien Widerstands im Vorhinein üben.
In einem kirchlichen Kontext wie der REFO ist darüber hinaus der Bereich der Friedensspiritualität ein wichtiger Aspekt. So haben »Friedensgebete« eine lange Tradition vor allem im Osten Deutschlands und die jedes Jahr stattfindende »Ökumenische FriedensDekade« verbindet deutschlandweit Gemeinden. Doch der »Einsatz« für den Frieden sollte nicht einfach zur alljährlichen Routineübung werden, sondern muss sich selbst „als ein Auf-dem-Weg-Sein, als Einüben einer kritischen Haltung und nicht das passive Erleiden oder Erdulden militärstrategischer Maßnahmen“ verstehen (Schlögl-Flierl 2023, S. 14). Dann kann jede Praxis der Friedensspiritualität einem Abstumpfen gegenüber Kriegsberichten entgegenwirken und als kontrafaktische Hoffnungsbotschaft den Raum für einen Friedensprozess eröffnen (vgl. Ackermann u.a. 2023, S. 63f.). Die Bedeutung von Friedensgebeten für den größeren Rahmen des gewaltfreien Widerstands und der SV lässt sich unschwer an der »Friedlichen Revolution« in der DDR erkennen und sollte, wenn es um kirchliche Gemeinschaften geht, unbedingt beibehalten und ausgebaut werden. Wir haben in der REFO den November, in dem auch die FriedensDekade liegt, zum Friedensmonat erklärt und nutzen ihn für Veranstaltungen rund um das Thema Frieden und Soziale Verteidigung. Dadurch lassen sich das Kirchenjahr und unsere Arbeit verbinden und auch in der Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden fruchtbar machen.
Insgesamt hat sich für uns der Resilienzansatz als Möglichkeit bewährt, mit sehr verschiedenen Gruppen und Akteuren in Kontakt zu treten, Netzwerke zu schaffen und stückweise die Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, ohne von oben herab zu indoktrinieren. Dass der Aufbau einer resilienten Infrastruktur für die Verteidigung sinnvoll und notwendig ist, ist dabei auch in militärischen Kreisen anschlussfähig. Aus unserer Perspektive des »Community buildings« bietet sich somit eine Möglichkeit, zunächst den gemeinsamen Aufbau von Sicherheit und Resilienz in den Fokus zu rücken und darauf aufbauend das Thema der SV zu diskutieren.
Anmerkungen
1) Die REFO stellt sich und ihre Arbeit im Internet ausführlich selbst vor: refo-moabit.de.
2) Diese sehr direkte Verbindung von Sozialer Verteidigung und Ökologiebewegung ist dabei keine neue Erscheinung. DIE GRÜNEN forderten schon in ihrem Friedensmanifest schon 1981: „Militärische Rüstung abbauen – Soziale Verteidigung aufbauen“. Für weitere Informationen vgl. Ebert 1991, S. 20-24.
3) Für Bilder siehe die Homepage des Künstlers: jensreulecke.com/installation-exhibition.
4) Für ausführlichere Reflexionen über die verschiedenen Formen vom Improvisation vgl. Ravn, Hoffding und McGuirk 2021.
Literatur
Ackermann, D.; Anselm, R.; et al. (2023): Maß des Möglichen: Perspektiven evangelischer Friedensethik angesichts des Krieges in der Ukraine: ein Debattenbeitrag. 1. Auflage. Schriften der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr. Berlin, 2023.
Berliner Feuerwehr (2016): Kat-Leuchttürme. Katastrophenschutz-Leuchttürme als Anlaufstelle für die Bevölkerung in Krisensituationen. Teilvorhaben: Konzipierung und Demonstration von Katastrophenschutz-Leuchttürmen bei der Berliner Feuerwehr. Schlussbericht mit Broschüre, o.O.
Ebert, Th. (1991): Die Entwicklung des Konzepts der Sozialen Verteidigung in Deutschland. In: Ebd. (Hrsg.): Soziale Verteidigung: konstruktive Konfliktaustragung; Kritik und Gegenkritik. Militärpolitik-Dokumentation 80/81. Frankfurt a.M.: Haag und Herchen, S. 3-30.
Ravn, S.; Hoffding, S.; McGuirk, J. (Hrsg.) (2021): Philosophy of Improvisation. Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practice. New York: Routledge.
Schwägerl, Ch. (2024): Berlin entstand in einem Sumpf, nun droht es trockenzufallen – lässt sich die Wasserkrise abwenden? Auf dem Weg zur Schwammstadt? Wie Berlin sich auf Hitze und Wassernot vorbereitet. RiffReporter, 16.5.2024.
Schlögl-Flierl, K. (2023): Resilienz – normativ durchdacht, transformativ entwickelt. Ethik und Militär 1/2023, S. 8-15.
Marie-Christin Barleben ist evangelische Theologin, Pfarrerin und Friedensaktivistin.
Die Modellregion Wendland
Organising für Soziale Verteidigung im ländlichen Raum
von Jochen Neumann
Das Wendland liegt im nordöstlichsten Zipfel von Niedersachsen, war »Zonenrandgebiet« und gilt bis heute als strukturschwache Region. Bekannt ist das Wendland überregional vor allem durch den langjährigen Widerstand gegen das geplante, aber nie fertig gebaute oder in Betrieb genommene unterirdische Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Vor wenigen Jahren, nach über 40 Jahren Widerstand wurde der Erfolg gefeiert, dass Gorleben von der Liste der möglichen Endlagerstandorte offiziell gestrichen wurde.
Im Rahmen meiner Arbeit bei der KURVE Wustrow, die 1980 als Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion im Wendland gegründet wurde, konnte ich an der Gründung der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« mitwirken und das Wendland als Modellregion vorschlagen. So wie die KURVE Wustrow erfolgreich an der Etablierung des Zivilen Friedensdienstes als Alternative zur militärischen Reaktion auf internationale Konflikte beigetragen hat, so zielt die Kampagne heute darauf ab, Soziale Verteidigung als Alternative zur militärischen Verteidigung voranzubringen.
Ansatz in der Modellregion Wendland
In der Modellregion Wendland wollen wir an diese Erfahrung des Gorleben-Widerstands anknüpfen und aus der üblichen Blase der Friedensbewegten heraustreten, um Soziale Verteidigung voranzubringen. Neben den Anti-Atom-Bewegten gibt es hier viele sozial-ökologische Transformationsprojekte, deren Themen wie Klimaschutz wir auch in Verbindung mit Sozialer Verteidigung setzen wollen. Darüber hinaus wollen wir aber auch auf andere gesellschaftliche Gruppen und Institutionen zugehen, die bei einer effektiven Sozialen Verteidigung in der Region mitwirken sollten, wie der kommunale Krisenstab oder die freiwilligen Feuerwehren.
Hier nutzen wir den Ansatz des »transformativen organising« (Williams 2013), indem wir die Menschen dort abholen wollen, wo sie stehen, leben, aktiv sind, und mit ihnen neue Wege und Lösungen suchen für ihre Probleme und Sorgen. Dabei werden unweigerlich Grundsatzfragen unseres gesellschaftlichen Systems aufgeworfen: Wie wollen wir uns verteidigen? Wie wollen wir wirtschaften? Wer gehört dazu? Brauchen wir territoriale Grenzen?
Für den Aufbau einer Modellregion für Soziale Verteidigung sehen wir daher folgende Phasen (vgl. Abb. 1 mit Maßnahmen und Meilensteinen in den drei Phasen):
Phase 1: Kontakt, Information, Analyse
Phase 2: Lokales Handlungskonzept
Phase 3: Einüben, Planspiel
|
Maßnahmen in Modellregion |
Meilensteine für Maßnahmen |
|
|
Phase 1: |
● Gespräche mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen ● Infoveranstaltungen zu SV ● Workshops zu SV ● Akteursanalyse |
● Lokaler Unterstützer*innenkreis (Netzwerk / Bündnis / Initiative) ist aufgebaut |
|
● Gespräche mit relevanten Akteuren/Sektoren |
● Relevante Akteure/Sektoren sind eingebunden |
|
|
Phase 2: |
● Konzeptentwicklungsworkshops mit relevanten Akteuren ● Formulierung eines lokalen SV-Konzepts ● »Feedback«-Workshops zu Konzeptentwurf |
● Bedrohungs- und Verteidigungsszenarien für lokalen Kontext (lokales SV-Konzept) sind entwickelt |
|
Phase 3: |
● Planspiel mit relevanten Akteuren und möglichst breiter Beteiligung |
● Kreative Methoden zur Umsetzung des lokalen SV-Konzept sind erprobt |
|
● Dokumentation des Prozesses, des Konzepts, der Methoden sowie der Erfahrungen und der Empfehlungen für andere Regionen |
● Fallstudie / methodisches Handbuch ist publiziert |
Abb. 1: Maßnahmen und Meilensteine in den drei Phasen des Aufbaus einer Modellregion für Soziale Verteidigung
In der ersten Phase geht es darum in Kontakt mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gehen und im Sinne des »transformativen organising« hinzuhören und Verbindungen zur Sozialen Verteidigung zu entdecken. Mit Infoveranstaltungen und Workshops kann breiteres Interesse in der Bevölkerung geweckt und Interessierte hinzugewonnen werden. Es empfiehlt sich, ein Akteursmapping zu machen, um für den lokalen Kontext weitere relevante Akteure zu finden und auch hier gezielt Gespräche zu führen. Ziel oder Meilenstein dieser ersten Phase ist es, einen lokalen Kreis an Unterstützer*innen aufzubauen und dabei relevante Akteure und gesellschaftliche Sektoren eingebunden zu haben (vgl. Abb. 2 mit den relevantesten Akteuren und Sektoren im Wendland).

Abb. 2: Relevante Akteursgruppen in der Modellregion Wendland
In der zweiten Phase geht es darum, ein lokales Handlungskonzept für Soziale Verteidigung zu entwickeln. Dieses kann in Workshops gelingen, in denen die relevanten Akteure für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Sektoren zu den kontextspezifischen Bedrohungs- und Verteidigungsszenarien gemeinsam beraten, wie auf diese reagiert bzw. diese vorbeugend verhindert oder reduziert werden könnten. Zum Beispiel sind zum Schutz der Pressefreiheit Journalist*innen der lokalen Medien, der Leser*innenbeirat der Lokalzeitung oder ähnliche Gremien einzubinden, um geeignete Maßnahmen zu erarbeiten.
In der dritten Phase, wenn ein lokales Handlungskonzept vorliegt, gilt es die darin skizzierten Maßnahmen praktisch und mit möglichst breiter Beteiligung einzuüben. Dies kann in Form von Planspielen oder Krisenübungen geschehen. Die Erkenntnisse münden in eine Verbesserung, Ergänzung oder Konkretisierung von Maßnahmen im lokalen Handlungskonzept.
Schließlich soll der gesamte Prozess des Aufbaus einer Modellregion in Form einer Fallstudie oder einem methodischen Handbuch dokumentiert werden, so dass andere Regionen davon lernen können.
Auswahl der relevantesten Akteure in der Modellregion Wendland
Bereits die erste Akteursanalyse für die Modellregion Wendland war auf ein breites Spektrum an Akteursgruppen (Abb. 2) ausgerichtet. Die Liste der relevantesten Akteure, die über direkte Gespräche kontaktiert werden sollen bzw. bereits angesprochen wurden und auch Interesse an dem Konzept der Sozialen Verteidigung gezeigt haben, wird stetig erweitert.
Enge Verbindungen bestanden bereits zu lokalen Bündnissen und Nichtregierungsorganisationen (z.B. dem »Antimilitaristischen Bündnis«, dem »Bündnis gegen Rechts Wendland/Altmark«, dem Klimabündnis und der »KURVE Wustrow«) und zu einigen Initiativen für sozial-ökologische Transformation (z.B. »Fridays for Future«-Gruppen oder der »BI Umwelt- und Naturschutz«). Im Zuge der Vertiefungsworkshops wurden weitere Akteure relevant (z.B. die Initiativen für »Solidarische Landwirtschaft« bei der Frage nach Ernährungssicherheit). Kulturschaffende boten die Möglichkeit, Soziale Verteidigung an neuen Orten (wie Workshops im Rahmen der »Kulturellen Landpartie«) und in neuen Formen (wie einem Theaterstück) einem breiteren Publikum nahezubringen.
Der Ansatz des »transformativen organising« fruchtete sogar im Gespräch mit der parteilosen Landrätin, die selbst die Verbindung zwischen einer von ihr geplanten Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft und der Sozialen Verteidigung entdeckte.
Aufgrund der knappen Personalressourcen für den Aufbau der Modellregion Wendland sind noch nicht alle Akteursgruppen systematisch kontaktiert worden. Es ist jedoch von zentraler Bedeutung für das Voranbringen der Sozialen Verteidigung, dass viele Menschen in ihren gesellschaftlichen Sektoren und Rollen an der Umsetzung beteiligt sind. Soziale Verteidigung wird nicht an professionelle Akteure (wie die militärische Verteidigung an Soldat*innen) delegiert werden können, sondern muss von den Menschen selbst umgesetzt werden. Dies deckt sich auch mit den Erkenntnissen über die Erfolgskriterien für gewaltfreien Widerstand (vgl. Beitrag von Jan Stehn, S. 26): Denn je breiter der Widerstand in der Bevölkerung vertreten ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in das Umfeld und die Machtzirkel der Aggressor*innen hinein wirkt. So gilt es nicht nur zivilgesellschaftliche Akteure, sondern auch andere Akteure wie Wirtschaft, Politik und Verwaltung möglichst frühzeitig anzusprechen und einzubinden.
Ergebnisse der Workshops zu Sozialer Verteidigung in der Modellregion Wendland
In den einführenden Workshops befragen wir die Teilnehmenden, die aus den Kreisen der oben genannten Akteursgruppen stammen oder über öffentliche Werbung von den Veranstaltungen gehört haben, zu folgenden Fragen:
- Was wollen wir verteidigen, bewahren, schützen?
- Was wollen wir weiterentwickeln?
Die Wortwolke (vgl. Abb. 3) zeigt die Antworten auf die ersten beiden Fragen. Je größer das Wort abgebildet ist, desto häufiger wurde es genannt. In der Analyse der Antworten auf die Fragen, was die Menschen verteidigen / bewahren / schützen bzw. weiterentwickeln wollen, erkennen wir folgende Kategorien: das Leben (z.B. eigenes Leben (in Würde), Familie, Freund*innen, Nachbar*innen), die Umwelt (z. B. Natur oder Schöpfung), Menschenrechte (wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlrecht, Pressefreiheit oder Bewegungsfreiheit) und gesellschaftliche Strukturen und Errungenschaften (z.B. demokratisches Gemeinwesen, faires Rechtssystem, Gewaltenteilung, Zugang zu Bildung, offene Grenzen (innerhalb Europas), Sozialstaat, medizinische Versorgung und Infrastruktur). Bei folgenden Antworten lag die Betonung darauf, dass diese noch weiterzuentwickeln sind. Neben den Kategorien Umwelt (z.B. Klimagerechtigkeit, Gemeinwohlökonomie, Kreislaufwirtschaft oder Energieautarkie) und Menschenrechte (z.B. Recht auf saubere Umwelt, Recht auf sauberes Wasser oder Recht auf Nahrung) finden sich hier zwei neue Kategorien: Werte (wie Selbstbestimmung, Intersektionalität, Diversität, Vielfalt, Offenheit für andere Lebensweisen, Solidarität, Schutz von Minderheiten, Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit sowie Feminismus) und Haltung (z.B. den anderen als Mensch, nicht als Feind zu sehen).

Abb. 3: Wortwolke mit Antworten auf die Fragen „Was wollen wir verteidigen / bewahren / schützen?“ und „Was wollen wir weiterentwickeln“ in »WoW«-Einführungsworkshops
In den zahlreichen einführenden Workshops wurden nur sehr vereinzelt Antworten gegeben, die eine sehr individualistische (z.B. »mein Zuhause« oder »mein Haus«) oder nationalstaatliche (z.B. Territorium) Perspektive offenbaren. Im Gegenteil: Nach der Sammlung der oben genannten Antworten in Kleingruppen und der Präsentation vor der Gesamtgruppe zeigte sich eine sehr breite Unterstützung für die Kategorien Leben, Umwelt, Menschenrechte, gesellschaftliche Errungenschaften, Werte und Haltung. Was genau mit den einzelnen Begriffen gemeint ist, konnte nicht ausdiskutiert werden. Es sollte auch kein Konsens in den Kleingruppen gefunden werden. Aber es bildete sich ein Gruppenkonsens dazu heraus, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, was wir verteidigen / bewahren / schützen wollen.1
In vertiefenden Workshops fragen wir zudem: Was wären potentielle Angriffsziele? Diese sind kontextspezifisch für jede Region (s. Abb. 4 zu den für die Modellregion Wendland identifizierten Angriffszielen) und erfordern entsprechend lokal abgestimmte Reaktions- bzw. Präventionsmaßnahmen.
|
Beispiele für potentielle Angriffsziele |
|
|
im Landkreis Lüchow-Dannenberg |
in unmittelbarer Nähe |
|
● Oberirdisches Zwischenlager mit hochradioaktivem Müll (Gorleben) ● Elbbrücken (Dannenberg-Dömitz) ● Rüstungsbetrieb von Harder Digital (Woltersdorf) ● Wahllokale ● … |
● Rüstungsbetrieb von Rheinmetall (Unterlüß) ● Truppenübungsplatz für innerstädtischen Kampf (Colbitz-Letzlinger Heide) ● Elbe-Seitenkanal (Uelzen) ● … |
Abb. 4: Potentielle Angriffsziele in der Modellregion Wendland und der unmittelbaren Umgebung
Ansatzpunkte für lokales Handlungskonzept
Mit Blick auf die bisherige Theorie zu Sozialer Verteidigung sowie aus den ersten Erkenntnissen aus der lokalen Praxis in der Modellregion haben wir fünf Ansatzpunkte für lokale Handlungskonzepte abgeleitet (vgl. Abb. 5). Diese Liste ist noch zu erweitern bzw. zu differenzieren. Sie ist also noch als »work in progress« zu verstehen.
|
Ansatzpunkte |
Methoden |
|
Zusammenhalt stärken |
● Zivilgesellschaftliche Akteure stärken und Netzwerke aufbauen ● Lokale SV-Bündnisse zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik schließen und darin: ● demokratische Teilhabe praktizieren ● die gemeinsame menschenrechtsbasierte Wertegrundlage bewusst machen und pflegen ● gemeinsame Symbole finden und nutzen ● gemeinsame Rituale finden und feiern ● gesellschaftliche Barrieren und Diskriminierung abbauen ● gewaltfreie Konfliktkultur stärken |
|
Schützen, erhalten |
● demokratische Widerstandsfähigkeit stärken ● physische, psycho-soziale und digitale Schutzmechanismen aufbauen ● Aufbau von dezentraler und nachhaltiger Wirtschaft: z.B. dezentrale Energieversorgung, Solidarische Landwirtschaft etc., um Überlebensvorsorge für alle zu schaffen ● Solidarische Notfallwirtschaft (vorbereiten und wenn erforderlich umsetzen) ● Evakuierung und Arbeit im Untergrund (vorbereiten und wenn erforderlich umsetzen) |
|
Legitime Bedürfnisse |
● Frühzeitig Begegnungsmöglichkeiten bereits präventiv schaffen ● Dialogformate entwickeln und nutzen ● Aktionsformen für Begegnung mit der Gegenseite als Menschen (nicht als Feind) entwickeln und einüben ●Kommunikator*innen (Sprache & Haltung) ausbilden |
|
Illegitime Ziele der |
● »Dienst nach Vorschrift«, d.h. scheinbare Zusammenarbeit ● Go Slow: langsam arbeiten ● Blockade ● Gewaltfreie Sabotage ● (General)Streik |
|
Säulen der illegitimen |
● Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Akteuren auf der Gegenseite aufbauen und pflegen ● Gegenöffentlichkeit herstellen ● Militärs und Autoritäten beeinflussen ● Legitimierte und zielgenaue Sanktionen ● Rückhalt der Aggressor*innen schwächen ● Internationale Solidarisierung erreichen |
Abb. 5: Fünf Ansatzpunkte für Soziale Verteidigung und spezifische Maßnahmen
In der Modellregion Wendland lässt sich beim Ansatz, illegitime Ziele der Gegenseite zu verhindern, sehr gut an die Erfahrungen des Anti-Atom-Widerstands anknüpfen. »Castor«-Gruppen, die es in fast jedem Dorf gab, oder die »Bäuerliche Notgemeinschaft« wissen, wie scheinbar übermächtige Gegner mit der Blockade von Eisenbahngleisen, Straßen und Verkehrskreiseln zumindest zeitweilig aufgehalten und mittelfristig in ihrer Moral zerrüttet werden können.
Es gibt jedoch nicht nur eine starke Widerstandstradition im Wendland. Auch die Überzeugung, nicht nur »dagegen« sein, sondern Alternativen entwickeln und in die Tat umsetzen zu wollen, ist im Wendland weit verbreitet. So finden sich hier zahlreiche Pionier*innen für dezentrale und nachhaltige Energieversorgung und solidarische Landwirtschaft, deren Initiativen für die Überlebensvorsorge im Verteidigungsfall von zentraler Bedeutung wären.
In der zweiten Phase des Aufbaus der Modellregion Wendland werden in den nächsten Monaten weitere Konzeptionsentwicklungsworkshops stattfinden. Mit der Beteiligung der relevanten Akteure aus ausgewählten Handlungsfeldern (wie Medien, Ernährungssicherheit, Energieversorgung oder Kultur) werden die spezifischen Maßnahmen für den lokalen Kontext herausgearbeitet und münden in ein lokales Handlungskonzept. Es wird sicher nicht gelingen, zeitnah alle relevanten Handlungsfelder zu bearbeiten, bevor wir in die dritte Phase des Einübens eintreten, um die identifizierten Maßnahmen in Planspielen oder Krisensimulationen realitätsnah zu üben und auszuwerten.
Offene Fragen
In den zahlreichen Gesprächen und Workshops mit den Menschen in den Regionen werden viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen und viele Menschen bleiben noch skeptisch. Allerdings erfahren wir große Wertschätzung dafür, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, Soziale Verteidigung mit Leben zu füllen und Antworten auch auf die schwierigsten Fragen zu suchen. Dazu zählen die folgenden noch offenen Fragen: Wie viele müssen wir sein? Wie wirkt Soziale Verteidigung präventiv bzw. abschreckend auf Aggressor*innen? Wie kann eine Region aus der nationalen militärischen Verteidigungsstrategie »austreten«, wenn Soziale Verteidigung noch nicht gesamtgesellschaftlich angenommen wurde?
Anmerkung
1) Im weiteren Verlauf der einführenden Workshops geht es dann üblicherweise um die Frage, wie diese Menschenrechte, Werte und Strukturen besser verteidigt werden können – mit sozialer oder militärischer Verteidigung.
Literatur
Williams, S. (2013): Fordert alles. Lehren aus dem Transformativen Organizing. Rosa-Luxemburg-Stiftung: New York.
Jochen Neumann war von 2004 bis Mitte 2025 Geschäftsführer der KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. Er hat die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« mitgegründet und hat neben der Koordination der Modellregion Wendland seit Juli 2025 auch die Koordination der bundesweiten Kampagne übernommen.
Exkurs: Wider die rechtsextreme Machtübernahme
Praktische Erfahrungen aus dem Wendland
von Jochen Neumann
Soziale Verteidigung will auch eine wirksame Alternative im Falle eines Angriffs von innen sein, beispielsweise durch einen gewaltsamen Putsch. Aber was, wenn der Angriff nicht putschartig erfolgt, sondern schleichend? Wenn demokratische Institutionen und der Rechtsstaat missachtet oder langsam geschliffen werden? Was, wenn menschenfeindliche Haltungen und diskriminierende Handlungen zur Regierungspolitik werden? Wenn durch Wahlerfolge rechtsextremistische Parteien an die Macht kommen?
Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« hatte zunächst einen deutlichen Schwerpunkt auf die Verteidigung gegen einen militärischen Angriff von außen. In den klassischen Einführungsworkshops in die Soziale Verteidigung fragen wir jedoch: „Was wollen wir verteidigen?“
An den Antworten und Diskussionen können wir sehen, dass von den Teilnehmer*innen immer auch die Bedrohung durch Angriffe von innen mitgedacht wird: Demokratie, Partizipation, Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vielfalt und Minderheitenschutz, soziale Errungenschaften (wie Kranken- und Sozialversicherung). Auch bei der Frage nach möglichen Angriffszielen wurden Wahllokale genannt und von Einschüchterungsversuchen durch rechtsextreme Schlägertrupps berichtet, die sich dort am Wahltag gezeigt hätten.
Angeregt von den bundesweiten Demonstrationen nach Bekanntwerden der »Remigrationspläne« der AfD durch die correctiv-Recherchen im Januar 2024 (Correctiv 2024), stellten sich viele Menschen die Frage: Wie können wir die Machtübernahme durch rechtsextremistische Parteien verhindern und unsere Demokratie verteidigen?
In der Modellregion Wendland organisierten sich diese engagierten Menschen zunächst in Messenger-Gruppen wie »Aktiv gegen Rechts im Wendland«, wollten sich dann aber auch miteinander treffen und gemeinsam in Aktion gehen. Auf sogenannten »Vernetzungstreffen« trafen sie sich erst in ihren Orten und Städten, später in regionalen (Landkreis) und überregionalen (mit Menschen aus angrenzenden Landkreisen) Foren sowie bei sektoralen Austauschtreffen (z.B. Kommunalpolitiker*innen aus mehreren Landkreisen bzw. Bundesländern).
Diese Vernetzungstreffen finden weiter in unregelmäßigen Abständen statt, sind moderiert und beinhalten typischerweise Grundregeln für einen respektvollen Umgang miteinander, auflockernde Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen, eine kreative Ideensammlung ohne Diskussion und anschließend ein Sortieren der Ideen, um im nächsten Schritt in Kleingruppen diejenigen zusammenzubringen, die gemeinsam eine der Ideen umsetzen wollen. Zum Abschluss wird einander von den konkreten Umsetzungsschritten berichtet und es werden Verabredungen für die weitere Zusammenarbeit und Vernetzung getroffen.
Ziel der Vernetzungstreffen ist es, Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen und kreative Ansätze bis zur Umsetzungsreife zu entwickeln.
Um die Vielzahl der Ideen zu sortieren und vor allem um diese nicht gleich zu zerreden, weil sie vermeintlich weniger wichtig oder gar falsch und kontraproduktiv seien, ist es wichtig diese zu systematisieren. Wir fragen: Wer soll damit erreicht werden? Und was soll damit erreicht werden?
Die Unterscheidung in vier Hauptzielgruppen und den damit verbundenen Zielen oder auch Ansätzen war dabei äußerst hilfreich:
- Organisierte Rechtsextreme: Hier gilt es klare Kante zu zeigen und denen den öffentlichen Raum nicht zu überlassen!
- Potentielle Wähler*innen rechtsextremistischer Parteien: Hier wollen wir in Kontakt gehen und informieren!
- Gleichgesinnte: Diese Menschen wollen wir für gemeinsame Aktion mobilisieren!
- Betroffene: Hier wollen wir Unterstützung und Schutz anbieten!
Vor diesem Hintergrund lassen sich nicht nur Missverständnisse und gegenseitige Kritik besser einfangen, sondern es überwiegt gegenseitige Wertschätzung. Zum Beispiel war klar, dass wir uns nicht daran abkämpfen sollten, die Spitzenkandidat*innen der rechtsextremen oder -populistischen Parteien zu überzeugen, sondern ihnen bei Wahlveranstaltungen oder am Wahlkampfstand nicht unwidersprochen den öffentlichen Raum zu überlassen. Dabei wurden auch kreative neue Ideen entwickelt: z.B. anstatt beim Auftritt des rechtspopulistischen Spitzenkandidaten (der Freien Wähler) vor einer Dorfkneipe zu protestieren, sich in größerer Zahl in den Saal zu setzen und den potentiellen Wähler*innen den Platz zu nehmen. So sollten weniger indoktriniert werden können. Dies hatte den Nebeneffekt, dass sich Einzelne durch die Präsenz Gleichgesinnter ermutigt fühlten, dem rechtspopulistischen Redner zu widersprechen, seine falschen Zahlen zu korrigieren und den Zuhörenden andere Sichtweisen und eigene persönliche Erfahrungen und Geschichten mitzugeben. Vor allem ergaben sich im Anschluss noch gute Gespräche mit einigen Gästen, die als potentielle Wähler*innen dieser Partei einzuordnen gewesen sind. Die Lokalzeitung berichtete nicht nur über das »Kontra«, das der Spitzenkandidat erfahren hatte, sondern schloss sich auch der Einschätzung an, dass der als »Rechtspopulist« einzustufen sei (vgl. EJZ 2024).
Die Aktionsideen und Aktionsgruppen, die sich gebildet haben, sind vielfältig. Sie reichen von Stickeraktionen und Social Media-Kampagnen über Informationsveranstaltungen bis hin zu Dialogformaten, Argumentationstrainings und der Anwendung von Methoden des »Theater der Unterdrückten« auf dem Marktplatz, um anschaulich zu machen, wie unsere Gesellschaft nach einer rechtsextremistischen Machtübernahme aussehen könnte. Für jetzt schon bedrohte Menschen wie Geflüchtete oder Aktive in Orten, in denen Übergriffe durch Rechtsextreme stattgefunden hatten oder zu befürchten sind, wurden Schutzmaßnahmen verabredet und diese bei Bedarf auch umgesetzt.
Die gesellschaftlichen Entwicklungen erfordern – und diese praktischen Erfahrungen zeigen dies erneut –, dass das Konzept der Sozialen Verteidigung auch im Falle einer schleichenden Erosion demokratischer Werte und Institutionen sinnvoll eingesetzt werden kann. Soziale Verteidigung darf keine Utopie bleiben, sondern bietet den Rahmen für konkrete und wirksame Strategien, um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen – und wird bereits umgesetzt und mit Leben gefüllt.
Literatur
Correctiv (2024): Geheimplan gegen Deutschland. Recherche, correctiv.org, 10.1.2024.
Elbe-Jeetzel-Zeitung (2024): Freie Wähler: Das war der Auftritt von Spitzenkandidat Lee in Zernien. EJZ, 17.5.2024.
Wehrhaft ohne Waffen – Regionalgruppe Essen
Von der Gründung bis zur Zusammenarbeit mit der Stadt Essen
von Martin Arnold
Vor 100 Jahren besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Eine Erinnerung an den folgenden gewaltfreien erfolgreichen Ruhrkampf (»Passiver Widerstand« und Diplomatie) ist in der Bevölkerung kaum vorhanden.1 Ist diese Tatsache im öffentlichen Bewusstsein kaum präsent, kann hier also nicht daran »angeknüpft« werden.
Die kleinen Anfänge
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Ausrufung einer Regionalgruppe Essen in einem besonderen Licht dar. Im Essener »Friedenskreis im Forum Billebrinkhöhe«, gegründet 2018, waren 2022 lediglich zwei Mitglieder an Sozialer Verteidigung (SV) inhaltlich wie praktisch interessiert. Zwei SV-Infoabende mit Martin Arnold (zu SV allgemein) und Barbara Müller (zum Ruhrkampf) fanden nur geringen Zuspruch; neue Interessierte kamen nicht hinzu. Der Friedenskreis nahm zunächst im Zusammenhang mit einer anderen friedenspolitischen Zielsetzung (»Sicherheit neu denken«) mit Dirk Heidenblut Kontakt auf, einem friedensbewegten Bundestagsabgeordneten aus Essen. Im September 2023 besuchte er den Friedenskreis und versprach Unterstützung für das Anliegen, Soziale Verteidigung voranzubringen, etwa „Türen zu öffnen“. Nur langsam wuchs die Gruppe der Aktiven im Herbst 2023, traf sich ab dieser Zeit etwa monatlich privat.
Das erste Ziel dieser Regionalgruppe war es daher, neue Mitglieder zu gewinnen. In benachbarten Städten führten wir Workshops und Vorträge zur Sozialen Verteidigung durch und stellten im November 2023 die Soziale Verteidigung im Essener »VielRespektZentrum« vor. Besonders Mitbürger*innen mit Kriegserfahrungen (viele davon Menschen mit Migrationsbiographie) zeigten Interesse. Mit einem von migrantischen Selbstorganisationen getragenen Bildungswerk organisierten wir in der Folge vier Workshops von August bis Oktober 2024. Bis zum Winter 2024 schlossen sich – oft nach Workshops – mehrere Menschen unserer Gruppe an, die nun neun Mitglieder hat. Als Gründe für ihre Motivation zur Mitwirkung nannten sie die persönliche Entwicklung, die sie durch die Erfahrung des Forumtheaters in unseren Workshops gemacht haben, und die direkte Ansprache zur Mitwirkung am Rande der Workshoptage.
Wir trafen uns seit Herbst 2024 zweiwöchentlich, um uns auf die folgenden Aktivitäten gut vorbereiten zu können. Nachdem wir vor allem Aktionen und Gespräche mit offiziellen Stellen vorbereitet hatten, kamen wir im Juni 2025 zum ersten Mal für vier Stunden zusammen – Zeit für besseres Kennenlernen und inhaltliche Fragen zur Sozialen Verteidigung.

Abb. 1: Dirk Heidenblut und die (unvollständige) Wehrhaft ohne Waffen – Regionalgruppe Essen sowie Ulrich Stadtmann aus Minden (rechts vorne) im Juni 2024; Foto: mit freundlicher Genehmigung von Dirk Heidenblut.
SV auf kommunaler Ebene verankern
Um Soziale Verteidigung in Essen zu verankern, setzt unsere Regionalgruppe zunehmend auf direkte Gespräche mit offiziellen Stellen. Hierzu hatte uns das Gespräch »im kleinen Kreise« mit MdB Dirk Heidenblut im Sommer 2024 angeregt und ermutigt. Jeweils entwickelten sich weitere Gespräche eher aus Gelegenheiten denn als Folge systematischer Überlegungen. Ohne eine programmatische Entscheidung hinter bestimmten Gesprächen entwickelte sich dieser Ansatz der »Nutzung offener Türen« zu einem interessanten Weg, die Verankerung voranzubringen. Im Einzelnen hat unsere Gruppe ab Herbst 2024 mit vier größeren Bereichen ziviler Organisationen Kontakte geknüpft:
- 1. Katastrophenschutz: Arbeitersamariterbund (ASB) und Rotes Kreuz waren offen, verwiesen aber auf die Landesebene. Beim Roten Kreuz versandete das Vorhaben. Beim ASB haben wir im Juli 2025 mehr als 20 Teilnehmenden aus den Ortsverbänden in NRW auf Geschäftsführungsebene Soziale Verteidigung vorgestellt; sie wurde in großer Offenheit als ernstzunehmende Alternative zum Militär diskutiert; für die nahe Zukunft ist ein Workshop geplant.
- 2. Gewerkschaften: Der örtliche DGB-Vorsitzende Dieter Hillebrand und ein friedensbewegter Gewerkschafter waren dem Anliegen gegenüber aufgeschlossen. Bis Januar 2025 sollten daher Möglichkeiten für SV in der DGB-Bildungsarbeit geprüft werden. Doch die Rückmeldung war enttäuschend. Es wurde auf die Einzelgewerkschaften verwiesen. Wir werden vorhandene Kontakte nutzen und weitere knüpfen.
- 3. Stadt Essen: Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) zeigte sich am »Mayors for Peace«-Flaggentag 2024 offen, nachdem wir ihm Informationsmaterial des Bundes für Soziale Verteidigung übergeben hatten. Im Januar 2025 kam es zu einem intensiven Gespräch, noch emotional berührt von einer Zivilschutz-Fortbildung, die der Oberbürgermeister am Vortag besucht hatte. Er sagte SV-Unterstützung zu, etwa durch Förderung von Forumtheater an Schulen und Empfehlung an den Beigeordneten für Sicherheit, Christian Kromberg (CDU). Dieser kannte das Werk »Why Civil Resistance Works« von Erika Chenoweth und Maria Stephan (2011)2 und befürwortet SV. Bei zwei weiteren Treffen sagte er – unter Bedingungen – den Einsatz für die Finanzierung von professionellen Forumtheater-Workshops zu Zivilcourage an Schulen und auf unseren Vorschlag für 2026 einen städtischen »Tag des Friedens und der Resilienz« zu, bei dem in einem Kongress neben anderen Resilienz-Themen Soziale Verteidigung vorgestellt wird und auch Friedensgruppen ihre Anliegen werden präsentieren können. Außerdem soll das Stadtarchiv angesprochen werden, ob eine Ausstellung zum Thema »Wehrhaft ohne Waffen« mit einem besonderen Fokus auf den Ruhrkampf gestaltet werden kann. Weitere Gespräche sind vereinbart.
- 4. Kirchen und Zivilgesellschaft: Der Pfarrkonvent des Evangelischen Kirchenkreises wurde über SV informiert. Gespräche mit der »Essener Allianz für Weltoffenheit« sind geplant.
Bei all diesen Gesprächen war die Mitwirkung des BSV-Vorstandsmitglieds und CDU-Stadtverordneten aus Minden, Uli Stadtmann, eine große Hilfe. Er unterstützte uns bei der Vorbereitung, teils vor Ort, teils online, und kam aus Minden zu den meisten Gesprächen hinzu.
Reflexionen zur regionalen Verankerung
Nach einem eher gemächlichen Beginn unserer Arbeit als »Wehrhaft ohne Waffen«-Regionalgruppe haben sich die Aktivitäten, Möglichkeiten und die Intensität der Arbeit seit Herbst 2024 rasant verändert. Im Rückblick bleiben einige wesentliche Reflexionen hervorzuheben:
- Die Zahl der Teilnehmenden an unseren Bildungsangeboten war bei den vier Workshops im Herbst 2024 befriedigend, bei den anderen Veranstaltungen nicht. Auch wenn stete Veranstaltungsarbeit zum Anwachsen der Gruppe geführt hat, war die Resonanz auf die Veranstaltungen insgesamt eher enttäuschend. Allein an der Masse der Werbung und Medienarbeit aber kann es eher nicht gelegen haben.
- Wir waren insgesamt positiv überrascht bei den Gesprächen ab Herbst 2024 über die Offenheit, Kenntnisse und Befürwortung von Sozialer Verteidigung bei den angesprochenen Institutionen-Vertreter*innen, zumal bei den »Konservativen« (CDU) in der Essener Verwaltung. Ich habe dies als Ermutigung und großartige Stärkung unseres Anliegens empfunden, die Verankerung von SV voranzubringen. Unser vorher überwiegendes Selbstverständnis mit der Vermutung, wir müssten mit Widerstand staatlicher (weil bei »Sicherheit« vermeintlich auf Waffen fixierter) Stellen rechnen, wurde abgelöst durch die Erfahrung, dass nicht nur ein einzelnes SPD-MdB, sondern auch hohe städtische Repräsentant*innen viel von SV halten und unseren Impuls der Verbreitung unterstützen. Interessanterweise ergibt sich hier eine historische Parallele: Auch bei der Ruhrbesetzung vor 100 Jahren waren konservative Politiker die ersten, die »Passiven Widerstand« befürworteten.
- Weil Soziale Verteidigung durch militärische Aktivitäten am selben Ort zur selben Zeit verunmöglicht würde, haben wir in der Regionalgruppe Essen infolge der gelungenen Gespräche festgelegt: Wir werden bei möglicher Zusammenarbeit peinlich genau darauf achten, dass unser Anliegen, etwa unter dem Label »Zivilschutz«, keinesfalls für letztlich militärische Zwecke vereinnahmt wird.
- Dadurch dass unser Ansatz von SV durch prominente Essener Verantwortliche unterstützt wird, können wir nicht mehr so leicht als »Spinner« diffamiert werden. Lokal dürften wir so dem in der bundesweiten Kampagne verankerten Ziel „SV ist im öffentlichen Diskurs eine ernstgenommene sicherheitspolitische Alternative“ leichter näherkommen. Großes Potential läge darin, wenn ein Verwaltungsvorstand SV öffentlich befürworten würde. Aufgrund der anstehenden Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des gewaltfrei erfolgreichen Ruhrkampfes und des Abzugs der Besatzungstruppen 1925 in diesem Herbst könnte es hierfür eine historisch einmalige Gelegenheit geben.
- Weiterhin könnte die SV-Arbeit von den breiten Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten, z.B. Ausrichtung eines städtischen Tags des Friedens und der Resilienz, sowie von materiellen Ressourcen profitieren. So arbeiten städtische Stellen in Essen eng mit potenten Stiftungen zusammen, die anspruchsvolle Projekte finanzieren können, für die (noch) keine Ratsmehrheit Mittel bewilligen würde. Dies könnte die didaktisch professionelle Erstellung einer Ausstellung zur Sozialen Verteidigung (mit dem lokalen Fokus Ruhrkampf) oder auch die Finanzierung von Forumtheater-Workshops zu Sozialer Verteidigung mit Profi-Schauspieler*innen an vielen Essener Schulen betreffen. Die Projekte werden inzwischen auch vom Oberbürgermeister befürwortet. Für ihre Ausgestaltung hat der Beigeordnete zugesagt, dass die Projekte nicht unter der Überschrift »Zivilschutz« laufen werden. Wir werden auch darüber hinaus darauf achten, dass eine Vermischung mit militärischen Anliegen ausgeschlossen wird.
Vorausblick: Potenziale für die Kampagnenarbeit
Als Überlegungen zur positiven Reaktion auf unsere Gesprächsanliegen in der Essener Stadtverwaltung fragen wir uns: Gibt es unter denjenigen Menschen, die in Politik und Verwaltung in öffentlichen Ämtern Verantwortung tragen, möglicherweise noch mehr politisch Interessierte, die sich mit »Zeitenwende« und der Vorbereitung von »Kriegstüchtigkeit« unwohl fühlen? Womöglich anteilig genauso viele wie im Durchschnitt der Bevölkerung? Diese Personen können die Auseinandersetzung damit aber nicht verdrängen, weil sie z.B. Zivilschutz aufbauen müssen. Gibt es vielleicht über Essen hinaus in den Verwaltungen und der lokalen Politik mögliche Verbündete von Wehrhaft ohne Waffen? Die überraschend positive Erfahrung des Gesprächs mit der Landrätin im Wendland spricht wohl auch dafür (vgl. Neumann in diesem Dossier, S. 15). Es dürfte also lohnend sein zu erkunden, wie groß unter Politiker*innen und Führungspersonen in Verwaltungen die Bereitschaft ist, sich über Soziale Verteidigung zu informieren und sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Diese könnten dann auch helfen, SV wesentlich voranzubringen. Daraus könnte insgesamt wichtiges Potential für SV erwachsen.
Auch mit Blick auf unsere lokalen MdB ist das erneut relevant: Zwar ist Dirk Heidenblut aus dem Bundestag ausgeschieden, aber neu ist Serdar Yüksel aus Bochum eingezogen, er befürwortet ebenfalls SV und ist – wenn wir das wollen – bereit, dafür etwas zu tun, auch in Berlin, etwa durch einen SV-Informationsabend für Parlamentarier*innen.
Bisher waren wir als »WoW«-Kampagne weitgehend davon ausgegangen, dass wir als zivilgesellschaftliche Akteure SV (zunächst) unabhängig von staatlichen Stellen voranbringen sollten, um dann später mit erhofftem Rückenwind einer gewissen Öffentlichkeit auch staatliche Institutionen dafür zu gewinnen. Was bedeutet es, wenn wir – anders als bisher – davon ausgehen, dass in Politik und Verwaltung WoW-Sympathisant*innen angesprochen werden können, die mit ihren Möglichkeiten helfen, SV voranzubringen?
Sollten wir Politiker*innen und staatliche Stellen alsbald einbeziehen und auf lokaler bis zur Bundesebene gezielt ansprechen, sodass dann SV gerade in diesen Kreisen bekannter und zum Thema wird und weitere Ressourcen für SV bereitgestellt werden können?
Wenn wir Politik und Verwaltung gezielt ansprechen wollen, sehe ich unsere wichtigste Aufgabe darin, inhaltlich gut durchdacht auszuarbeiten und darzustellen, was es konkret für die verschiedenen Akteure, von Gruppen der Zivilgesellschaft über die kommunale bis zur Bundesebene heißt, SV aufzubauen. Nur so können wir dies den entsprechenden Personen plausibel nahebringen. Hilfreich könnte hierbei jeweils ein Bezug zu verschiedenen Phasen von Bedrohungen (von außen anders als von innen) sein. Die plausible Darstellung ist besonders wichtig, weil die Gefahr besteht, dass das Projekt bei Großfinanzierung von außen mit neuen Beteiligten eine Eigendynamik entwickeln könnte, die die ursprüngliche Intention verfälscht – beispielsweise hin zu einer zivil-militärischen Vernetzung. Die ermutigenden Zeichen aus Essen sagen: Das muss nicht sein und es kann gelingen.
Anmerkungen
1) Das mag sich bei historisch Interessierten im Frühjahr 2023 durch eine mehrmonatige Ausstellung dazu im Ruhrmuseum zwar etwas geändert haben. Doch der für die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« (WoW) interessante Aspekt, dass nicht durch Kriegführung, sondern durch gewaltfreies Vorgehen militärische Invasoren zum Abzug gebracht wurden, spielte in der Ausstellung kaum eine Rolle.
2) Das Buch ist erst kürzlich in deutscher Sprache erschienen: Ebd. (2024): Warum ziviler Widerstand funktioniert. Baden-Baden: Nomos.
Dr. Martin Arnold ist Friedensforscher in Essen. Mehr über ihn auf seiner Homepage martin-arnold.eu und auf seinem YouTube-Kanal »Gütekraft«.
Perspektivwechsel: Sudan
Ziviler Widerstand, gegenseitige Fürsorge und kollektive Sicherheitsstrategien
von Julia Kramer
Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« erforscht und vertritt Ansätze, wie Soziale Verteidigung hier und heute vorbereitet und umgesetzt werden kann. Dabei werden als zentrale Säulen der Sozialen Verteidigung neben gewaltfreiem Widerstand auch Schutzstrategien und gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Mittelpunkt gestellt (vgl. Barleben in diesem Dossier, S. 3).
Auffallend ist, dass letztere zwei Säulen bislang weit weniger Beachtung fanden, obwohl sie doch genau auf die potenziellen Risiken für menschliche Sicherheit fokussieren, die Soziale Verteidigung zu verteidigen beansprucht. Meine Hypothese ist, dass deren Berücksichtigung ein entscheidender Faktor sein könnte, um Menschen zu überzeugen, sich im Rahmen von Sozialer Verteidigung zu engagieren, langfristig aktiv zu bleiben – und tatsächlich zu überleben.
Von der sudanesischen Bewegung für eine zivile Regierung und für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit können wir dabei lernen, wie die Praxis von gewaltfreiem zivilem Widerstand mit kollektiven Schutzstrategien und gesellschaftlichem Zusammenhalt in Form von »Gegenseitiger Fürsorge« (»Mutual Aid«) kombiniert und gestärkt werden kann.
Kollektive Fürsorge und Schutzstrategien in Bewegungen
Was ist also diese »gegenseitige Fürsorge«? Dean Spade (2020) definiert dies als „Überlebensarbeit, wenn sie parallel zu Forderungen sozialer Bewegungen nach transformativen Veränderungen geleistet wird“ (Klappentext). „Sie bietet soziale Räume, in denen neue Solidaritäten wachsen.“ (ebd., S. 2) Weiter betont Spade, dass „Maßnahmen gegenseitiger Fürsorge […] eine gemeinsame Analyse der Problemursachen [fördern] und […] Menschen mit den sozialen Bewegungen [verbinden], die diese angehen können.“ (ebd., S. 29)
Es geht hierbei um »Solidarität statt Wohltätigkeit«, mit den problematischen Merkmalen der Letzteren von Paternalismus, »Hierarchien der Hilfswürdigkeit« und letztlich der Stabilisierung eines ungerechten, nicht nachhaltigen Status quo. Im Gegensatz zu Aktivitäten von sogenannten »Preppern« kümmert sich gegenseitige Fürsorge auf kollektiver Basis um Überlebensbedürfnisse und menschliche Sicherheit für alle, nimmt dabei besondere Verletzlichkeiten in den Fokus, und beinhaltet die Verbindung zu sozialem Wandel hin zur Realisierung der Menschenrechtsgarantien für alle.
Es gibt verschiedene Ansätze, wie gegenseitige Hilfe lokal und in globalen Bewegungen weiterentwickelt werden kann. Die Stadt Vancouver hat ein Toolkit für resiliente Nachbarschaften entwickelt (»Resilient Neighbourhoods Toolkit«). Das Schaubild zeigt einen möglichen Organisierungsablauf, wie er von Nachbarschaften aufgegriffen werden kann (vgl. Abb. 1).
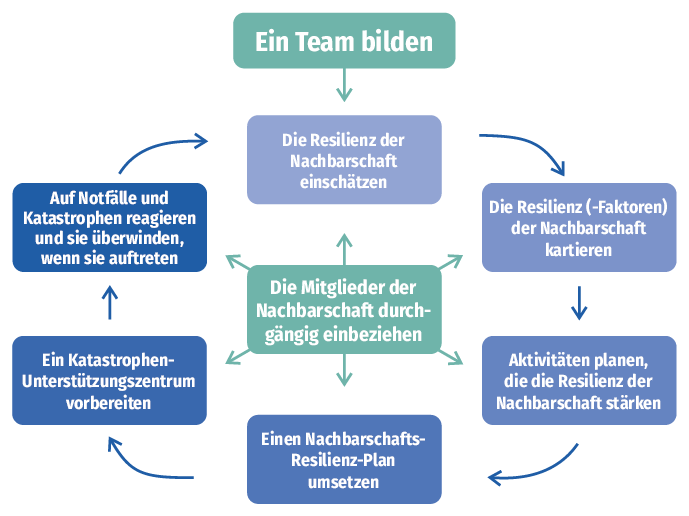
Abb. 1: Organisierungsablauf der Stadt Vancouver für resiliente Stadtteile. Quelle: City of Vancouver (o.J.): Resilient Neighbourhoods Toolkit, S. 6, eigene Übersetzung.
Der Diskurs der »gegenseitigen Fürsorge« ist bislang hauptsächlich im Globalen Norden geprägt worden, wie z.B. im Kontext des Hurrikan Katrina 2005 im Raum New Orleans. Aus dieser Perspektive heraus stellt Spade fest, dass „Menschen heute in den atomisiertesten Gesellschaften der Menschheitsgeschichte leben, was […] unsere Fähigkeit untergräbt, gemeinsam ungerechte Bedingungen in großem Maßstab zu verändern“, und uns dazu zwinge, „auf feindliche Systeme zu vertrauen“ (ebd., S. 8).
Sudanesische Gemeinschaften und Kulturen haben hier andere Erfahrungen und Praktiken, die weniger auf Atomisierung und stärker auf kollektiver Fürsorge basieren als das, was wir im Globalen Norden geschaffen haben und weiter reproduzieren. Damit meine ich zum Beispiel das Konzept und die Praktiken des »Nafeer«. Nafeer bedeutet, wie einer meiner Interviewpartner*innen sagte, das „gemeinsame Helfen in der Nachbarschaft bei Dingen, für die man viele Menschen braucht“ – das kann Beistand bei Beerdigungen oder Hochzeiten sein, das Reparieren von Häusern nach schweren Regenfällen oder Überschwemmungen, die Organisation von Nahrung oder Treibstoff bei Knappheit oder der Transport von Kranken.1 Vertrauen und gegenseitige Unterstützung, insbesondere in den Nachbarschaften, wie wir später sehen werden, haben sich sowohl im revolutionären Widerstand gegen die Militärdiktatur (als Form des gewaltfreien Widerstands ähnlich sozialer Verteidigung) als auch im Krieg als entscheidend erwiesen.
Beim Blick auf die sudanesische Widerstands- und Überlebenserfahrungen, wird zudem deutlich, dass kollektive Schutzstrategien innerhalb der Bewegung ein weiterer wichtiger Aspekt sind für gewaltfreien Widerstand in repressiven, gewaltvollen Kontexten. Sie ermöglichen es, dass Menschen und Bewegungen aktiv und widerstandsfähig bleiben und Repression tatsächlich überleben können. Kollektive Schutzstrategien umfassen Strukturen und Muster von Praktiken im Umgang mit Repression und ihren Folgen, die über individuelles und kleingruppenbasiertes Risiko- und Sicherheitsmanagement hinausgehen, sowie Strategien für ein »Backfire« gegen diejenigen, von denen die Repression ausgeht.
Erfahrungen aus dem Sudan
Die nebenstehende tabellarische Übersicht (Abb. 2) zeigt beispielhafte Strukturen und Aktivitäten der Säulen Sozialer Verteidigung in den verschiedenen Phasen der sudanesischen Bewegung seit 2009. Sie macht deutlich: Ohne gegenseitige Fürsorge und Schutzstrategien hätte die Bewegung den Widerstand gegen eine jahrzehntelange Militärdiktatur weder aufbauen noch gewinnen können.
|
Zeitraum |
Kontext-Entwicklungen |
Soziale Verteidigung |
||
|
Gewaltfreier Widerstand |
Aktivistische Schutz-Strategien |
Gegenseitige Fürsorge / Gesellschaftlicher Zusammenhalt |
||
|
2009-2013: |
Religiös und ethnisch aufgeladene Militärdiktatur. ● 2010: manipulierte Wahlen ● 2011: Unabhängigkeit Südsudan |
● Pionier-Aktionen mit dem Ziel, aufzuklären und die Angst zu überwinden: z.B. »Speak & Run«-Aktionen, YouTube-Aktivismus u.a. Strategie-Entwicklung |
● Freundeskreise entwickeln sich zu aktivistischen Zellen, die sich bzgl. Repression schützen und unterstützen (z.B. Girifna-Bewegung) |
● Praxis von »Nafeer« (Konzept der Nachbarschaftshilfe), wird auch nachbarschaftsübergreifend angewendet bei Fluten in 2013 ● Diasporische Solidarität |
|
2013-2018: |
Religiös und ethnisch aufgeladene Militärdiktatur. ● 2015: Khartum-Abkommen mit der EU |
● V.a. dezentrale oder »Stern«-Aktionen der Nachbarschaftskommittees |
● Schutzstrukturen in den Nachbarschaften. ● Workshops zu digitaler Sicherheit u.a. |
● Aufbau von Nachbarschaftskommittees auf der Basis von Nafeer, politische Bewusstseinsbildung durch Aktivitäten in Nachbarschaften |
|
2018-2019: |
Religiös und ethnisch aufgeladene Militärdiktatur ● 11. April 2019 Revolution/ Putsch ● 5. Juli 2019: Zivil-militärische Übergangsregierung |
● Dez. 2018: Initialzündung landesweiter Großproteste: Schüler*innen und Studierende demonstrieren gegen steigende Brotpreise. ● Januar-April 2019: Großdemonstrationen in den Städten, koordiniert u.a. durch Dachgewerkschaftsverband ● April-Juni 2019: Sit-In auf dem Platz vor dem Militärhauptquartier ● 3. Juni 2019: Massaker der RSF beendet Sit-In ● Weitere große Demonstrationen folgen |
● »Bucket Boys« machen Tränengaspatronen auf Demos unschädlich ● April-Juni 2019: Sit-In-Schutz durch Straßensperren und Durchsuchungen durch »Türsteher*innen« am Eingang. ● Krankenstation auf dem Gelände. |
● April-Juni 2019: Sit-In wird von Geschäftsleuten, Communities und Diaspora mit Naturalien unterstützt. ● Menschen aus allen Landesteilen, aller Geschlechter und aller Schichten kommen zum Sit-in. ● Kulturelles Programm. ● Junge Menschen wechseln sich ab, Nachtschichten zu übernehmen. ● Solidarisierung, jedoch weiterhin auch Diskriminierung zwischen ethnischen Gruppen. |
|
2019-2021: |
Zivil-militärische Übergangsregierung |
● Fokus auf struktureller Veränderung und Teilhabe. ● Überregionaler Austausch zwischen Nachbarschaftskommitees. |
● Entstehung der »Emergency Response Rooms« (ERR) während der Covid-Krise, aufbauend auf den Nachbarschaftskommitees |
|
|
2021-2023: |
Militärregierung ● 25. Oktober 2021 Putsch |
● Rückkehr zum Widerstand, allerdings geschwächt. ● Entwicklung der Revolutionären Charta der Nachbarschafts-/Widerstandskommitees |
● Aufgreifen früherer Schutzstrategien |
● ERR/Kommitees arbeiten weiter |
|
Krieg seit 2023 |
Krieg zwischen SAF und RSF ● 15.4.23: Kriegsbeginn. Zusammenbruch öffentlicher Versorgung und internationaler Unterstützung. ● Flucht und Hunger führen zur größten humanitären Krise weltweit |
● Punktuell offener Protest gegen Krieg, der aber brutaler Repression von beiden Konfliktparteien begegnet. Erschwert durch humanitäre Krise und Zersplitterung durch Flucht. |
● Anonymisierter Protest gegen den Krieg; Fahnenflucht / Kriegsdienstvermeidungsstrategien ● Schutzstrategien der Versorgungsstrukturen: Z.B.: Frauen machen Besorgungen da Männer zwangsrekrutiert oder direkt umgebracht werden. |
● ERRs retten zahlreiche Menschenleben durch Katastrophenhilfe nach Luftangriffen, Organisation medizinischer Versorgung, und Fluchthilfe und Organisation von Straßenküchen. Außerdem bergen sie Tote und suchen Vermisste. ● Kollektive Beschaffung und Zubereitung von Essen spart Ressourcen (Treibstoff, Brennstoff) ● Psychosoziale Unterstützungsaktivitäten, z.B. von Frauen für Frauen ● Finanzielle Unterstützung durch Diaspora. |
Abb. 2: Übersicht über die Phasen der sudanesischen politischen Revolution 2018-2019, eigene Darstellung
Die »Nachbarschaftskommitees« waren und sind im Sudan eine zentrale Institution, in denen an Widerstand, Schutz und der Befriedigung verletzter Grundbedürfnisse gleichermaßen gearbeitet wird: „Sie waren von Anfang an politisch, aber die politischen Themen der Komitees gingen von den Bedürfnissen der Nachbarschaften aus. Und das ist eine Stärke.“ (Osman 2024)
Hierbei ist es hilfreich, auf lokalen kollektiven Konzepten und Praktiken wie »Nafeer« aufzubauen. In Gesellschaften des Globalen Nordens bedeutet das zunächst, neue angemessene Formen der Überwindung der Vereinzelung zu entwickeln und zu üben.
Diese Praktiken des Nafeer haben sich als sehr agil erwiesen: Obwohl sie den Krieg nicht verhindern konnten, sind sie täglich ein zentraler Überlebensfaktor für viele Tausende Menschen, die von internationaler humanitärer Hilfe nicht erreicht werden. Die lokale und überregionale basisdemokratische Organisierung der Komitees weist darüber hinaus auch hin zu neuen, beteiligungsstärkeren Gesellschaftsformen als wir sie im westlichen Modell der repräsentativen Wahldemokratien kennen.
Gegenseitige Fürsorge kann ein Lern- und Testfeld für die Inklusivität von Bewegungen sein und Räume für Machtteilung und neue, selbstbestimmte Strukturen schaffen. Dies bleibt jedoch nicht widerspruchsfrei. Es bleibt auch für solcherart gestaltete Bewegungen herausfordernd, interne Konflikte wie z.B. Diskriminierung, Unterwanderung oder Korruption zu bearbeiten. Die zunehmende Spaltung der sudanesischen sozialen Bewegungen nach den Verbrechen der Konfliktparteien gegen die Zivilgesellschaft in Sudan im vergangenen Jahr ist Zeichen und Ausdruck davon.
Die Erfahrung im Sudan hat zudem gezeigt, dass sich Menschen in Krisen oder Krieg nicht (gleichermaßen) auf internationale humanitäre Hilfe verlassen können, und eigene Strukturen wichtig sind. Dennoch ist internationale Solidarität in Form von finanzieller Unterstützung angesichts der Größe der Katastrophe im Sudan, aber auch in Form von Advocacy-Arbeit und gewaltfreien Aktionen, um Druck zu erzeugen, weiterhin notwendig. Die Diaspora spielte hier von Beginn an eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit zwischen Diaspora und solidarischen internationalen Gruppen und NGOs ist hier ein relevantes Lernfeld der Organisierung und Organisiertheit Sozialer Verteidigung.
In Bezug auf Deutschland und die EU ist Solidarität mehr als geboten: So hat z.B. die EU im Kontext des »Khartum-Abkommens« 2015 zur Flucht-Einschränkung nach Europa die RSF-Miliz gestärkt, die damals für Grenzschutz zuständig war, und somit zur Eskalation des Konflikts beigetragen. Deutschland sowie die EU kooperieren weiterhin eng mit regionalen und globalen Akteuren, die am Krieg im Sudan mit Waffenlieferungen, Söldnern und wirtschaftlichen Interessen beteiligt sind. Solange wir offensichtlich bislang weder bereit noch in der Lage sind, die Bewaffnung der Kriegsparteien von außen zu stoppen, dafür zu sorgen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, und globale Klimagerechtigkeit umzusetzen – ist es das Mindeste, Menschen nicht verhungern zu lassen.
Sich dieses Beispiels anzunehmen, praktische internationalistische Solidarität im Sinne »gegenseitiger Fürsorge« zu üben, kann auch heute schon ein Übungs- und Betätigungsfeld für Aktive in SV und ihre Strukturen sein, die langfristig und wirkungsvoll gemeinorientiert aufgebaut werden sollten – und viel von den Erfahrungen des Sudan lernen könnten.
Anmerkung
1) Dieses Wissen beruht auf eigenen und sekundären Zeugnissen sowie auf drei qualitativen leitfadengestützten Interviews mit sudanesischen Aktivist*innen in Berlin im August 2024.
Literatur
Osman, A. (2024): Sudan Dossier: The Neighbourhood Committees and the Revolutionary Charter. Interview, Migration Control.info Blog, 7.8.2024.
Spade, D. (2020): Mutual Aid. Building Solidarity During This Crisis (and the next). Verso, London, New York
Julia Kramer studierte Konfliktbearbeitung (M.A.) an der Universität Bradford und arbeitet seit etwa 20 Jahren an der Schnittstelle von ziviler Konflikttransformation, sozialen Bewegungen und ganzheitlicher Sicherheit für Menschenrechtsverteidiger*innen. Seit 2008 ist sie im Kontext Sudans tätig. Sie ist Teil der Steuerungsgruppe der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen«, und Ko-Geschäftsführerin des Bund für Soziale Verteidigung e.V.
Der Artikel beruht in weiten Teilen auf einem Beitrag zur Konferenz »Civilian-Based Defense Put to the Test« des IFGK, des BSV und der Kampagne Wehrhaft ohne Waffen vom September 2024.
Erfolgsbedingungen für Widerstand
Schlussfolgerungen für Soziale Verteidigung
von Jan Stehn
Die Ergebnisse der umfassenden empirischen Studie von Erica Chenoweth und Maria J. Stephan (2011) über gewaltfreien und gewaltsamen Widerstand zwischen 1900 und 2006 haben gezeigt: Es ist ein Mythos, dass Gewalt stets erfolgreicher sei als Gewaltfreiheit. Chenoweth war ursprünglich angetreten, aufgrund ihres Hintergrunds in Militärwissenschaften und als US-Offiziersanwärterin, zu beweisen, dass gewaltsamer Widerstand erfolgreicher sei. Aber ihre Auswertung, die sie später noch um die Jahre bis 2019 ergänzte (vgl. Chenoweth 2021), zeigt eindeutig: Die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs der Kampagnen ist bei gewaltfreiem Widerstand doppelt so hoch wie bei gewaltsamem Widerstand.
47 % der gewaltfreien Widerstandskampagnen waren im Zeitraum 1900-2019 erfolgreich, während es nur 23 % der gewaltsamen waren. 66 % der gewaltsamen Kampagnen sind gescheitert oder dauerten noch an, während nur 39 % der gewaltfreien Kampagnen gescheitert sind oder noch andauerten (vgl. Abb. 1 und 2).
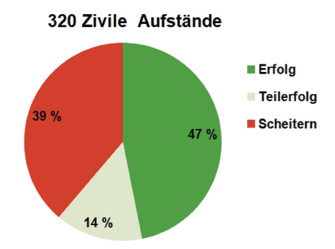
Abb. 1: Erfolgsquoten ziviler Aufstände
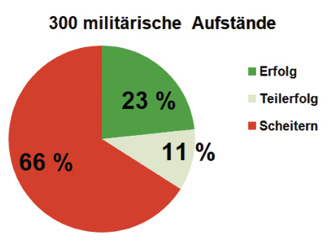
Abb. 2: Erfolgsquoten gewaltsamer/militärischer Aufstände
Diese Untersuchungen basieren auf der öffentlich zugänglichen Datenbank NAVCO1 mit weltweit mehr als 600 Widerstandskampagnen im Zeitraum 1900-2019. Die Ergebnisse der Autorinnen sind bis heute nicht widerlegt worden. Es gibt jedoch noch viele offene Forschungsfragen, die von mehr und mehr Wissenschaftler*innen aufgegriffen und vertiefend untersucht werden.2 Chenoweth selbst hat sich intensiver mit den Gründen für Erfolg und Misserfolg von gewaltfreien Kampagnen beschäftigt. Solche Bedingungen und Gründe sind für die Einübung jeder Sozialen Verteidigungsbemühung essentielles Wissen – daher sollen sie hier überblicksartig zusammengetragen werden.
Ausschlaggebende Faktoren
Massenbeteiligung als Erfolgsfaktor
Gemäß den Forschungen von Chenoweth und Stephan ist die Größe einer Bewegung entscheidend für den Erfolg: Eine hohe Beteiligung bedeutet hohe Legitimität (vgl. Tabelle 1). Die durchschnittliche Beteiligungsquote lag bei den gewaltfreien Bewegungen von 1900-2019 bei 1,6 % der Bevölkerung. Das ist viermal mehr als bei den bewaffneten Aufständen (0,4 %, siehe Chenoweth 2021, S. 95). Ein Grund für die sinkende Erfolgsrate des gewaltfreien Widerstandes ist ihren Forschungen nachin den letzten Jahren die geringere Beteiligung (ebd., S. 230).
|
Erfolg und Massenbeteiligung gewaltfreier Aufstände |
|||
|
90er |
00er |
10er |
|
|
Beteiligung in % der Gesamtbevökerung |
2,7 % |
1,6 % |
1,3 % |
|
Erfolgsscore |
74 % |
64 % |
55 % |
Tab. 1: Erfolgsfaktor Massenbeteiligung
Anmerkung: Beim Erfolgsscore wird Erfolg mit 1 und Teilerfolg mit 0,5 Punkten gewichtet.
Erica Chenoweth prägte in ihren Schriften die mittlerweile weit verbreitete und eingängige »3,5 %-Regel«, nach der eine Kampagne ihre Ziele dann mit übergroßer Wahrscheinlichkeit durchsetzen kann, wenn es gelingt, 3,5 % der Bevölkerung langfristig und kontinuierlich für Aktionen zu mobilisieren. Dabei ist davon auszugehen, dass es neben dieser aktiven Beteiligung ein großes zwar passives, aber doch unterstützendes Umfeld gibt. Bis auf zwei Ausnahmen waren alle 18 Bewegungen (im Untersuchungszeitraum 1945-2014) erfolgreich, die diese Größenordnung erreichten (ebd., S. 115ff.). Es gilt, die 3,5 %-Regel nicht zu überinterpretieren, und sie dennoch als motivierenden und relativ verlässlichen Faktor zu berücksichtigen.
Diversität als Erfolgsfaktor
Eine hohe Beteiligung aus möglichst breiten Teilen der Gesellschaft erhöht die Chance, in das Unterstützungsumfeld der Herrschaft hineinwirken zu können. Vor allem Gender-Diversität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Nur sehr wenige Kampagnen waren erfolgreich, wenn ihre vorderen Reihen von Männern dominiert wurden (ebd., S. 96ff.). Frauen haben Zugang zu unverzichtbaren sozialen Netzwerken und entwickeln häufig neue Aktionsformen und Taktiken. Aufgrund traditioneller Rollenbilder ist der »Backfire-Effekt«3 bei Gewalt gegen Frauen und bei öffentlich gezeigter Trauer von Frauen stärker.
Begleitende Gewalt als Faktor für Misserfolg
Chenoweth hat sich ausführlich mit den Argumenten auseinandergesetzt, ob begleitende Gewalt Widerstandskampagnen stärkt oder schwächt (vgl. ebd., S. 142ff.), und kommt zu folgenden Schlüssen:
- 80 % der großen gewaltfreien Bewegungen gegen Diktaturen (im Untersuchungszeitraum1945-2013) waren von geringer direkter Gewalt (z.B. Straßenkämpfen) begleitet. Immerhin 20 % waren konsequent gewaltfrei. Bei großen gewaltfreien Bewegungen mit reform-orientierten Zielen waren nur ein Viertel von »riots« (Unruhen) begleitet (ebd., S. 149).
- Gewaltfrei revolutionäre Bewegungen zwischen 1955 und 2018 wurden zu weniger als 40 % von bewaffneten Gruppen begleitet; bei reformorientierten gewaltfreien Bewegungen dagegen sehr selten. Bewaffnete Gruppen gewinnen manchmal Dominanz, wenn gewaltfreie Bewegungen aufgrund starker Repression weniger Beteiligung mobilisieren können. Solche Übergänge vom gewaltfreien zum bewaffneten Aufstand sind aber selten: Von 384 gewaltfreien Aufstände zwischen 1945-2013 mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen, eskalierten nur 13 (3 %) in einen militärischen Aufstand.
- Als ein Argument für militanten Widerstand wird häufig genannt, dass friedlicher Protest so besser geschützt werden könne gegen Staatsgewalt. Mehrere Studien belegen allerdings, dass der Staat auf Bewegungen, die von gewaltsamen Aktionen begleitet werden, mit einer Ausweitung von Menschenrechtsverletzungen, einschließlich tödlicher Repression, reagiert. Außerdem akzeptiert die Bevölkerung Menschenrechtsverletzungen vor allem, wenn sie gegen gewaltsame Akteure oder vorgeblich zur Eindämmung »krimineller« Gewalt gerichtet ist, aber weniger bei gewaltfreien Protesten (ebd., S. 164ff.).
- Von 1900-2019 waren 65 % der gewaltfreien Widerstandskampagnen ohne begleitende Gewalt erfolgreich. Bewegungen, die von Gewalt begleitet wurden, erreichten dagegen nur zu 35 % ihr Ziel. Als Ursachen sind zu konstatieren: Kampagnen mit begleitender Gewalt hatten eine um 17 % geringere Beteiligung und – wohl noch wesentlicher – beim Auftreten von Gewalt verringerte sich die Kampagne im Folgejahr. Verständlich, da das Risiko von Repressionen für die Teilnehmenden in einer eskalierten Situation wächst. So nimmt auch die Diversität der Beteiligung zumeist ab und das unterstützende Umfeld zieht sich zurück (ebd., S. 160ff.).
- Von 1930-2019 wurden 42 % von 321 gewaltfreien Widerstandskampagnen von Gewalt begleitet. Diese Quote sank nach dem Zweiten Weltkrieg auf ein niedriges Niveau von 30 % in den 1970er und 1980er Jahren und stieg im letzten Jahrzehnt bis 2019 erneut auf über 50 % an. Dies ist laut Chenoweth auch ein Grund für den abnehmenden Erfolg der gewaltfreien Kampagnen, schließlich polarisiert Gewalt und Polarisierung führt tendenziell zu weiterer Gewalteskalation (ebd., S. 232).
- Gewaltfreie Kampagnen mit begleitender Gewalt haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in einen Bürgerkrieg zu führen, sogar noch Jahre nachdem der Konflikt sich (scheinbar) gelegt hatte. Noch mehr: Die Entwicklung von autoritären Regimen ist wahrscheinlicher (ebd., S. 169).
Organisations- und Strategieentwicklung notwendig für Erfolg
Die aktuellen Widerstandskampagnen (der 2010er Jahre) tendieren laut Chenoweth dazu, vor allem auf Massendemonstrationen zu setzen und vernachlässigen den Aufbau von nachhaltigen Organisations- und Bündnisstrukturen. Chenoweth sieht das Internet als gefährliche Versuchung einer schnellen, aber wenig nachhaltigen Mobilisierung (sogenannte »führerlose Mobilisierung« über das Internet). Denn internetbasierte Bewegungen können seitens des Gegners leichter kontrolliert und manipuliert werden. Durch die Konzentration auf Massendemonstrationen in den Zentren werden zudem andere Formen der massenhaften Nichtzusammenarbeit wie Generalstreiks, Boykotte etc. vernachlässigt. Die Entwicklung einer längerfristigen Kampagnenstrategie kommt hier zu kurz (ebd., S. 231).
Was lernen wir daraus für Soziale Verteidigung?
Zunächst ist zu konstatieren, dass nicht alle Fälle gewaltfreier Widerstandskampagnen der klassischen Definition von Sozialer Verteidigung entsprechen: Soziale Verteidigung richtet sich gegen den Versuch, eine neue Herrschaft zu etablieren (Einfall von außen oder Putsch von innen). Gewaltfreie Aufstände richten sich in der Regel gegen (langjährig) etablierte Herrschaftssysteme. Sowohl Soziale Verteidigung als auch gewaltfreie Aufstände richten sich gegen Herrschaft oder Herrschaftsstrukturen, die nicht als legitim anerkannt werden. Beispiele für Soziale Verteidigung finden sich daher auch in der NAVCO-Datenbank.
Es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten: Beide müssen mit massiver Repression rechnen und sich dagegen behaupten. Beide können sowohl spontan als auch vorbereitet beginnen.
Ein wichtiger Unterschied: Bei einem Angriff von außen hat es Soziale Verteidigung mit einem externen Aggressor zu tun, dessen Machtbasis überwiegend im Herkunftsland verwurzelt ist. Hier kommen oft Sprach- und Kommunikationsbarrieren als zusätzliche Herausforderung hinzu. Entsprechend sind internationale Politik und Solidarität wichtige Faktoren in diesem Angriffsszenario (vgl. auch Kramer in diesem Dossier, S. 23). Solche Fälle eines Angriffs von außen sind nur ein begrenzter Anteil in der Gesamtzahl der in der NAVCO-Datenbank dokumentierten Fälle. Mögliche Schlussfolgerungen als Handlungsempfehlungen, die sich aus den Untersuchungen zu Zivilem Widerstand ergeben, habe ich in der nebenstehenden Übersicht zusammengefügt (vgl. Handlungsempfehlungen) – in der Hoffnung, dass sie informierte Praktiken Sozialer Verteidigung ermöglichen mögen.
Handlungsempfehlungen für erfolgreiche Soziale Verteidigung
Aus den Ergebnissen der Chenoweth-Studie lassen sich dennoch folgende Erkenntnisse für Soziale Verteidigung ableiten:
- Je mehr Menschen sich aktiv am Protest und Widerstand beteiligen, desto mehr wird der Herrschaftsanspruch des Aggressors delegitimiert oder gar dessen Herrschaftsausübung verhindert.
- Je vielfältiger die gesellschaftlichen Gruppen (Frauen, religiöse Vertreter*innen, Gewerkschaften, Migrant*innen, und mehr) sind, die sich an der SV beteiligen, desto stärker ergänzen sich deren jeweiligen sozialen Stärken (z.B. hinsichtlich Status, internationale Wahrnehmung, Schutzbedürftigkeit).
- Auf den unterschiedlichen Ebenen (lokal, regional, national, international) sollten arbeits- und entscheidungsfähige, vernetzte und resiliente Führungsstrukturen etabliert werden.
- Interne Widersprüche in gemeinsamen Bündnissen sollten zugunsten des gemeinsamen Befreiungszieles zurückgestellt werden.
- Es braucht eine resiliente, dezentrale, solidarische Grundversorgung der Bevölkerung (Lebensmittel, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Einkommen, Kommunikation) durch den Widerstand.
- Konsequente Gewaltfreiheit vermindert das Eskalationsrisiko und ermöglicht bei Repression den Backfire-Effekt. Falls konsequente Gewaltfreiheit nicht möglich ist, dann sollte es zumindest organisatorisch, räumlich und zeitlich eine Trennung zwischen gewaltfreien und gewaltsamen Widerstandsaktionen geben.
- Es braucht eine kreative und flexible Aktionsstrategie, die das ganze Spektrum gewaltfreier Aktionen berücksichtigt und in der Lage ist, die »Kosten« des Widerstandes (hinsichtlich Aufwand und Repression) klein zu halten, bei gleichzeitig starker Wirkung auf den Aggressor und dessen Umfeld, stärkend für den Widerstand und dessen Umfeld und mit positiver Ausstrahlung auf die internationale Öffentlichkeit.
- Es braucht eine Kommunikations- und Widerstandsstrategie, die darauf zielt, die Besatzungskräfte in ihrer Legitimation zu verunsichern, so dass diese passiv-abwartend, ohne eigenen Antrieb agieren und im besten Falle Befehle verweigern und sich dem Widerstand anschließen.
- Es braucht eine hohe Kommunikationskompetenz, mit der emotional, überzeugend und glaubwürdig das Bild eines legitimen, klugen, und kraftvollen gewaltfreien Widerstands gegen den Aggressor vermittelt wird.
- Die eigenen Kommunikationskanäle müssen gesichert und geschützt werden.
- Propaganda und Desinformation müssen überzeugende Faktenchecks entgegensetzt werden können.
- Es gilt die Solidarität im Land des Aggressors zu gewinnen und so dort dessen Machtbasis zu untergraben.
- Es gilt auf internationaler Bühne Unterstützung und Solidarität zu organisieren.
- Es ist förderlich, dem Aggressor ein positives Angebot für den Fall seines Rückzuges zu machen, so dass dieser sein Gesicht wahren kann.
Anmerkungen
1) Die Datenbanken sind öffentlich einsehbar auf der Homepage der Universität Harvard unter: Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) data project. Online: dataverse.harvard.edu/dataverse/navco.
2) Für einen Überblick über diese Kritiken, Erweiterungen und neuen Datenbanken vgl. Nennstiel 2024.
3) Vom Backfire-Effekt wird gesprochen, wenn Repression gegen den Widerstand zu Empörung und Ausweitung der Mobilisierung führt und so das Gegenteil von dem bewirkt, was ursprünglich erreicht werden sollte (Zerschlagung und Einschüchterung der Bewegung).
Literatur
Chenoweth, E.; Stephan, M.J. (2011): Why civil resistance works: the strategic logic of nonviolent conflict. New York: Columbia University Press.
Chenoweth, E. (2021): Civil Resistance. What Everyone Needs To Know. London: Routledge.
Nennstiel, J. (2024): Jenseits von NAVCO. Neue Datensätze zu zivilem Widerstand. W&F 3/2024, S. 12-15.
Jan Stehn ist Friedens- und Bewegungsforscher. Er hat bei der Gründung der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen“ mitgewirkt und ist Mitglied im Bund für Soziale Verteidigung e.V.
Aktiv werden!
Du willst bei der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« mitwirken und Soziale Verteidigung als Alternative bekannter machen und mit Leben füllen?
So kannst du als Einzelperson, ihr als Initiative, Gruppe oder Organisation aktiv werden:
- Du kannst einen Vortrag oder Workshop bei dir vor Ort organisieren – und so auch andere Interessierte finden. Wir können dir Referent*innen vermitteln und dich beraten, welche Veranstaltungsformate wir anbieten!
- Du kannst eine Regionalgruppe gründen und weitere Veranstaltungen organisieren oder in Austausch mit anderen Menschen und Gruppen gehen – je nach eurem Fokus andere Friedensbewegte oder sozial-ökologische Transformationsprojekte oder lokale Politiker*innen. Wir haben ein Starter Paket für neue Regionalgruppen und Modellregionen erstellt, dass euch gerne zur Inspiration schicken!
- Du kannst dich einer Regionalgruppe oder Modellregion anschließen und dort mitarbeiten. Wir haben auf unserer Webseite eine Karte mit allen Gruppen, die es schon gibt, und deren Kontaktadressen!
- Du kannst dich auch thematisch einbringen und in einer Arbeitsgruppe mitmachen. Es gibt z.B. AGs zur Bildungs- oder Öffentlichkeitsarbeit. Melde dich und wir vermitteln dir den Kontakt!
- Du kannst dich als Einzelperson oder Organisation unserer Kampagne als Mitglied anschließen. Lies unseren Sachkonsens! Wenn du dem zustimmen kannst, dann nehmen wir dich gerne in den sogenannten Initiativkreis der Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« auf.
- Du kannst dich zeitlich nicht so sehr einbringen, möchtest uns aber finanziell unterstützen. Wir sind auf Spenden für Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« angewiesen!
- Du kannst erstmal »reinschnuppern«, dich informieren oder einfach auf dem Laufenden bleiben. Schau dich auf unserer Webseite um und abonniere dort unseren Newsletter, um regelmäßig über Termine, Aktionen, Veranstaltungen und neues Material informiert zu werden!
Webseite der Kampagne: www.wehrhaft-ohne-waffen.de
Kontakt zur Kampagne: info@wehrhaftohnewaffen.de
Ansprechperson bei Fragen, Anregungen und Anliegen:
Jochen Neumann (Kampagnenkoordination)
Impressum
Herausgeber: Bund für Soziale Verteidigung e.V. und Informationsstelle Wissenschaft und Frieden e.V. (IWIF)
Mit Unterstützung der Bewegungsstiftung

und der Bertha-von-Suttner-Stiftung der DFG-VK

V.i.S.d.P.: David Scheuing
redaktion@wissenschaft-und-frieden.de
Erscheint als Beilage der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden 3/2025
Bestellungen an:
Wissenschaft und Frieden,
Palanterstr. 55, 50937 Köln,
E-Mail:
bestellung@wissenschaft-und-frieden.de,
Webseite: wissenschaft-und-frieden.de
Satz und Layout: EP Knaab, Marburg
Druck: Häuser Druck, Köln
Preis: 2,- € (zzgl. Versand)
Bildnachweis:
Titel, S. 7 und 9: Kampagne Wehrhaft ohne Waffen | S. 5: Ninjastrikers via Wikimedia Commons, 9.2.2021 | S. 13: REFO Moabit | S. 17: Bündnis 90 / Die Grünen Nordrhein-Westfalen via flickr, »Trecker Power«, 6.11.2010 | S. 21: © Georg Lukas, 7.7.2025 | S. 22 RAA Verein NRW e.V. u.a. | S. 25: Julia Kramer | sofern nicht anders angegeben, für alle Bilder: CC-BY-SA.