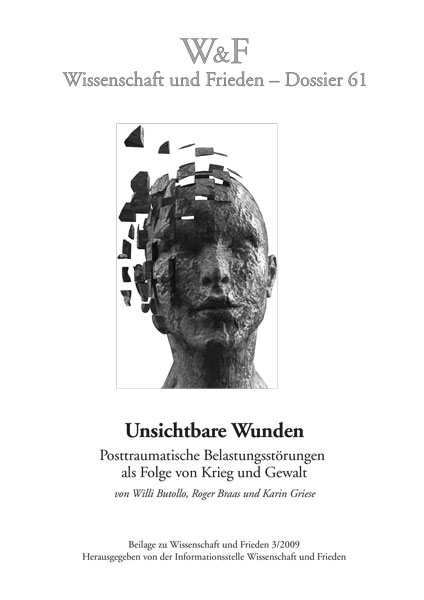Unsichtbare Wunden
Posttraumatische Belastungsstörungen als Folge von Krieg und Gewalt
von Fabian Virchow, Willi Butollo, Roger Braas und Karin Griese
Beilage zu Wissenschaft und Frieden 3/2009
Herausgegeben von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden
»Sprechen über PTBS«
von Fabian Virchow
Sprechen über PTBS – so überschrieb das Monatsmagazin des Deutschen BundeswehrVerbandes im Juni einen Beitrag über „einsatzbedingte psychische Störungen bei Soldaten“ und konzedierte, dass dieses Problem in den letzten Monaten verstärkt öffentlich wahrgenommen und diskutiert würde.1 Dass unter den SoldatInnen Unzufriedenheit über die von der Bundeswehr angebotene medizinische Betreuung in Sachen »Posttraumatische Belastungsstörung« (PTBS bzw. engl. PTSD/Post-Traumatic Stress Disorder) herrscht, ging aus einem kurz darauf veröffentlichten Beitrag hervor: „So müssten sich eigentlich 40 Bundeswehr-Ärzte um das Problem kümmern, es seien jedoch nur 22 Stellen besetzt. Am Einsatzort sei es fast unmöglich, kompetente Ansprechpartner zu finden“.2 Aufgrund dieser Situation sei die Gefahr einer (zu) späten Diagnostizierung gegeben.
Die Bundeswehr sieht sich im Zuge der Umwandlung der Bundeswehr zu einer »Armee im Einsatz« auch mit einer wachsenden Zahl von Todesfällen oder kriegsbedingten Erkrankungen in den eigenen Reihen konfrontiert. Zu letzteren zählt die PTBS/PTSD „als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“.3 PTBS/PTSD umfasst verschiedene psychische bzw. psychosomatische Symptome, die chronisch werden können oder als Trauma relevant werden. PTBS/PTSD tritt nicht nur als Folge von Kriegshandlungen auf, sondern insbesondere in Verbindung mit tief in die Persönlichkeit des betroffenen Individuums eingreifenden Gewalterfahrungen, z.B. bei KZ-Häftlingen oder in Fällen sexualisierter Gewalt. Im Unterschied zur akuten Belastungsreaktion spricht man von PTBS/PTSD ab einer Dauer von einem Monat.
Die PTBS/PTSD-Symptome wurden bereits früh vom Freud-Schüler Abram Kardiner aufgeführt4; zu diesen gehört das wiederholte Erleben des Traumas mit Gefühlen extremer Angst, von Entsetzen und Hilflosigkeit. PTBS/PTSD wird erlebt als Gefühl des Betäubtseins und emotionale Abstumpfung bzw. Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit gegenüber der Umwelt. Häufig kommt es auch zu übermäßiger Schreckhaftigkeit und Schlafstörung sowie zu Depressionen, die bis zu Suizidgedanken reichen. In manchen Fällen chronifiziert sich die Störung und geht in andauernde Persönlichkeitsveränderungen über. Als Diagnose fand PTBS/PTSD erstmals 1980 Eingang in das international relevante, von der American Psychiatric Association (APA) herausgegebene Diagnose-Handbuch DSM III (aktuelle Fassung: DSM IV), wo es unter 309.81 als Form der Angststörung aufgeführt wird.
In der Forschung sind Risikofaktoren identifiziert worden, die einzeln oder in Kombination das Auftreten von PTBS/PTSD wahrscheinlichkeitstheoretisch begünstigen; als prätraumatische Risikofaktoren liegen diese zeitlich vor dem traumatischen Ereignis (z.B. bereits existierende psychische Probleme, sozial Isolation, Aufwachsen in Armut, soziale Marginalisierung, Dissozialität eines Elternteils, autoritäres elterliches Verhalten).5 Die Risikofaktoren können jedoch auch in der traumatischen Erfahrung selbst begründet sein oder als posttraumatische Risikofaktoren auftreten.
Vom »Kriegszitterer« zu PTSB/PTSD
Auch wenn PTBS/PTSD erst im Jahr 1980 als klinischer Zustand offiziell anerkannt wurde, gab es für das Krankheitsbild bereits in den früh(er)en Kriegen des 20. Jahrhunderts die Bezeichnung »Kriegsneurose« (»shell shock«). Als »Kriegszitterer« wurden jene Soldaten des Ersten Weltkriegs bezeichnet, die von schwerem Schüttelfrost gebeutelt wurden. Während für die Erkrankung die spezifische Konstellation eines lang andauernden Stellungs- und Grabenkrieges mit massivem Granatbeschuss verantwortlich gemacht werden kann6, wurden die betroffenen Soldaten – erleichtert durch die Vielzahl der auftretenden Krankheitsbilder, die sich nicht auf Bewegungsstörungen beschränkten – häufig als »Drückeberger« denunziert. Entsprechend sollten die Soldaten mit Eiswasserergüssen, wochenlangen Isolationsfoltern oder Elektroschocks zur Räson gebracht (»behandelt«) werden. Die Methode der Faradisation mittels elektrischer Ströme trat dabei in den Vordergrund: die betroffenen Soldaten erhielten Elektroschocks, denen sich militärische Kommandos anschlossen bis sie die Flucht aus der Krankheit in die Gesundheit antraten und »freiwillig« an die Front zurückkehrten.7 Auch mit anderen Methoden wie Hypnose konnte die sogenannte »Frontfähigkeit« nur in wenigen Fällen wieder hergestellt werden. Daher lag das Interesse des Kriegsministeriums bald beim Bemühen, die Erkrankten wieder arbeitsfähig zu machen – etwa in den rückwärtigen Munitionsfabriken –, um die mit etwaigen Rentenansprüchen verbundenen ökonomischen Kosten möglichst gering zu halten. Hinsichtlich der sogenannten »Kriegsneurosen« in Deutschland während und nach dem Ersten Weltkrieg war sich die deutsche Kriegspsychiatrie mit der großen Mehrheit der bürgerlichen Intelligenz, des Offizierskorps und der Generalität darin einig, der vermuteten kontraselektorischen Auswahl des Krieges gegenzusteuern.
Mit den ersten militärischen Niederlagen der Nazi-Wehrmacht stellten sich erneut spezifische »Kriegsneurosen« ein; die Häufung von Übelkeit und Erbrechen führte zur Aufstellung sogenannter »Magenbataillone«. Quasi in Radikalisierung der bereits im Ersten Weltkrieg anzutreffenden starken Tendenz der Kriminalisierung kriegsneurotischer Patienten8 bemühten sich Militärpsychiatrie und eine rücksichtslose Kriegsgerichtsbarkeit darum, dass die Angst vor Bestrafung größer war als die Angst vor dem Krieg.9
Nach Schätzungen des dem US-Amt für Veteranen-Angelegenheiten zugeordneten » National Center for Post-Traumatic Stress Disorder« (http://www.ncptsd.va.gov/ncmain/index.jsp) litt jeder Zwanzigste der US-Soldaten des Zweiten Weltkrieges an PTBS/PTSD-Symptomen; noch im Jahr 2004 erhielten 25.000 Veteranen dieses Krieges Kompensationszahlungen wegen PTBS/PTSD-Erkrankungen. Aus einer Zusammenstellung verschiedener Studien durch den »San Francisco Chronicle« ergeben sich für den Vietnam-Krieg, die Golfkriege 1991 und 2003 sowie den Krieg in Afghanistan folgende Zahlen zum Auftreten von PTBS/PTSD bei US-amerikanischen SoldatInnen10:
bei 15,2% der eingesetzten männlichen und 8,1% der weiblichen Vietnam-SoldatInnen (479.000 bzw. 610) wurden PTBS/PTSD-Symptome festgestellt;
34% aller männlichen Vietnamkriegsteilnehmer waren nach ihrer Rückkehr mehr als einmal inhaftiert; 11,5% wurden wegen schwerer Verbrechen verurteilt;
im Jahr 2004 erhielten noch 161.000 Vietnam-Veteranen Kompensationen wegen Berufsunfähigkeit;
nach dem Golfkrieg 1991 zeigten 3% der Männer und 8% der Frauen unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Einsatz PTBS/PTSD-Symptome; deren Zahl stieg auf 7% bzw. 16% in der Zeitspanne von 18 bis 24 Monaten nach Rückkehr;
von 45.880 ehemals in Afghanistan eingesetzten SoldatInnen zeigten 18% psychologische Auffälligkeiten, darunter 183 Personen mit PTBS/PTSD-Symptomen;
nach dem Irak-Krieg 2003 zeigten 20% der 168.528 VeteranInnen psychologische Fehlsteuerungen, darunter 1.641 mit PTBS/PTSD (Veterans Affairs); eine vorhergehende Untersuchung kam zum Ergebnis, dass 12.500 von knapp 245.000 VeteranInnen Beratungszentren zur Behandlung entsprechender Probleme aufgesucht hatten; aufgrund der stärkeren Beteiligung an Kampfhandlungen waren SoldatInnen der Marines und des Heeres viermal öfter von PTBS/PTSD betroffen als andere Truppenteile;
60% der Irak-SoldatInnen aus Kampfeinheiten, die ernsthafte Symptome wie schwere Depression und PTBS/PTSD zeigten, vermieden es, sich medizinischer Betreuung anzuvertrauen, weil sie befürchteten, sie würden von den Kommandeuren und ihren Kameraden dann anders behandelt.
Mit Blick auf die beiden Kriegseinsätze im Irak und in Afghanistan drückt der Mitarbeiter des »Boston Veterans Affairs Healthcare System« Brett T. Litz seine Besorgnis aus: da zahlreiche Studien gezeigt hätten, dass die Häufigkeit und die Intensität der Teilnahme an Kampfhandlungen linear korreliert mit dem Risiko chronischer PTBS/PTSD-Erkrankung und in beiden Ländern die seit langem stärksten Kämpfe mit US-Beteiligung stattfänden, gäbe es Grund zur Annahme, dass eine neue Generation von PTBS/PTSD-geschädigten VeteranInnen entstehe.11
Deutschland
Die Zahl der soldatischen PTBS/PTSD-Erkrankungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen: der Wehrbeauftragte spricht – unter Hinweis auf eine zusätzliche hohe Dunkelziffer – von einer Verdreifachung der Fälle vom Jahr 2006 (83) bis zum Jahr 2008 (245), wobei die große Mehrzahl in Verbindung mit dem ISAF-Einsatz aufgetreten sei.12 Die Bundeswehr widmet dem Problem vermehrt Aufmerksamkeit13 und das Thema – einschließlich der auch wissenschaftlich belegten zerstörerischen Auswirkungen, die PTBS/PTSD auf das familiäre Umfeld von SoldatInnen haben kann14 – ist inzwischen Gegenstand populärkultureller Fernsehproduktionen wie etwa in dem Film »Nacht vor Augen«, der von Seiten der Bundeswehr für seine realistische Darstellung gelobt wurde. Einen Anlass dazu, die zerstörerische Wirkung des Krieges auch auf jene, die an ihm aktiv beteiligt sind, ganz grundsätzlich zu überdenken, sehen die politisch und militärisch Verantwortlichen offenbar nicht. Wird man von der Bundeswehr also keine grundsätzlich kritische Auseinandersetzung mit der durch Krieg erzeugten Brutalisierung erwarten können, so erstaunt doch, dass angesichts der vorliegenden Forschungsergebnisse zu den Ursachen und Kontextvariablen von PTBS/PTSD die Anforderungen an zukünftige BundeswehrsoldatInnen hinsichtlich ihrer Stressresistenz abgesenkt wurden.
Anmerkungen
1) Sprechen über PTBS, in: Die Bundeswehr 6/2009, S.65.
2) PTBS – Es muss noch einiges getan werden, in: Die Bundeswehr 7/2009, S.39.
3) Klassifikation »Posttraumatische Belastungsstörung« nach ICD10 F43.1; die ICD 10 ist die von der WHO erstellte internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.
4) Vgl. Theo Meißel (2006): Freud, die Wiener Psychiatrie und die »Kriegszitterer« des Ersten Weltkrieges, in: Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit Heft 1: 40-56.
5) Vgl. Gottfried Fischer & Peter Riedesser (2003): Lehrbuch der Psychotraumatologie, Stuttgart, S.148; Jennifer L. Price (2004): Findings from the National Vietnam Veterans‘ Readjustment Study – Factsheet. National Center for PTSD; Gina P. Owens et al. (2009): The Relationship Between Childhood Trauma, Combat Exposure, and Posttraumatic Stress Disorder in Male Veterans, in: Military Psychology 21(1): 114-125.
6) Peter Leese (2002): Shell Shock: Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War, Basingstoke.
7) Vgl. die Dissertation von Frank Heinz Lembach mit dem Titel »Die ‚Kriegsneurose‘ in deutschsprachigen Fachzeitschriften der Psychiatrie und Neurologie von 1889-1922« (Universität Heidelberg) sowie Paul Lerner (2003): Hysterical men: war, psychiatry, and the politics of trauma in Germany, 1890-1930, Ithaca, N.Y.
8) Peter Riedesser & Axel Verderber (1985): Aufrüstung der Seelen: Militärpsychiatrie und Militärpsychologie in Deutschland und Amerika, Freiburg i. Br.
9) Klaus Blaßneck (2000): Militärpsychiatrie im Nationalsozialismus. Kriegsneurotiker im Zweiten Weltkrieg, Baden-Baden; Roland Müller (2001): Wege zum Ruhm: Militärpsychiatrie im Zweiten Weltkrieg. Das Beispiel Marburg. Köln.
10) Jack Epstein & Johnny Miller (2005): U.S. wars and post-traumatic stress disorder, in: San Francisco Chronicle vom 22.06.2005, URL: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2005/06/22/MNGJ7DCKR71.DTL&type=health
11) Brett T. Litz (2007): Research on the Impact of Military Trauma: Current Status and Future Directions, in: Military Psychology 19(3): 217-238.
12) Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 2008, BT-Drucksache 16/220, S.46.
13) Vgl. auch die entsprechenden Beiträge von Klaus M. Barre und Karl-Heinz Biesold im Band von Klaus J. Puzicha et al. (2001): Psychologie für Einsatz und Notfall, Bonn.
14) Jeffrey I. Gold et al. (2007): PTSD Symptom Severity and Family Adjustment Among Female Vietnam Veterans, in: Military Psychology 19(2): 71-81.
Wissenschaftliche Grundlagen der Posttraumatischen Belastungsstörung
von Willi Butollo
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS oder PTSD für »Posttraumatic Stress Disorder«) ist eine extreme Reaktion auf eine ebenso extreme Belastung. Die Betroffenen entwickeln starke Ängste, vermeiden i.B. Situationen, die an das Schreckerlebnis erinnern. Die Diagnose der PTBS wurde 1980 in das Diagnosemanual der American Psychiatric Association, das DSM-III, aufgenommen (APA, 1980) und fand als diagnostische Kategorie 1992 Eingang in das europäische Pendant, das ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1992). Während zuvor also keine explizite Übereinkunft in Forschung und Praxis hinsichtlich der Definition einer traumabedingten Störung bestand, ermöglichte dies nun die Vergabe einer entsprechenden Diagnose und stimulierte damit die Darstellung und Erforschung dieses Störungsbereiches ungemein.
»Entwicklungsgeschichte«
Natürlich war schon vor der offiziellen Einführung der Posttraumatischen Belastungsstörung als eigenständige diagnostische Kategorie bekannt, dass und wie sich katastrophale Ereignisse auf die Psyche auswirken können. Die moderne »Entwicklungsgeschichte« der PTBS beginnt im ausgehenden 19. Jahrhundert mit Beschreibungen über nervöse Syndrome nach Zugunglücken und Erdbeben und bei Soldaten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind hier die grundlegenden Arbeiten zur Hysterie zu nennen, z.B. durch Charcot (1887 – »choc nerveux«), Janet (1889) und natürlich auch durch Freud (1896/1977). Die phänomenologischen Parallelen zwischen diesen unterschiedlichen Patientengruppen, nämlich den meist weiblichen hysterischen Patienten, dann den auf Schadenersatz klagenden Unfallopfern und schließlich den so genannten »Kriegszitterern« waren nicht zu übersehen. Nicht zuletzt angesichts der mit der Zunahme solcher Diagnosen verbundenen gesellschaftlichen Kosten entbrannte bereits um die Jahrhundertwende eine rege Diskussion zur Verursachung der »traumatischen Neurose«. Den Begriff prägte der deutsche Neurologe Oppenheim, der die Symptomatik als organische Folge einer tiefgreifenden Erschütterung des zentralen Nervensystems betrachtete. Lag also eine organisch-neurologische Erschütterung zu Grunde, wie es die Konzepte des »railroad spine« im zivilen oder des »shell shock« im militärischen Bereich vertraten? Wieso traf das Syndrom aber nicht alle gleichermaßen und wieso zeigten manche Soldaten die Symptomatik, obwohl sie gar nicht in der Nähe einer Explosion gewesen waren? Gab es konstitutionelle Prädispositionen, lag eine Schwäche der Persönlichkeit vor oder waren manche der Betroffenen sogar Simulanten, die auf Freistellung vom Fronteinsatz, Schadenersatzzahlungen oder Rente hofften? In Deutschland entwickelte sich dazu eine denkwürdige Fachdiskussion, die sich in dem vielzitierten Diktum »Das Gesetz ist die Ursache der Unfallneurosen« zusammenfassen lässt. So schreibt der Psychiater Bonhoeffer (1926, S.180): „Es handelt sich gar nicht um einen Krankheitsvorgang im eigentlichen Sinn, sondern um eine in letzter Instanz psychologisch bedingte Reaktion, die eintritt bei bestimmten Wünschen und Begehrungen und die fortfällt bei deren Wegfall.“ Und sein Kollege His (1926, S.185) fordert im selben Fachblatt eine entsprechende Anpassung in der damaligen Reichsversicherungsordnung (RVO), um der traumatischen Neurosen Herr zu werden, die sich „gleich einer Infektion“ ausbreiten. Dies prägte nicht nur den Umgang mit den Unfall- und Kriegsversehrten dieser Zeit, sondern später auch den bundesdeutschen Umgang mit Opfern nationalsozialistischer Verfolgung (Fischer-Hübner & Fischer-Hübner, 1990).
Nach Weisæth (2002 – zit. nach Butollo & Hagel, 2003) spielte es in der weiteren Forschung zu Traumafolgen eine maßgebliche Rolle, welche spezifischen Erfahrungen die einzelnen Länder im Zweiten Weltkrieg machten. So konzentrierten sich US-amerikanische Veröffentlichungen auf die Folgen von Kampfeinsätzen und Kriegsgefangenschaft, während sich z.B. britische Untersuchungen auch mit den Folgen der Bombardierungen ziviler Städte beschäftigten. Die vergleichsweise geringe Zahl deutschsprachiger Veröffentlichungen zu den Folgen des Zweiten Weltkrieges in der Nachkriegszeit lässt Weisæth unkommentiert. In persönlichen Gesprächen (Anmerkung des Verfassers, 1996) wies er jedoch auf die bedauernswerte Unterversorgung deutscher Kriegsheimkehrer hin, die als »Kriegsverlierer« und »Aggressoren« sowohl im Nachkriegs-geschüttelten Inland wie auch aus dem Ausland nicht die Anerkennung ihrer Leiden erfuhren, die zu deren Linderung bitter nötig gewesen wären.
Die Aufnahme der Diagnose »Posttraumatic Stress Disorder« in das Manual der APA und deren Übernahme durch die WHO kann in mehrerer Hinsicht als politisch betrachtet werden: Die gesellschaftlichen Kosten staatlicher Gewalt (Krieg und Diktatur) und der Gewalt in den Familien und auf den Straßen konnten nicht länger in dem Maße tabuisiert werden, wie das bisher der Fall gewesen war und ebenso wenig die gesellschaftlichen Kosten des Fortschritts (ökologische und technische Katastrophen, z.B. Staudammbrüche oder Industrieunglücke). Zugleich wurde in einer Zeit, als sich vor allem die US-amerikanische Psychiatrie bemühte, psychische Störungen möglichst nur phänomenologisch zu beschreiben, um das unscharfe Konzept der neurotischen Verursachung zu verlassen, ein Störungsbild in das DSM aufgenommen, das explizit mit einem festgeschriebenen persönlichkeitsunabhängigen ätiologischen Moment konzipiert wurde, nämlich dem traumatischen Ereignis als Auslöser.
So spielte bei kaum einer anderen psychischen Störung das jeweilige gesellschaftliche Klima eine derart entscheidende Rolle für deren Interpretation, wie dies bei der PTBS der Fall ist, und auch die heutige Diskussion ist geprägt von den immer gleichen Fragen:
1. Werden die Symptome in der Hauptsache durch die vorausgehenden Stressoren verursacht? 2. Oder handelt es sich bei posttraumatischen Stresserkrankungen um den Ausdruck individueller Vulnerabilität, so dass der traumatische Stressor eher als auslösender Faktor für eine bereits angelegte Pathologie verstanden werden kann? Die Annahme, dass es die Empfindlichkeit der Opfer sei, die zu ihren stressbedingten Symptomen führte, kann erklären, wieso Individuen so unterschiedlich auf ähnliche traumatische Erfahrungen reagierten und viele symptomfrei bleiben.
3. Damit unmittelbar verbunden ist die Frage, wer im Falle des zugefügten Leides die Kosten für die daraus resultierende psychische Störung übernimmt. Gemäß dem Verursacherprinzip können Versicherungen, wie auch Privatpersonen in solchen Fällen belangt werden, wo ein Verursacher zu finden ist. Und Patienten finden sich in einer Situation wieder, in der sie die Herkunft ihres Leidens belegen müssen (siehe auch Butollo & Hagl, 2003; Hagl, 2008).
Kriterien und Befunde
Um die Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung, PTBS (bzw. PTSD) stellen zu können, muss zuerst einmal das »Ereigniskriterium« (Kriterium A) erfüllt sein, eine oder mehrere traumatische Erfahrungen, die direkt erlebt oder beobachtet wurden und zu intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen geführt haben. Weiters müssen die sogenannten Leitsymptome vorhanden sein: Mindestens ein Symptom des Wiedererlebens (Kriterium B), drei Symptome des Rückzugs- oder Vermeidungsverhaltens (Kriterium C) und zwei Symptome der Übererregung (Kriterium D). Außerdem muss das Störungsbild länger als einen Monat anhalten (Kriterium E) und in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Dysfunktionalität beinhalten (Kriterium F). Die Bedingungen, unter denen eine PTBS nach DSM-IV als Diagnose vergeben werden kann, sind also recht genau festgelegt. Im Gegensatz zum DSM-IV ist die Operationalisierung in der ICD-10 weniger restriktiv. Die Betonung der intrusiven Symptomatik als Kardinalssymptom, die im ICD-10 enthalten ist, hat zur Folge, dass eine Person, die kein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten zeigt oder keine deutlichen Anzeichen eines erhöhten Erregungsniveaus, gemäß ICD-10 trotzdem die Diagnose PTBS erhalten kann.
Die Prävalenz der PTBS hängt zunächst naturgemäß von der Häufigkeit potentiell traumatisierender Ereignisse ab. Diese ist je nach Ort, Zeit und Bevölkerungsgruppe unterschiedlich. In einem politisch instabilen Land mit hoher Straßenkriminalität, das an bewaffneten Konflikten mit anderen Nationen teilnimmt, ist das Risiko besonders hoch, ein traumatisches Erlebnis zu erfahren – und zwar vor allem für junge Männer. In einem stabilen, reichen Land ohne internationale Konflikte fällt das Risiko für alle grundsätzlich geringer aus, aber ist dennoch je nach Geschlecht, Alter und gesellschaftlicher Position unterschiedlich. Die wahre Prävalenz lässt sich nur schätzen, denn wer zählte je in einem Krieg wirklich alle Opfer und wie ließe sich die hohe Dunkelziffer sexualisierter und innerfamiliärer Gewalt jemals exakt bestimmen? Katastrophale Ereignisse wie der Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001, die Tsunami Ende des Jahres 2004 oder der Hurrikan Katrina im Jahr 2005 traumatisieren auf einen Schlag ganze Städte oder Regionen – als besonders schreckliche Beispiele für eine Traumatisierung des Typs I, also unerwartet und kurzfristig. Dort wo Not herrscht oder – wie in manchen Katastrophengebieten – weiterherrscht, wird aus der kurzfristigen Traumatisierung eine längerfristige und sich wiederholende im Sinne einer Typ-II-Traumatisierung. Ebenso anhaltend und damit in gewisser Weise für das Opfer vorhersehbar sind in der Regel viele Formen der zwischenmenschlichen Gewalt, im Krieg, bei Terror und Folter und in Form der Gewalt auf den Straßen und in den Familien.
In Europa ist die Lebenszeitprävalenz der PTBS einer neueren Studie zufolge (Alonso et al., 2004) überraschend gering, obwohl das methodische Vorgehen durchaus mit den bisher geschilderten Studien vergleichbar ist: Die Lebenszeitprävalenz für Männer betrug 0.9% (mit einer 12-Monatsprävalenz von 0.4%) und 2.9% bei den Frauen (mit einer 12-Monatsprävalenz von 1.3%). Dieses für alle Altersklassen repräsentative Ergebnis ist damit relativ gesehen niedriger als die Zahlen aus den rein deutschen Studien zum Thema.
Männer erleben in der Tendenz mehr traumatische Ereignisse als Frauen, aber das Erkrankungsrisiko ist für Frauen höher und ähnlich wie es für andere Angststörungen und für depressive Erkrankungen gilt, ist PTBS bei Frauen häufiger als bei Männern. Auch wenn die Zahlen in den einzelnen Studien je nach Land, Vorgehensweise und möglicherweise Studienziel differieren, kann man sagen, dass PTBS keine seltene psychische Störung ist, wenn auch nicht so häufig wie affektive Störungen.
Betrachtet man die Verläufe von PTBS differenziert, zeigt sich, dass Betroffene, die PTBS entwickeln mit einer höheren Ausgangssymptomatik starten, die zunächst sogar noch zunimmt, um im Laufe der Monate und Jahre abzunehmen. Personen, die keine PTBS entwickeln, zeigen dagegen nach der Traumatisierung durchaus auch posttraumatische Symptomatik, aber eben auch die gerade beschriebene kontinuierliche Abnahme derselben. Darüber hinaus gibt es durchaus Fälle, die zunächst kaum Symptomatik zeigen und im ersten halben Jahr keine PTBS entwickeln, jedoch später, also Fälle mit so genanntem verzögertem Beginn (»delayed onset«). Ein solches Krankheitsgeschehen wurde z.B. von Versicherungen angezweifelt, hat sich aber in einer Reihe von Studien bestätigt.
Grundsätzlich scheint PTBS häufig mit einer Reihe anderer Störungen einherzugehen, sämtliche epidemiologische Studien finden eine verhältnismäßig hohe Komorbidität, insbesondere affektive Störungen, Angststörung und Substanzmittelmissbrauch bzw. -abhängigkeit. Zum einen können traumatische Ereignisse nicht nur zu einer PTBS führen, sondern auch zu anderen psychischen Störungen, bzw. bilden langfristig eine unspezifische Vulnerabilität. Diese Erklärung ist naheliegend und lässt sich in zahlreichen Studien belegen. In einer Zusammenfassung von fünf Studien zu den Folgen ziviler Traumata zeigte sich unabhängig von der hohen Komorbidität mit PTBS die erhöhte Wahrscheinlichkeit folgender psychischer Störungen: Major Depression, Generalisierte Angststörung, Substanzmissbrauch und Phobie. Neben affektiven Störungen und Angststörungen sind hier natürlich auch solche Störungen zu nennen, von denen lange bekannt ist, dass sie eng mit traumatischen Erlebnissen in Verbindung stehen, die aber in den bisherigen großen epidemiologischen Studien nicht berücksichtigt wurden: Dissoziative Störungen, Somatoforme Störungen und Persönlichkeitsstörungen, vor allem die Borderline-Persönlichkeitsstörung (Übersicht bei Butollo & Hagl, 2003). Alle diese genannten Störungen können also als Folge posttraumatischer Entwicklung auftreten und stellen damit oft komorbide Störungen der PTBS da, treten aber auch ohne eigentliche posttraumatische Symptomatik auf. Möglicherweise zeigen sich dabei unterschiedliche posttraumatische Entwicklungspfade, die neben der basalen Vulnerabilisierung des stressverarbeitenden Systems auf individuellen Lernerfahrungen und Bewältigungsstrategien fußen. Eine bereits bestehende psychische Störung erhöht in jedem Fall das Risiko, nach einem traumatischen Ereignis eine PTBS zu entwickeln.
Therapeutische Ansätze
Eine einheitliche PTBS-Therapie gibt es nicht, obwohl im Mainstream der psychotraumatologischen Forschung weitgehend Konsens hinsichtlich der therapeutischen Methode der Wahl herrscht: In einem gemeinsamen Positionspapier der »International Consensus Group on Depression and Anxiety«, zu dem auch herausragende PTBS-Experten gehört wurden, wird die Bedeutung der kognitiv-behavioralen Therapien in der psychotherapeutischen Behandlung unterstrichen (Ballenger et al., 2000). Ebenso wird die pharmakologische Behandlung mit den so genannten SSRI (also Antidepressiva der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer) empfohlen. Tatsächlich aber kommt in der klinischen Praxis eine ganze Reihe von Methoden aus den unterschiedlichsten Schulrichtungen zur Anwendung, die auf einem mehr oder weniger starken empirischen Fundament und auf klinischem Erfahrungswissen basieren. Dies hat zwei Gründe: Zum einen neigen psychotherapeutisch Tätige dazu, solche Interventionen zu verwenden, mit denen sie sich gemäß ihrer Ausbildung identifizieren können – und die sie beherrschen. So kommen manche Verfahren zur Anwendung, deren Wirksamkeit speziell für PTBS nicht unbedingt hinreichend belegt ist, die aber eine lange Tradition in der Behandlung psychischer Störungen vorweisen können. Dies gilt für die psychodynamischen und humanistischen Verfahren, ebenso wie für die Hypnotherapie. Zum anderem kann chronische posttraumatische Symptomatik recht hartnäckig sein und bietet gleichzeitig ein anrührendes Bild hohen Leidensdrucks, so dass sich psychotherapeutisch Tätige nach allen Seiten umsehen, um Hilfe für ihre Patienten und Patientinnen zu finden. Das führt zur Anwendung neuerer, noch kaum evaluierter Verfahren und einem manchmal etwas getrieben anmutenden Eklektizismus.
Solche Methodenvielfalt ist dann ein Vorteil, wenn sie gezielt eingesetzt wird, um den vielfältigen Erscheinungsbildern und Symptombereichen posttraumatischer Störungen gerecht zu werden, und wenn man dabei empirische Ergebnisse und bestehendes klinisches Wissen berücksichtigt. Letztlich gilt es, eine Passung zu erreichen, zwischen den ganz individuellen Behandlungsbedürfnissen eines Patienten und der Neigung sowie dem Behandlungsgeschick eines Therapeuten, und dies alles auf dem Boden eines funktionierenden Störungsmodells und Therapierationals.
Behandlungsmanuale, wie sie z.B. von Ehlers (1999), Resick und Schnicke (1993) oder Foa und Rothbaum (1998) für den kognitiv-behavioralen Bereich vorgestellt wurden, halten wir durchaus für hilfreich. Tatsächlich beruhen praktisch sämtliche Effektivitätsstudien auf solchen manualisierten Therapien mit eher geringer Sitzungszahl. In diesen Studien handelte es sich aber in der Regel auch um eine recht ausgelesene Population. Meist sind dies Personen, die sich auf einen Studienaufruf hin meldeten oder von Ambulanzen für solche Studien aus der Gesamt-Klientel ausgewählt wurden. Schwierige, chronifizierte Fälle mit hoher Komorbidität und extremer Symptomatik (z.B. Suizidalität oder Sucht) wurden in der Regel ausgeschlossen. Überspitzt formuliert handelt es sich in solchen Psychotherapiestudien oft um eine Idealtherapie für Idealfälle. Diese Forschung hat jedoch in jedem Fall ihre Berechtigung, denn so lassen sich die Ergebnisse für die einzelnen Therapiemethoden besser vergleichen und deren Effektivität überhaupt unter einigermaßen kontrollierten Bedingungen evaluieren. In der klinischen Praxis können manualisierte Kurzzeitinterventionen schnelle und effektive Therapieangebote für Patienten sein, die vor allem die klassische PTBS-Symptomatik zeigen und das noch nicht allzu chronifiziert und bei geringer anderweitiger Symptomatik. Für Patienten mit komplizierter Symptomlage sind sie nicht selten ein effizienter Baustein in einem breiteren und individuell zugeschnittenen Angebot.
Bevor wir uns aber rückhaltlos an den Ergebnissen von Psychotherapiestudien orientieren und dabei möglicherweise hilfreiche Methoden verwerfen, weil sie nicht ausreichend evaluiert wurden, sollten wir daran denken, dass die Ergebnisse dieser Studien auf einem bestimmten Boden geerntet werden. Solche Studien stellen auf der einen Seite aber den Optimalfall in der Behandlung dar. Andererseits beinhaltet die Anwendung manualisierter Therapien mit meist geringer Sitzungszahl auch die Gefahr, die Kraft bestimmter Interventionen zu unterschätzen. Psychotherapie ist nicht zuletzt die Kunst, eine funktionierende Modifikationsmethode in flexibler Weise für einen ganz bestimmten Patienten anzupassen, so dass er sie erfolgreich anwenden kann. Und manche Patienten brauchen vielleicht einfach nur etwas länger und hätten von einer höheren Sitzungszahl profitiert. Grundsätzlich präsentieren Psychotherapiestudien den durchschnittlichen Erfolg aller Teilnehmer und berücksichtigen dabei nicht immer die Unterscheidung nach möglichen Subgruppen von Respondern und Non-Respondern. Für die Praxis gilt also: Die Ergebnisse aus der Psychotherapieforschung sollen beachtet werden, beantworten aber (noch) nicht die Frage nach der spezifischen Indikation für eine bestimmte Patientin. Und die Verwendung einer »Methode der Wahl« erspart keinesfalls die möglichst objektive Evaluation im Einzelfall und die Supervision der eigenen Therapieleistung. Besonders wichtig ist dabei eine katamnestische Bearbeitung der Fälle, sei es in der eigenen Praxis oder im Rahmen von Therapiestudien: War ein Therapieerfolg von Dauer? Diesen Vorbehalten unterliegen auch die am meisten untersuchten Therapieverfahren, die im Weiteren kurz dargestellt seien.
Die kognitiv-behavioralen Verfahren gelten in ihrer Wirksamkeit bei der Behandlung der PTBS als empirisch am besten belegt. Dies entspricht dem erwähnten Positionspapier einer recht angesehenen Gruppe von Klinischen Psychologen und Psychiatern und den »Practice Guidelines« der ISTSS (Foa et al., 2000). Allerdings könnte man auch argumentieren, dass die kognitiv-behavioralen Verfahren einfach am längsten beforscht und am stärksten vertreten werden, z.B. durch so herausragende Forscherinnen wie Edna Foa. Die »Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung« der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (Flatten, Hofmann, Liebermann et al., 2001) liefert eine Zusammenfassung und Bewertung von sieben Übersichtsartikeln/Meta-Analysen zu den Ergebnissen der Therapieforschung im Bereich PTBS (Flatten, Wöller & Hofmann, 2001). Die Autoren kommen dabei zu dem Schluss, dass speziell zur konkreten Traumabearbeitung als einer der Phasen effektiver Traumatherapie, kognitiv-behaviorale Verfahren in ihrer Wirksamkeit belegt sind. In ihrer grundsätzlichen Überlegenheit als Verfahren in der Behandlung einer PTBS sind sie jedoch nicht bestätigt und die Autoren empfehlen ein multimodales Vorgehen, bei dem verschiedene Techniken kombiniert werden.
»Eye Movement Desensitization and Reprocessing« (EMDR) ist eine Methode, die man von den Inhalten her eigentlich den kognitiv-behavioralen Verfahren zuordnen könnte, die von ihren Vertretern aber als eigenständige Methode begriffen und vermarktet wird. Auch hier steht die Konfrontation mit der traumatischen Erinnerung und angstauslösenden Stimuli zusammen mit einer kognitiven Umbewertung im Vordergrund. EMDR ist eine vergleichbar junge Behandlungsmethode, die speziell zur Bearbeitung von traumatischen Erinnerungen entwickelt wurde (Shapiro, 1989). Von ihren Vertretern stark propagiert, erfuhr diese Methode schnell Akzeptanz bei praktisch tätigen Therapeuten, noch bevor ihre Wirksamkeit als ausreichend empirisch gesichert galt. Von anderer Seite wurde der Methode einiges an Skepsis entgegengebracht, nicht zuletzt deshalb, weil bis heute kein überzeugendes Erklärungsmodell speziell zur Wirkung der Augenbewegungen oder allgemein der alternierenden Stimuli existiert. So fehlt aus experimentellen Studien der Nachweis, dass die Augenbewegungen überhaupt einen zusätzlichen Effekt haben. Einige besonders kritische Autoren sehen in EMDR deshalb nichts anderes als eine eher schlecht durchgeführte Expositionsbehandlung und vermuten weitgehend unspezifische oder gar Placebo-Faktoren als Grundlage der Wirkung (u.a. Lohr et al., 1999). Inzwischen existiert eine Reihe von randomisierten und kontrollierten Studien, die die Wirksamkeit des Verfahrens in der Behandlung der posttraumatischen Symptomatik belegen. In ihrer Meta-Analyse kommen van Etten und Taylor (1998) zu dem Schluss, dass EMDR in seiner Wirksamkeit der Kognitiven Verhaltenstherapie in der Behandlung von PTBS ebenbürtig ist. Allerdings gibt es unseres Wissens bisher nur drei Veröffentlichungen, die beide Verfahren direkt vergleichen.
Hypnose wurde schon lange bevor das heutige PTBS-Konzept existierte, bereits um die Jahrhundertwende z.B. von Pierre Janet, zur Behandlung traumatischer Erinnerungen angewendet. Dementsprechend beschreibt eine lange Reihe von Fallstudien deren Effekt. Umso erstaunlicher ist es, dass es bis heute nur eine einzige kontrollierte Studie zur Wirksamkeit einer Hypnotherapie bei posttraumatischer Symptomatik gibt (Brom et al., 1989). Die Autoren verglichen bei insgesamt 112 Personen Hypnose, systematische Desensibilisierung und psychodynamische Therapie mit einer Wartelistenkontrollgruppe (im Durchschnitt 16 Sitzungen). Alle drei Behandlungsgruppen brachten signifikante und klinisch relevante Verbesserungen der Symptomatik.
Imaginative Techniken werden natürlich nicht nur im Rahmen der Hypnotherapie genutzt. Eine klassische und vielverwendete Vorstellungsübung, die z.B. auch von Shapiro (1995) ins EMDR-Protokoll übernommen wurde, ist die Erschaffung eines inneren sicheren Ortes (Beispiel bei Reddemann, 2001a, S.40). Ein derartiges Phantasiebild dient als eine Art inneres Rückzugsgebiet und ermöglicht der Patientin ein Gefühl der Ruhe und des Schutzes. In der Traumatherapie hat die Arbeit mit Vorstellungsbildern grundsätzlich einen großen Stellenwert, was nach Flatten, Wöller und Hofmann (2001) auch unmittelbar mit der Phänomenologie der posttraumatischen Symptomatik zusammenhängt: Traumatische Ereignisse bleiben oft in einer bildlichen bzw. sensorischen Modalität verhaftet, ohne ausreichend sprachlich verarbeitet zu werden. In ähnlicher Weise lässt sich so auch die Anwendung kunst- und körpertherapeutischer Techniken begründen. Nach Flatten et al. handelt es sich bei all diesen Techniken um adjuvante Verfahren, die eine Behandlung von PTBS ergänzen können, aber nicht als Einzelverfahren belegt sind. Die Autoren unterstreichen die besondere Bedeutung dieser Techniken für die Behandlung von Gewaltopfern, also von Personen, bei denen es zu einem traumatischen Überschreiten der Körpergrenzen kam, sei es durch physische oder sexuelle Gewalt. Grundsätzlich dürften nonverbale Methoden immer dort von Nutzen sein, wo die traumatische Erfahrung schwer verbal zugänglich ist, aus welchen Gründen auch immer (z.B. sehr frühe Traumatisierung, hohe Dissoziation). Gleichzeitig ermöglichen solche, den kreativen Ausdruck fördernde Methoden eine Stärkung des Selbstgefühls und Selbstbewusstseins. Eine systematische Evaluation solcher Therapiebausteine, die gerade im stationären Setting rege Anwendung finden, ist bisher nicht erfolgt und daher dringend erforderlich. Es fehlt der Beleg, dass sie tatsächlich den Zugang zu Ressourcen des Patienten erleichtern bzw. eine Weiterverarbeitung und Integration der traumatischen Erfahrungen ermöglichen.
Fischer (2000) entwickelte auf psychoanalytischer/tiefenpsychologischer Grundlage ein integratives Therapiemanual, die »Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie« (MPTT). Die MPTT setzt neben Kenntnissen in den in sie integrierten Verfahren eine psychoanalytische Ausbildung voraus und ist in ihrer Darstellung zumindest für Nicht-Analytiker etwas undurchsichtig. Trotz des hohen Stellenwertes, der Dokumentation und Erfolgskontrolle beigemessen wird, steht die Veröffentlichung einer kontrollierten Studie mit Darstellung der Forschungsmethodik noch aus.
Die »Traumazentrierte Psychotherapie« von Reddemann und Sachsse (1997; 2000) bzw. »Psychodynamisch imaginative Traumatherapie« (Reddemann, 2001a; 2001b) ist ein integrativer Ansatz, der vor allem aus der Erfahrung in der stationären Arbeit mit schwer traumatisierten Patientinnen entstand. Ausgehend von einem tiefenpsychologischen Verständnis wurden vor allem imaginative Verfahren integriert. Die Methode folgt dem klassischen Phasenansatz mit einer Stabilisierungsphase (auf die in der Arbeit mit komplexen posttraumatischen Störungen besonderer Wert gelegt wird), dann einer Phase der Traumasynthese und schließlich der Phase des Trauerns und der Neuorientierung. Das Vorgehen von Reddemann und Sachsse hat im deutschen Sprachraum großen Anklang gefunden, obwohl die empirischen Belege zur Wirksamkeit noch spärlich sind.
Das integrative Vorgehen von Reddemann steht in seiner ganzen Haltung (Transparenz, Ressourcen- und Wachstumsorientierung) deutlich einem humanistischen Psychotherapieverständnis nahe. Klassische humanistische Psychotherapieverfahren, wie die Gestalttherapie oder die Gesprächstherapie nach Rogers, scheinen explizit in der Behandlung traumabedingter Störungen eine untergeordnete Rolle zu spielen. Tatsächlich ist es wohl eher so, dass zumindest die heute üblicherweise angewandte Kognitive Verhaltenstherapie sich sowohl die Rogers’schen Basisvariablen als auch eine Reihe gestalttherapeutischer Techniken einverleibt hat. Niedergelassene Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Deutschland haben nicht selten eine entsprechende Zusatzausbildung (Butollo et al., 1996). Explizit humanistisch in seiner Basis ist der von unserer Arbeitsgruppe vorgelegte Behandlungsansatz »Integrative Traumatherapie und Dialogische Exposition« (Butollo, 1997; Butollo et al., 1998; Butollo & Karl, 2009), in dem gestalttherapeutische und verhaltenstherapeutische Ansätze integriert wurden. Basis dieses Ansatzes ist die Überlegung, dass traumatische Erfahrungen in der Regel einem entstellten Interaktionsgeschehen zwischen Individuum und seiner sozialen bzw. physischen Umfeld entspringen und so die gewachsenen, sozial-interaktionellen Erfahrungen Traumatisierter erschüttern. Die Therapie ist demzufolge als sozial-interaktives Geschehen anzusetzen, in dem die Selbstprozesse der Betroffenen neu konfiguriert werden.
Literatur
Alonso, J., Angermeyer, M. C., Bernert, S., Bruffaerts, R., Brugha, T. S., Bryson, et al. (2004): Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatrica Scandinavica, Suppl. 420, pp. 21-27.
APA (American Psychiatric Association). (1980): Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). Washington, DC: APA.
Ballenger, J. C., Davidson, J. R., Lecrubier, Y., Nutt, D.J., Foa, E. B., Kessler, R. C., McFarlane, A. C., Shalev, A. Y. (2000): Consensus statement on posttraumatic stress disorder from the International Consensus Group on Depression and Anxiety. Journal of Clinical Psychiatry, 61, Suppl. 5, pp. 60-66.
Bonhoeffer, K. (1926): Beurteilung, Begutachtung und Rechtsprechung bei den sogenannten Unfallneurosen. Deutsche medizinische Wochenzeitschrift, 52, S.179-182.
Brom, D., Kleber, R. J. & Defares, P. B. (1989): Brief psychotherapy for posttraumatic stress disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, S.607-612.
Butollo, W. (1997): Traumatherapie. Die Bewältigung schwerer posttraumatischer Störungen. München: CIP-Medien.
Butollo, W. & Hagl, M. (2003): Trauma, Selbst und Therapie. Konzepte und Kontroversen in der Psychotraumatologie. Bern: Huber.
Butollo, W. & Karl, R. (2009): Integrative Traumatherapie. Ein Manual zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung. Unveröffentlichtes Manuskript. LMU-München, LS Klinische Psychologie und Psychotherapie.
Butollo, W., Krüsmann, M. & Hagl, M. (1998): Leben nach dem Trauma. Über den therapeutischen Umgang mit dem Entsetzen. München: Pfeiffer.
Butollo, W., Piesbergen, C. & Höfling, S. (1996): Ausbildung und methodische Ausrichtung psychologischer Psychotherapeuten Ergebnisse einer Umfrage. Report Psychologie, 21, S.126-137.
Charcot, J. M. (1887): Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière (Bd. 3). Paris: Delahye & Lecrosnie.
Ehlers, A. (1999): Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen: Hogrefe.
Fischer, G. (2000): Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie (MPTT). Manual zur Behandlung psychotraumatischer Störungen. Heidelberg: Asanger.
Fischer-Hübner, H. & Fischer-Hübner, H. (1990): Die Kehrseite der »Wiedergutmachung«. Das Leiden der NS-Verfolgten in den Entschädigungsverfahren. Gerlingen: Bleicher.
Flatten, G., Hofmann, A., Liebermann, P., Wöller, W., Siol, T. & Petzold, E. R. (Hrsg.). (2001): Posttraumatische Belastungsstörung. Leitlinie und Quellentext. Stuttgart: Schattauer.
Flatten, G., Wöller, W. & Hofmann, A. (2001): Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörung. In: G. Flatten, A. Hofmann, P. Liebermann, W. Wöller, T. Siol & E. R. Petzold (Hrsg.), Posttraumatische Belastungsstörung. Leitlinie und Quellentext (S.85-122). Stuttgart: Schattauer.
Foa, E. B. & Rothbaum, B. O. (1998): Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD. New York: Guilford.
Foa, E. B., Keane, T. M. & Friedman, M. J. (Eds.). (2000): Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. New York: Guilford.
Freud, S. (1896/1977): Zur Ätiologie der Hysterie. Gesammelte Werke Bd. I. Frankfurt/M.: S. Fischer.
Hagl, M. (2008): Psychische Folgen von Verkehrsunfällen: Zur Rolle der peritraumatischen Dissoziation. Berlin: Logos
His, W. (1926): Beurteilung, Begutachtung und Rechtsprechung bei den sogenannten Unfallneurosen. Deutsche medizinische Wochenzeitschrift, 52, S.182-186.
Janet, P. (1889): L‘automatisme psychologique. Paris: Alcan.
Lohr, J. M., Lilienfeld, S. O., Tolin, D. F. & Herbert, J. D. (1999): Eye Movement Desensitization and Reprocessing: An analysis of specific versus nonspecific treatment factors. Journal of Anxiety Disorders, 13, pp. 185-207.
Reddemann, L. (2001a): Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
Reddemann, L. (2001b): Psychodynamisch imaginative Traumatherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. In: G. Dammann & P. L. Janssen (Hrsg.), Psychotherapie der Borderline-Störungen. Krankheitsmodelle und Therapiepraxis – störungsspezifisch und schulenübergreifend (S.147-163). Stuttgart: Thieme.
Reddemann, L. & Sachsse, U. (1997): Stabilisierung. Persönlichkeitsstörungen – Theorie und Therapie, 1 (3), S.113-147.
Reddemann, L. & Sachsse, U. (2000): Traumazentrierte Psychotherapie der chronifizierten, komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung vom Phänotyp der Borderline-Persönlichkeitsstörungen. In: O. F. Kernberg, B. Dulz & U. Sachsse (Hrsg.), Handbuch der Borderline-Störungen (S.555-571). Stuttgart: Schattauer.
Resick, P. A. & Schnicke, M. K. (1993): Cognitive processing therapy for rape victims: A treatment manual. Thousand Oaks, CA: Sage.
Shapiro, F. (1989): Eye movement desensitization: A new treatment for post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, pp. 211-217.
Shapiro, F. (1995): Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols, and procedures. New York: Guilford.
van Etten, M. L. & Taylor, S. (1998): Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology and Psychotherapy, 5, pp. 126-144.
WHO (World Health Organization). (1992): The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO.
Prof. Dr. Willi Butollo ist Leiter der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie der LMU München und Gründer des Münchner Instituts für Traumatherapie.
Posttraumatische Belastungsstörungen bei deutschen Soldaten nach Auslandseinsätzen
Flottenarzt Dr. Roger Braas im Interview
Für deutsche Soldaten, die nach Auslandseinsätzen PTBS aufweisen, gibt es in der Bundesrepublik zwei Behandlungszentren, eines davon am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. In der Abteilung »Psychotherapie und Psychologie« mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie werden im Jahr 700 bis 1.000 Patienten stationär aufgenommen, pro Monat gibt es 700 ambulante Patientenkontakte. Geleitet wird die Abteilung von Flottenarzt Dr. Roger Braas, seit 30 Jahren im Dienst der Bundeswehr.
W&F: Der Wehrbeauftragte des Bundestages hat in seinem Bericht eine Verdreifachung der Fälle von PTSB von 2006 bis 2008 festgestellt, können Sie das bestätigen?
Braas: Wir erleben eine steigende Tendenz, die man aber genauer betrachten muss. Wir diagnostizieren die Störung eher, weil wir genau wissen, wovon wir reden. Es kommen inzwischen auch Patienten zu uns, die schon länger unter Störungen leiden, erst jetzt aber wissen, was das eigentlich ist. Und wir haben bei den Einsätzen, insbesondere in Afghanistan, eine höhere Quote von Ereignissen. Die deutschen Soldaten werden heute öfter beschossen, und das führt dazu, dass die Fälle zunehmen. Wir wissen aus amerikanischen Untersuchungen, dass ab einer Stärke von vier bis fünf Feuergefechten zwanzig Prozent der Soldaten eine PTBS bekommen. Und wenn sie häufiger ein Feuergefecht haben, dann erfüllen Sie irgendwann die Kriterien, dann ist eben ein Fünftel der Soldaten auch betroffen.
W&F: Machen Sie immer noch die Erfahrung, dass es den Soldaten schwer fällt, sich seelische Schäden einzugestehen?
Braas: Es gibt immer eine Hemmschwelle, zum Psychiater zu gehen. Wir haben vor Ort einen eigenen Psychiater, in Masar-i-Sharif und im Kosovo, wir haben Truppenpsychologen vor Ort, aber es dauert schon eine Weile, bis die in Anspruch genommen werden. So stark wie früher ist die Angst, ein »Weichei« zu sein, jedoch nicht mehr. Wenn jemand heute weiß, ich habe eine psychische Verwundung davongetragen, dann geht man auch zum Spezialisten. Bei offenkundigen Ereignissen, z.B. einem Bombenattentat, werden wir in der betroffenen Einheit aktiv. Wir ziehen die Soldaten zusammen, und erklären: „Das und das habt ihr jetzt erlebt, das und das ist jetzt passiert, und das und das kann mit Euch noch passieren: ihr könnt Schlafstörungen bekommen, ihr könnt das albtraumhaft immer wieder erleben, also flash backs bekommen, ihr könnt unspezifische Symptome wie Angstzustände bekommen, und dann hat das vielleicht mit dem Einsatz zu tun. Und wenn solche Störungen auftreten, solltet ihr zum Spezialisten vor Ort gehen, oder euch nach der Rückführung an uns wenden.“
Wir haben an vielen Standorten psychosoziale Netzwerke eingerichtet, die den Soldaten und ihren Angehörigen Hilfestellung geben, wenn etwas im Miteinander auffällig wird. Manchmal ist es ja so, dass die betroffenen Soldaten selbst nicht merken, wie sehr sie sich verändern, aber sie kommen verändert von den Einsätzen zurück, und plötzlich stellt die Familie fest: „Papi ist so komisch, der ist so dünnhäutig und explodiert immer sofort.“
Dann nehmen die Angehörigen mit uns Kontakt auf. Hier in Koblenz-Lahnstein haben wir ein gut funktionierendes psychosoziales Netzwerk. Dazu gehören die Militärseelsorge, der Sozialdienst, der truppenärztliche Dienst und wir im Bundeswehrzentralkrankenhaus.
W&F: Können Sie einen typischen Fall eines Soldaten mit PTBS schildern?
Braas: Wir hatten einen Offizier, der verwickelt war in Aufstände im Kosovo. Dort kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Feuergefechten, mit Einsatz von Handgranaten. Der Soldat hat das vor Ort sehr hautnah miterlebt, aber den Einsatz noch zu Ende gebracht, ohne zu wissen, wie sehr ihn das beeinträchtigt hat. Erst nach der Rückkehr zu seiner Familie ist er durch seine Verhaltensänderung auffällig geworden. Zusätzlich bekam er somatoforme Störungen, die er nicht verstand, unspezifische Schmerzen. Keiner fand etwas, organisch war alles in Ordnung. Nur durch einen Zufall wurde er von einem Kollegen zu uns weitergeleitet. Nach der Diagnose haben wir ihn stationär aufgenommen, in vier Wochen stabilisiert, dann in der Tagesklinik und schließlich ambulant weiter betreut, so dass er seine Symptome los wurde, oder sie zumindest einordnen konnte. Das hat ein drei Viertel Jahr gedauert. Er macht jetzt allerdings eine Schreibtischtätigkeit.
W&F: Wie sieht die Behandlung der Soldaten mit PTBS konkret aus?
Braas: Wir verwenden erst mal viel Zeit auf eine genaue Diagnose, mit psychologischen Fragebögen und Anamnese. Dann müssen die Betroffenen informiert werden über das, was die Umstrukturierung im Gehirn bewirkt. Als zweiter Schritt ist es wichtig, eine Stabilität zu erreichen. Die betroffenen Soldaten merken selbst, sie explodieren bei Nichtigkeiten, und wissen nicht, woran das liegt. Dann bekommen sie Werkzeuge an die Hand, mit denen sie sich in solchen Situationen »runterfahren« können.
Das klingt banal, nimmt aber einen großen Raum in der Therapie ein. Die bekommen manchmal nur ein kleines Gummi ans Handgelenk, mit dem sie sich schnippen können, und daran merken sie, ich komme wieder ins Hier und Jetzt. Oder sie lernen, durch Rückwärtszählen, wieder im Jetzt anzukommen. Oder sie lernen, Dinge im Raum zu benennen, die sie aus der Aufgeregtheit wieder herausholen.
Das klingt wirklich banal. Es ist aber ein schwieriger pädagogischer Prozess, ihnen das beizubringen. Die Patienten sind ungeheuer glücklich, wenn sie das dann können, wenn sie merken: jetzt war was mit mir, aber ich kriege mich wieder ein.
W&F: Setzen Sie in der Trauma-Therapie auch anerkannte Techniken ein wie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), bei denen der Therapeut seine Hand unmittelbar vor den Augen des Patienten schnell hin und her bewegt, so dass die Erinnerungsbilder beim Patienten schneller entstehen?
Braas: Ja, wobei man sagen muss, wenn wir EMDR einsetzen, dann sind wir schon ganz weit. Denn das beinhaltet ja eine Konfrontation mit dem erlittenen Trauma, und das ist das Schlimmste. Wenn Sie das schaffen können in der Therapie, dass die Patienten sich tatsächlich an das Ereignis erinnern können, an Gerüche, an Laute, an Erleben, dann haben Sie schon fast gewonnen, dann ist fast die Therapie zu Ende.
W&F: Wie lange dauert die Behandlung?
Braas: Das ist unterschiedlich, bis zu einem drei Viertel Jahr, oft in einem Wechsel von Tagesklinik, stationärem und ambulantem Aufenthalt.
W&F: Nach dem Stabilisieren und dem Behandeln kommt das Reintegrieren, wie gut gelingt das?
Braas: Das kommt darauf an. Es gibt Soldaten, die haben mehrere Traumatisierungen erlitten, da schauen wir nach Alternativen. Es gibt ja Jobs bei den Streitkräften, die weniger exponiert sind. Und es gibt auch durchaus Fälle, da kann man wieder einen Auslandseinsatz in Betracht ziehen.
Das Trauma selbst ist nie weg. Es ist immer eine Narbe, die bleibt. Narben können verheilen und funktionieren, tun aber auch immer mal wieder weh.
W&F: Laut einer Statistik gehen 30 Prozent der Soldaten nach erfolgreich behandelter PTBS wieder zurück in den Kriseneinsatz…
Braas: Diese Zahl kann ich nicht bestätigen. Das ist auch schwierig zu ermitteln. Der Großteil der Soldaten, die wir betreuen, das sind freiwillig länger Dienende, und die scheiden nach einer gewissen Zeit wieder aus, weil ihre Dienstzeit vorüber ist. Die Berufs- und Zeitsoldaten gehen wieder in den Einsatz. Aber 30 Prozent scheint mir hoch gegriffen.
W&F: Der Wehrbeauftragte des Bundestages hat beklagt, dass wir von einer umfassenden Rundumbetreuung der Einsatzkräfte nach Schocksituationen weit entfernt sind, wie beurteilen Sie das?
Braas: Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben eine gute Expertise im Umgang mit dem Störungsbild. Wir sind dicht dran, wir haben Kontakt vor Ort, wir wissen, wenn Soldaten repatriiert werden aus psychischen Gründen und nehmen die auch in Empfang. Natürlich kann man das nicht umfassend für alle Betroffenen sagen. Das geht schon deshalb nicht, weil manchmal in den Wirren der Ereignisse vor Ort die Beteiligten nicht alle erfasst werden. Das sind so Viele: die Patrouille, die angesprengt wird, die Hilfskräfte, die sie rausholen, die Sicherungskräfte sind beteiligt, es sind Sanitäter im Einsatz… Eigentlich müssten sie jeden Einzelnen screenen, ob er was hat. Das ist nicht leistbar. Rein theoretisch muss jeder Soldat nach seiner Rückkehr einen Fragebogen ausfüllen. Aber da rutschen uns viele Betroffene durch. Auch weil die Symptome einer PTBS erst oft bis zu einem halben Jahr nach dem Ereignis auftreten.
Ein Mitglied des Technischen Dienstes der sog. Friedenstruppen für Kosovo meldete sich auf Drängen einer Nachbarin in der Trauma-Ambulanz. Er hatte vor sechs Monaten mit seinem Jeep eine unachtsame Passantin angefahren, die eine schwere Kopfverletzung erlitt. Die Angehörigen der Frau waren sehr aufgebracht und der Soldat entging der Lynchjustiz nur dank dem Eingreifen seiner Kameraden. Er war unmittelbar nach dem Ereignis gefasst und konnte detailliert Auskunft über den Unfallhergang geben. Allerdings erlebte er an den Tagen nach diesem Geschehen eine ihm bisher unbekannte eigenartige Unruhe. Er wurde zwei Wochen krank geschrieben und fuhr danach, als er sich noch nicht fit fühlte, drei Wochen in den Urlaub, wo es ihm besser ging. Anschließend wurde ein »Arbeitsversuch« gestartet, der anfangs gut verlief. Allerdings vermied er nach Möglichkeit Einsätze außerhalb der Werkstätte. Ließ es sich nicht vermeiden, steigerte sich seine Nervosität und Fahrigkeit, so dass einer dieser Einsätze aus diesem Grund abgebrochen werden musste.
Danach wurde er zu einer als vorübergehend geplanten Einsatztätigkeit in eine Werkstätte außerhalb des Konfliktgebietes versetzt. Sein Zustand besserte sich jedoch nicht, im Gegenteil. Er schreckte nachts nach Albträumen auf, musste immer wieder an den Hergang des Unfalles und den bedrohlichen Aufruhr danach denken. Er haderte mit seinem Schicksal und empfand die Versetzung als persönliche Niederlage: Darüber war er tief deprimiert, Medikamente waren ineffektiv und er begann in der Folge vermehrt Alkohol zu trinken, um sich zu beruhigen und um einschlafen zu können. Er vermied den Kontakt mit den Kollegen von früher, zog sich von sozialen Aktivitäten zurück und quittierte bald darauf den Dienst.
Wieder zuhause, erlebte er eine Panikattacke, als er unmittelbar dabei war, als vor seinem Haus eine unbekannte Frau zusammenbrach und noch vor dem Eintreffen der Rettung verstarb. Danach hatte sich sein Zustand so verschlechtert, dass er dem Drängen der Nachbarin folgte und therapeutische Hilfe suchte.
W&F: Einige Mediziner beklagen, PTBS sei durch viele Medienberichte eine Art Modediagnose geworden. Wird das Phänomen überbewertet?
Braas: Von Modediagnose kann nicht die Rede sein, dafür ist das Thema zu ernst. Die Einsätze der US-Amerikaner im Irak-Krieg haben gezeigt, dass zwanzig Prozent der Kampftruppen betroffen sind, also jeder fünfte Soldat erleidet eine PTBS. Wir Deutschen haben zwar überwiegend noch Peace-Keeping-Missions, nur vereinzelt Kampfeinsätze. Wenn es jetzt aber immer mehr »robustere Einsätze« gibt, wird die Zahl zunehmen. Und dann müssen wir uns noch besser darauf vorbereiten – mit Bettenausstattung, Facharztausstattung, etc. Deshalb finde ich den mahnenden Zeigefinger des Wehrbeauftragten sehr berechtigt.
W&F: Warum wirken gewalttätige Ereignisse wie Kriegsgeschehen so viel traumatisierender als Naturkatastrophen?
Braas: Naturkatastrophen sind schicksalhaft. Man kann niemandem unterstellen, dass er das gewollt hat. Ein Tsunami passiert, weil die Erde so ist, wie sie ist. Bei dem Erleben durch Menschen gemachter Gewalt ist ja das Gewollte dahinter: Ich will Dich verletzten, ich will Dich existenziell bedrohen, vielleicht sogar Deine Existenz auslöschen. Es gibt ein Gegenüber, eine menschliche Kreatur, die das beabsichtigt. Und ich glaube, auch wenn der Mensch schon solange auf diesem Planeten wandelt, hat es immer eine ganz besondere Dimension, wenn er von der eigenen Spezies bedroht wird.
Das Interview führte Dr. Daniela Engelhardt
Afghanistan: Menschenrechtsverletzungen an Frauen und ihre Folgen
von Karin Griese
Drei Jahrzehnte Krieg haben ihre Spuren in der afghanischen Zivilgesellschaft hinterlassen. Es gibt kaum eine Familie in Afghanistan, die nicht über den Tod von Angehörigen hinaus zahlreiche kriegsbedingte traumatische Ereignisse verarbeiten muss. Immer noch gibt es keinen tatsächlichen Frieden in dem Land, in dem im August 2009 Präsidentschaftswahlen stattfinden werden. Unsicherheit und Gewalt sind an der Tagesordnung. Die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan hat sich seit dem gewaltsamen Sturz des Talibanregimes – durch den so genannten Krieg gegen den Terror – nach anfänglichen Verbesserungen wieder verschlechtert und ist heute kaum besser als vor der internationalen Militärintervention. Mit den Kriegen und unregulierten Nachkriegswirren ist die Gewalt gegen Frauen und Mädchen eskaliert: Sie waren und sind Kriegsvergewaltigungen, Menschenhandel und einem Anstieg von oft lebensbedrohlicher häuslicher Gewalt ausgesetzt (Ertürk 2006). Hinzu kommt ökonomische Not gepaart mit der alltäglichen strukturellen Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die unter anderem auf frauenfeindlichen patriarchalen Traditionen und einem Mangel an Rechtsstaatlichkeit basiert. Seit 2003 engagiert sich die Frauen- und Menschenrechtsorganisation »medica mondiale« für von Gewalt und Traumatisierung betroffene Frauen und Mädchen in Afghanistan mit verschiedenen Projekten.
Versucht man sich im Internet einen Überblick über aktuelle Artikel zum Thema Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS oder engl. PTSD) und Afghanistan zu verschaffen, fällt auf: Wenn derzeit über PTSD berichtet wird, geht es fast ausschließlich um zurück gekehrte Soldaten (u.a. Deutscher Bundestag 2009). Fügen wir im Internet den Begriff Frauen hinzu, erscheinen Artikel über die hohe Rate der weiblichen Kriegsveteraninnen mit kriegsbedingten Traumatisierungen, u.a. auch durch sexualisierte Gewalt (Dotinga 2008). Die Verzweiflung afghanischer Frauen und Mädchen angesichts Jahrzehnte langer Kriege und massiver Gewalt in Gesellschaft und Familie besitzt keinen hohen Nachrichtenwert mehr. Es sei denn, es geht um Nachrichten mit Sensationswert wie z.B. die Verabschiedung eines frauenfeindlichen schiitischen Familiengesetzes im Vorfeld der Wahlen durch den afghanischen Präsidenten Karzai oder um anschauliche Berichte zu den Selbstverbrennungen von afghanischen Frauen. Oder aber Politiker jeglicher Couleur nutzen die miserablen Lebensbedingungen der afghanischen Frauen als Argument in der öffentlichen Debatte, wenn es um die Rechtfertigung einer weiteren militärischen Aufrüstung geht.
Kriegsgewalt und Traumatisierung
Traumatische Ereignisse sind gekennzeichnet von der Angst um das eigene Leben oder die eigene körperliche Unversehrtheit oder aber das Miterleben des Todes oder der schweren Verletzung anderer, gepaart mit extremer Hilflosigkeit und Ohnmacht. Es sind kein Kampf und keine Flucht möglich, die Situation ist ausweglos.
Durch den extremen Stress, der das Leben und die Identität des Menschen bedroht, sprengt ein Trauma die normalen Prozesse, wie Erfahrungen verarbeitet werden können. Die Folge: Funktionsstörungen, Panikattacken, Depressionen, chronische Schmerzen oder eine PTSD) können das Leben der Betroffenen über Jahre hinweg massiv beeinträchtigen (Griese 2009).
Die Diagnose der PTSD muss für die Erfassung der psychischen Folgen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kriegs- oder Nachkriegszeiten unzureichend bleiben. Sie zielt auf die Folgen einzelner traumatischer Ereignisse ab und erfasst nicht den längerfristigen komplexen Prozess, in dem sich das Trauma im sozialen Bezugsrahmen entwickelt (Joachim 2006). In Kriegs- und Nachkriegssituationen sind Frauen und Mädchen jedoch einer Vielzahl von traumatischen Ereignissen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt, so dass von einer hohen Langzeitbelastung ausgegangen werden muss. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass viele Frauen in Kriegs- und Nachkriegsregionen unter einer komplexen PTSD (Herman 1994) oder einer sequentiellen Traumatisierung (Keilson 1979) mit entsprechend weitreichenderen Folgen sowie anderen stressbedingten psychosozialen Problemen leiden.
Häufig treten in Verbindung mit der PTSD auch andere psychische Folgen auf, sogenannte Komorbiditäten wie z.B. Depressionen, Panikattacken oder Zwangsstörungen, selbstverletzendes Verhalten, psychosomatische Erkrankungen. Wichtig sind darüber hinaus spezifische Unterschiede in der Symptomentwicklung, die unter anderem mit der jeweiligen (sozialen) Bewertung der Ereignisse und unterschiedlich vorhandenen Bewältigungsstrategien zusammen hängen (Joachim 2006, Zemp 2006).
Gewalt und Gewaltfolgen in Afghanistan
Betrachten wir die Gegenwart von Frauen und Mädchen in Afghanistan, scheint es fast fragwürdig, sich angesichts der verheerenden tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen an Frauen und Mädchen in Afghanistan der Problematik mittels einer klinischen Diagnostik zu nähern. Groß ist die Gefahr, die Frauen – wie traditionell üblich – als Opfer zu pathologisieren, damit das »Problem« bei ihnen zu sehen und die Ursachen und damit die Täter aus dem Blick zu verlieren.
So schreibt Azimi 2004: „The most devastating and crippling psychological difficulties most women and children of Afghanistan face today are the horrors of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD).“ Der Autor bezieht sich dabei vor allem auf die Traumatisierung durch die Kriegsereignisse und die spezifischen Leiden der Frauen unter den Taliban. Die im Vergleich zu den Männern außergewöhnlich hohe Rate an PTSD-Symptomen unter Frauen führt er darauf zurück, dass Frauen in der Regel sensibler und verletzlicher seien als Männer. Mit keinem Wort wird die immer noch andauernde, oft lebensbedrohliche alltägliche Gewalt gegen Frauen erwähnt.
Gleichzeitig weist die mittels der klinischen Diagnostik auf die Perspektive der psychischen Folgen fokussierte Betrachtung der gegenwärtigen Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan in alarmierender Weise auf ihre Notlage und den deutlichen Unterstützungsbedarf hin und ist deshalb ausgesprochen wichtig.
Wesentliche Voraussetzung zur Verarbeitung traumatischer Erfahrungen wie z.B. Kriegserlebnisse sind materielle und physische Sicherheit, soziale Anbindung und Unterstützung. In Afghanistan setzt sich aber für die Frauen und Mädchen die Gewalt im Alltag fort. 57% der afghanischen Frauen heiraten vor dem Mindestalter von 16 Jahren, 70 – 80% aller Frauen werden zur Heirat gezwungen (UNIFEM 2008a). Kindes- und Zwangsheirat sind die Ursache für verschiedenste Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen (UNIFEM 2008b). Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe und andere Formen der Gewalt im familiären Rahmen sind zum einen ein Tabu, entsprechen zum anderen einer akzeptierten gesellschaftlichen Norm (Ertürk 2006). Hinzu kommen Freiheitsentzug, in bestimmten Regionen verschiedene Formen der traditionsbedingten Gewalt wie z.B. »badal« oder »bad« (Übergabe eines Mädchens an eine andere Familie, um z.B. Blutrache zu beenden). Mangelernährung, frühe und zahlreiche Schwangerschaften und unzureichende medizinische Versorgung tragen dazu bei, dass Afghanistan das einzige Land der Welt ist, in dem die Lebenserwartung der Frauen mit 44 Jahren in 2008 noch niedriger ist als die der Männer (UNIFEM 2008). Vielen erscheint ihre Lage so aussichtslos, dass sie sich selbst das Leben nehmen. So ist z.B. die Selbstverbrennung unter Frauen und Mädchen unter anderem im Raum Herat sehr verbreitet (medica mondiale 2006-2007).
Es gibt nur eine verschwindend geringe Anzahl von ausgebildeten Psychiatern oder PsychotherapeutInnen, nur wenige Anlaufstellen stehen Menschen mit psychischen oder psychosozialen Problemen zur Verfügung, die wenigsten Frauen haben überhaupt aufgrund ihrer geringen Mobilität die Möglichkeit, entsprechende Beratungsstellen aufzusuchen.
Ebenso wichtig ist es, die Folgen der fast drei Jahrzehnte andauernden Kriege für Frauen nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch im sozialen Kontext zu betrachten. So sind die Ursachen der massiven häuslichen Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Afghanistan zum einen in frauenfeindlicher Tradition, Politik und einer entsprechend ausgelegten Religiosität zu sehen. Neben den individuellen, psychischen Folgen haben die kriegsbedingten Traumafolgen auch eine zerstörerische Wirkung auf die soziale Gemeinschaft insgesamt. So wird durch die massive zwischenmenschliche Gewalt und Brutalität in Kriegszeiten das Vertrauen in andere Menschen tief erschüttert. Wie in anderen Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften auch, ist in Afghanistan zu beobachten, dass die zwischenmenschliche Gewalt im Vergleich zu Friedenszeiten extrem hoch ist. Auch das kann u.a. mit unverarbeiteten Traumata zusammen hängen. Ohnmacht und damit verbundene Wut und Aggression setzen sich in der oftmals schwierigen ökonomischen Situation fort – und entladen sich häufig gegenüber jungen Frauen und Kindern, die gesellschaftlich die schwächste Position haben.
Gewalt und Traumatisierung
Seit 2004 bietet »medica mondiale Afghanistan« in Kabul psychosoziale Beratungsgruppen für Frauen an. Die Teilnehmerinnen sind Überlebende mit kriegsbedingten Traumatisierungen, darunter viele Witwen, sowie Frauen, die häusliche Gewalt durch Ehemänner oder Schwiegerfamilien erfahren mussten
Die qualitative Auswertung der Angaben von 109 Teilnehmerinnen, die über ein halbes Jahr lang ein Mal wöchentlich an den Beratungsgruppen von »medica mondiale Afghanistan« teilnahmen, zeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen in den Beratungsgruppen Erleichterung von psychischen oder körperlichen Problemen/Symptomen suchte.
So nannten 28,6% der Befragten als Grund, eine Beratungsgruppe aufzusuchen, eine generalisierte oder spezifische Schmerzsymptomatik, Zittern, ein Gefühl von Lähmung oder auch Betäubung und Kurzatmigkeit. 24,1% aller Befragten gaben Frustration, Depression, Nervosität, extreme Besorgnis, Angstgefühle, Aggression, Selbstverletzung oder die Angst verrückt zu werden als Grund zur Teilnahme an der Gruppe an. Generell zeigte sich eine auffällig hohe Anzahl depressiver Symptome sowie auch psychosomatisch bedingte Schmerzsymptome1 (siehe auch Zemp 2006).
Für Afghanistan beschreiben wissenschaftliche Studien mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten hohe Raten an PTSD bei Frauen, variierend zwischen 30 bis 48 Prozent der jeweiligen Stichproben (Seino et. al 2008, Scholte et. al 2004). In der ersten landesweiten repräsentativen Erhebung zu psychischer Gesundheit in Afghanistan 2002 zeigten 48,33% der befragten Frauen eine PTSD Symptomatik gegenüber 32,14% der Männer. Bei einer Stichprobe von Menschen dieser Studie, die als »disabled«, also aus verschiedenen Gründen als für die Alltagsbewältigung beeinträchtigt eingestuft wurden, lag die Rate bei 55% bei den Frauen und bei 26% bei den Männern (Lopes Cardozo 2004).
Verschiedene Artikel und Studien weisen aber darauf hin, dass in Afghanistan neben PTSD-Symptomen auch andere Folgen traumatischer Ereignisse wie Depressionen sehr häufig auftreten (u.a. Miller et. al 2008, Miller et. al 2009, Lopes Cardozo 2004, Zemp 2006). Die Rate an PTSD liegt dabei niedriger als die von Depression und Angststörungen.
So beschreibt auch Missmahl (2006), basierend auf der praktischen Arbeit in einem Beratungszentrum in Kabul, dass sich bei den Klientinnen und Klienten nur selten ein voll ausgebildetes Bild einer Posttraumatischen Belastungsstörung zeige (allerdings ohne zwischen Angaben zu Männern und Frauen zu unterscheiden). Dagegen litten viele Menschen an einer oder mehreren Langzeitfolgen unbehandelter traumatischer Erfahrungen, neben verschiedenen Symptomen, die dem Symptombild der PTSD zugeordnet werden können, erwähnt sie Somatisierung, körperliche Erkrankung, chronische Schmerzen.
Zusammenfassend legen die oben aufgeführten Ergebnisse nahe, dass im Fall von Gewalterfahrungen von Frauen in Afghanistan PTSD-Symptome nur einen Ausschnitt der möglichen psychischen Folgen darstellen (Joachim 2008).
Gesellschaftlicher Umgang mit Gewalt und Traumatisierung
2004 wurde die »Mental Health Task Force« ins Leben gerufen, eine Arbeitsgruppe, die angliedert ist an das afghanische »Ministry of Public Health« (Ditmann 2004). Seit Beginn 2007 nehmen afghanische Mitarbeiterinnen von »medica mondiale Afghanistan« regelmäßig an dieser Arbeitsgruppe teil, die sich zusammensetzt aus Regierungsmitarbeitern aus den Bereichen Gesundheit und Erziehung sowie aus VertreterInnen ausgewählter afghanischer und internationaler Hilfs- und Nichtregierungsorganisationen sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Relevanz psychischer Störungen, einschließlich Traumafolgestörungen, sowie der Bedarf an breiter Unterstützung für die Betroffenen jenseits von psychiatrischer Versorgung wird auch von der afghanischen Regierung mittlerweile als hoch eingeschätzt. Das zeigt sich u.a. daran, dass die »Mental Health Task Force« in 2008-2009 intensiv an der Integration einer ausgearbeiteten Komponente zu psychosozialer Begleitung als Teilbereich zum Thema Psychische Gesundheit im offiziellen »Basic Package of Health Services« (BPHS) (Ministry of Public Health 2005, Acera et. al 2009) der afghanischen Regierung gearbeitet hat. Diese schließt Trainingsmanuale für Gesundheitsfachkräfte ein und soll über die staatlichen Gesundheitsdienste in ganz Afghanistan umgesetzt werden. Die Gruppe hat erreicht, dass das Thema »Psychische Gesundheit« jetzt nicht mehr mit niedriger, sondern mit hoher Priorität im BPHS enthalten ist.
Wie schwierig es ist, Gewalt gegen Frauen und ihre Folgen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit als Thema einzubringen, zeigten allerdings die zähen Verhandlungen in der »Mental Health Task Force« dazu, wie dieses Thema in den Ausbildungscurricula und Trainingsmanualen für Gesundheitsfachkräfte angemessen berücksichtigt werden kann. Immer noch wird deutlich lieber von »innerfamiliärer Gewalt« gesprochen anstatt Gewalt gegen Frauen explizit zu benennen und das Thema sexualisierte Gewalt ist nach wie vor tabuisiert. Letztendlich ist es gelungen, dass zumindest das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen basierend auf einem Minimalkonsens als Querschnittsthema in die Manuale aufgenommen wurde.
In wie fern traumatische Erlebnisse auch tatsächlich zu einer chronifizierten Stress-Symptomatik wie PTSD oder anderen Stressfolgeerkrankungen führen, hängt maßgeblich davon ab, wie diese – gesellschaftlich und individuell – bewertet werden. Das macht z.B. in Afghanistan die Verarbeitung von extrem erniedrigenden und stigmatisierenden Gewalttaten wie Vergewaltigungen oder aber auch der sozial akzeptierten häuslichen Gewalt sehr problematisch.
Die afghanischen Mitarbeiterinnen von »medica mondiale« bieten seit 2005 Trainings zum Thema »Psychosoziale Beratung« an, die den Umgang mit Traumatisierung und Gewalt gegen Frauen einschließen – die Nachfrage ist groß. Dabei ist aber auch zu beobachten, dass die eigene Identifizierung als »Traumaopfer« auch einen Prozess der Hilflosigkeit auslösen kann: „Wir in Afghanistan sind alle traumatisiert? Was sollen wir schon tun?“.2
In der Arbeit von »medica mondiale« in Afghanistan ist es daher wichtig, immer den Blick auf die eigenen und sozialen Ressourcen zu öffnen, kleine Veränderungen und Fortschritte wahrzunehmen und auf die Stärke der Überlebenden zu fokussieren. So ist es essentiell, immer wieder auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass auch schwierige Lebenssituationen zu meistern sind. Schließlich ist es vielen Frauen und Mädchen in Afghanistan gelungen, trotz Jahrzehnte andauernden Kriegen, Konflikten und Unterdrückung und vielen körperlichen und psychischen Problemen immer noch ihre Alltagsanforderungen zu bewältigen und niemals vollständig die Hoffnung zu verlieren. Das ist ein Aspekt der psychischen Gesundheit, der nur selten in Studien untersucht wird (Miller nach Dittmann 2004).
Praktische Unterstützung vor Ort
Ruft man sich in Erinnerung, dass die Kriegserklärung an Afghanistan unter anderem mit den massiven Menschenrechtsverletzungen an Frauen und Mädchen unter den Taliban begründet wurde, ist die Anzahl an zivilgesellschaftlichen und internationalen Projekten in Afghanistan, die sich gezielt für Frauen einsetzen, verschwindend gering. Zudem setzen sich gerade einheimische Frauen, die sich für Frauenrechte engagieren – sei es in internationalen und lokalen Nichtregierungsorganisationen – massiven Anfeindungen, lebensgefährlichen Bedrohungen und auch Attentaten aus.
So ist »medica mondiale Afghanistan« eines der wenigen Projekte, das konkrete Unterstützungsangebote für von Gewalt und Traumatisierung betroffene Frauen und Mädchen anbietet.
Dabei ist das Thema »Trauma« auch ein Türöffner z.B. für Trainingsangebote für Gesundheitsfachkräfte in Krankenhäusern. Es bietet den Mitarbeiterinnen – und auch den Teilnehmerinnen – einen gewissen Schutz davor, sofort als Frauenrechtlicherinnen abgestempelt zu werden und damit ungleich mehr gefährdet zu sein.
Seit 2003 engagiert sich »medica mondiale« für Frauen und Mädchen in Afghanistan mit verschiedenen Projekten: Die Mitarbeiterinnen vor Ort bieten Frauen direkte psychosoziale und rechtliche Unterstützung an. Mit politischer Arbeit setzt sich »medica mondiale« zudem offensiv für die Durchsetzung der Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan ein. Die Projektarbeit konzentriert sich auf die Städte Kabul, Herat, Mazar-i-Sharif (bis 2008 auch Kandahar) sowie auf einige angrenzende Provinzen. So bietet »medica mondiale« Rechtshilfe für Frauen an, die in den Frauengefängnissen in Kabul, Herat und Mazar-i-Sharif inhaftiert sind. Die Mehrzahl dieser Frauen sind wegen so genannter moralischer Verbrechen im Gefängnis – zum Beispiel weil sie aus Angst vor einer Zwangsverheiratung von zu Hause geflohen sind oder nach einer Vergewaltigung der Unzucht bezichtigt werden. »medica mondiale Afghanistan« stellt den Frauen Anwältinnen zur Seite, die dafür sorgen, dass sie einen fairen Prozess erhalten und nicht für Jahre im Gefängnis verschwinden.
In sechs Stadtteilen Kabuls hat »medica mondiale Afghanistan« Beratungsräume eingerichtet, die Frauen eine psychosoziale Unterstützung in ihrer Nähe und einen Treffpunkt an einem geschützten Ort bieten. In mehreren Schutzhäusern, in Krankenhäusern in Herat und Kabul sowie in den Frauengefängnissen in Kabul und Herat bieten afghanischen Psychologinnen von »medica mondiale« ebenfalls Einzel- und Gruppenberatungen an. Die Nachfrage ist groß, da es in Afghanistan kaum qualifizierte Anlaufstellen für von Gewalt betroffene oder traumatsisierte Frauen gibt. Deshalb trainiert »medica mondiale Afghanistan« auch fortlaufend afghanische Fachkräfte wie Rechtsanwältinnen, Gesundheitsfachkräfte und Sozialarbeiterinnen im kompetenten Umgang mit von Gewalt betroffenen Afghaninnen.
Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der intensiven Weiterbildung und Sensibilisierung medizinischen Fachpersonals von Krankenhäusern in Kabul und Herat. Viele Ereignisse der Gegenwart – wie etwa eine medizinische Untersuchung bei Frauen, die vergewaltigt wurden – bewirken eine Reaktualisierung der traumatischen Erfahrung. Sie rufen die schmerzhaften Erinnerungen so lebendig hervor, dass die Frauen das Gefühl haben, alles noch einmal zu erleben. Leider treffen Überlebende von (Kriegs-)Gewalt in Afghanistan in der Regel eher auf Menschen, die ihrer Problematik unvorbereitet gegenüberstehen – in Kliniken, vor Gerichten, Ministerien und auch bei Hilfsorganisationen. Dabei hängen die Verarbeitungsmöglichkeiten der körperlichen und seelischen Verletzungen elementar von den Hilfsangeboten und dem umsichtigen Handeln der Fachkräfte ab. Durch die Berücksichtigung einfacher, in Trainings vermittelter Grundprinzipien können z.B. Retraumatisierungen eingegrenzt oder vermieden werden.
Darüber bieten die Seminare die Möglichkeit zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt gegen Frauen und sensibilisieren für angemessene Unterstützung und Hilfsmaßnahmen.
Ausblick
Die psychischen Folgen von Traumatisierungen müssen immer im Kontext mit den massiven Menschenrechtsverletzungen gesehen werden, in dem sie entstanden sind. Sehr viele Frauen, mit denen »medica mondiale« in Afghanistan zu tun hat, haben Schreckliches erlebt und leiden täglich unter der zermürbenden Gewalt der Unterdrückung. Trotzdem gibt es Heldinnen des Alltags wie z.B. Malalai Joya, Mitglied des Parlaments, die sich trotz massiver Widerstände beharrlich aufgelehnt hat. Oder diejenigen, die gegen die Verabschiedung des international und in Afghanistan massiv kritisierten schiitischen Familiengesetzes auf den Straßen Kabuls protestiert haben. Oder die afghanischen MitarbeiterInnen von »medica mondiale« vor Ort, die sich trotz der Gefahren und Anfeindungen immer wieder engagiert einsetzen für die Umsetzung von Frauenrechten und für ihre Klientinnen. Oder die betagte Oberärztin des Universitätskrankenhauses in Kabul, die die Arbeit von »medica mondiale« schon seit 2004 unterstützt und es geschafft hat, ihr Leben lang sich auch unverheiratet Respekt zu verschaffen.
Auswertungen zeigen, dass die Angebote von »medica mondiale Afghanistan«, in denen Frauen sich in psychosozialen Beratungsgruppen regelmäßig in geschütztem Rahmen unter Begleitung einer afghanischen Psychologin treffen, mit verhältnismäßig wenig Aufwand eine schon fast überraschend positive Wirkung haben. Über 90% der Frauen beschreiben, dass sich durch die Teilnahme in der Gruppe ihre gesundheitliche oder soziale Situation deutlich verbessert hat. Ein ganz wesentlicher Faktor ist dabei die Aufhebung ihrer Isolation und die Begleitung beim Aufbau von Unterstützungssystemen, die über die Familie hinausgehen. Zum anderen bewirken der angeleitete Erfahrungsaustausch, die Aufklärung über den Zusammenhang von körperlichen und psychischen Problemen und die Übungen zu Stressreduktion und Problemlösungsstrategien eine deutliche Entlastung und Stärkung der Teilnehmerinnen, die sich unter anderem in einem Rückgang von körperlichen und psychischen Beschwerden, Stress- und auch Traumasymptomen widerspiegelt.
Viele Frauen treffen sich auch nach Beendigung der Gruppenarbeit weiter und nutzen u.a. gemeinsam Alphabetisierungskurse von »medica mondiale Afghanistan«. Was fehlt sind andere, auf einkommensschaffende Maßnahmen für Frauen spezialisierte Organisationen, die auch wenig gebildeten und vor allem wenig mobilen Frauen aus den Distrikten die Chance geben, größere ökonomische Sicherheit und damit auch größere Handlungsspielräume zu bekommen und damit mehr Schutz vor ausbeuterischen Abhängigkeits- und Gewaltverhältnissen. Darüber hinaus sind psychosoziale Angebote zur Traumabearbeitung und Sensibilisierung zu geschlechtsspezifischer Gewalt für Jungen und Männer als vorbeugende Maßnahme gegen häusliche Gewalt, familiäre Konflikte und bewaffnete Gewalt dringend erforderlich.
Gegenwärtig werden aus dem Bundeshaushalt pro Jahr mehr als 530 Millionen Euro für den Militäreinsatz ausgegeben. Für den zivilen Aufbau steht weniger als ein Viertel dieser Summe zur Verfügung. Das Budget für die Förderung von Frauenrechten und Unterstützung von Frauen unter anderem im Gesundheits- und Bildungswesen lag 2007 nur bei 1,7 Millionen Euro.
Die aggressive militärische Strategie der Anti-Terrorbekämpfung hat den Frauen bislang nur eines gebracht: eine sich dramatisch verschlechternde Sicherheitssituation, die immer mehr Frauen und Mädchen in ihre Häuser zurück zwingt – und sie dabei zu Zielscheiben fundamentalistischer Mächte macht. »medica mondiale« fordert einen nachhaltigen Strategiewechsel beim Wiederaufbau Afghanistans. Frieden, Entwicklung und Wiederaufbau können nur gelingen, wenn die militärische Gewaltspirale beendet und das Primat der militärischen Konfliktlösung durch einen deutlich verstärkten zivilen Wiederaufbau abgelöst wird, an dem Frauen maßgeblich beteiligt werden.
Dabei schaffen psychische Stabilisierung und Stärkung durch Traumaarbeit, psychosoziale Arbeit oder Selbsthilfegruppen für viele Frauen überhaupt erst die Möglichkeit, sich aktiv an der friedensfördernden Bewältigung gesellschaftlicher Konflikte und am gesellschaftlichen Wiederaufbau zu beteiligen. Die inhaltliche Verknüpfung von Friedensaufbau und der Prävention von neuer Gewalt gegen Frauen und bewaffneter Gewalt muss bei internationalen und nationalen Konzepten endlich berücksichtigt werden.
Anmerkungen
1) Eine detaillierte klinische Diagnostik der PTDS wird von »medica mondiale« in Afghanistan aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt.
2) Aussage der Teilnehmerin zu Beginn eines Trainings von Gesundheitsfachkräften in Kabul 2006 durch »medica mondiale«.
Literatur
Acera, John R. et al (2009): Rebuilding the health care system in Afghanistan: an overview of primary care and emergency services, in: International Journal of Emergency Medicine, Volume 2, No. 2.
Azimi, Amin (2004): The mental health crisis in Afghanistan, Lemar-Aftaab – afghanmagazine.com, march 2004 und ReliefWeb. http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/OCHA-64C37Z?OpenDocument
Bolton, Paul and Theresa Stichick Betancourt (2004): Mental Health in Postwar Afghanistan, in: JAMA. 2004; 292: 626-628.
Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Aktueller Begriff: Posttraumatische Belastungsstörung Nr. 17/09, 04.03.2009.
Dotinga, Randy (2008): Sexual Trauma haunts female Vets, in: The Washington Post, 28.10.2008 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/28/AR2008102801693.html.
Ertürk, Yakin (2006): Integration of the human rights of women and a gender perspective: Violene against women. Rapport of the Special Rapporteur on violene against women, its causes and consequences, Mission to Afghanistan (9 to 19 July 2005), E/CN, 4/2006/61/Add. 5.
Griese, Karin (2009): Die zerstörerische Macht unverarbeiteter Traumata, Gastbeitrag für Deutsche Welle zum UN-Jahr der Versöhnung, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4231478,00.html.
Herman, Judith Lewis (1994): Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden, München.
Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Public Health (2005): A Basic Package of Health Services for Afghanistan, 2005/1384.
Joachim, Inge (2006): Sexualisierte Kriegsgewalt und ihre Folgen, in: medica mondiale 2008, S.56-93.
Keilson, Hans (1979): Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Deskriptiv-klinische und quantifizierend-statistische Follow-up-Untersuchung zum Schicksal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden, Stuttgart.
Lopes Cardozo, Barbara et. al (2004): Mental Health, Social Functioning, and Disability in postwar Afghanistan, in: JAMA 2004, 292, No. 5.
Manneschmidt, Sybille and Karin Griese (2009): Evaluating Psychosocial Group Counselling with Afghan Women: Is This a Useful Intervention?, in: TORTURE Journal, Volume 19, No. 1, 2009, Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture http://www.irct.org/publications/torture-journal/latest-issue.aspx.
medica mondiale (2006-2007): Dying to be heard. Self-imolation of Women in Afghanistan. Findings of a research project of medica mondiale.
medica mondiale e.V. und Karin Griese (2006): Sexualisierte Kriegsgewalt und ihre Folgen. Handbuch zur Unterstützung traumatisierter Frauen in verschiedenen Arbeitsfeldern, Frankfurt am Main, 2. aktualisierte Auflage.
Miller, Keneth E. et. al (2009): The Validity and Clinical Utility of Post-traumatic Stress Disorder in Afghanistan, in: Transcultural Psychiatry, Vol. 46, No. 2, 219-237.
Miller, Keneth E. et al. (2008): Daily stressors, war experiences and mental health in Afghanistan, Transcultural Psychiatry, Vol. 45, No. 4, 611-638.
Missmahl, Inge (2006): Psychosoziale Hilfe und Traumaarbeit als ein Beitrag zur Friedens- und Versöhnungsarbeit am Beispiel Afghanistans, in: Psychotherapieforum 2006.
Scholte, Willem F. et al (2004): Mental Health Symptoms Following War and Repression in Eastern Afghanistan, in: JAMA 2004; 292: 585-593.
Seino, Kaoruko et al (2008): Prevalence of and factors influencing posttraumatic stress disorder among mothers of children under five in Kabul, Afghanistan, after decades of armed conflicts, in: Health and Quality of Life Outcomes, 23. April.
UNIFEM Afghanistan Fact Sheet 2008a http://www.unifem.org/afghanistan/media/pubs/08/factsheet.html.
UNIFEM Afghanistan (2008b): Violence against women primary database report http://www.unifem.org/afghanistan/docs/pubs/08/evaw_primary%20database%20report_EN.pdf.
Zemp, Maria (2006): Afghanische Frauen leben mit ihren Schmerzen; in: Lachesis, Zeitschrift Nr. 34.
Karin Griese arbeitet als Referentin für Traumaarbeit bei der Frauen- und Menschenrechtsorganisation »medica mondiale« mit Sitz in Köln. »medica mondiale« unterstützt vergewaltigte und von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen in Kriegs- und Konfliktgebieten wie in Afghanistan, Kosovo und Liberia mit eigenen Frauenberatungszentren, in anderen Regionen, wie der Demokratischen Republik Kongo, in Kooperation mit Frauenorganisationen vor Ort. Die Geschäftsführerin Monika Hauser erhielt 2008 für ihre Arbeit und die ihrer Organisation den Alternativen Nobelpreis.