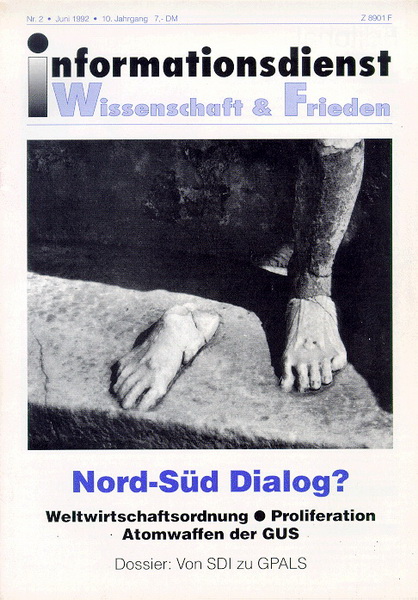Abkehr vom Wachstum
Grundlage für eine ökologisch-solidarische Weltwirtschaft
von Manfred Busch
»Wachstum«, »Wohlstand«, »Freihandel«, »freiheitliche Weltwirtschaft« und »internationale Arbeitsteilung«, das alles sind hochgradig ideologisch belastete Begriffe. Sie sind weniger durch Wahrheitssuche als durch Interessenverschleierung geprägt. Ausgangspunkt eines alternativen Außenwirtschafts- und Entwicklungskonzepts ist eine grundlegend ideologie-kritische Position.
Ideologische Begriffe sind das Gegenteil von Aufklärung und Vernunft. Die Wissenschaften, die für sich in Anspruch nehmen, aufklärerisch zu wirken, sind nicht nur in autoritären Systemen eng mit den herrschenden Interessen verbunden, sondern auch bei uns im Westen. Dies gilt in einer kapitalistischen Gesellschaft natürlich in besonders hohem Maße für die Wirtschaftswissenschaften.
Wachstumspolitik im nationalen Rahmen
»Wachstum« ist der Kernbegriff einer Wirtschaftstheorie, die mehr zur Verschleierung als zur Erklärung ökonomischer Sachverhalte dient, und einer Wirtschaftspolitik, die unter dem Deckmantel scheinbar gesicherter Lehrsätze und Plausibilitäten knallharte Interessenpolitik durchsetzt.
»Wachstum« ist eine gesetzlich fixierte Zielgröße der Wirtschaftspolitik und gilt gemeinhin als Meßlatte ökonomischen Erfolgs. Die jeweils aktuelle Wachstumsrate ziert die Schlagzeilen; unsere Wirtschaftsfachleute singen das hohe Lied vom Wachstum in einer freien Weltwirtschaft.
Diese Wachstumspolitik wird seit mindestens 20 Jahren von vielen Seiten massiv kritisiert – daraus darf man allerdings nicht den Fehlschluß ziehen, in der Praxis der Wirtschaftspolitik habe sich viel geändert. Die sog. neue Nachdenklichkeit der Wirtschaftspolitiker gibt es nur in ihren Sonntagsreden; die Praxis ist immer noch die alte.
Die Vorstellung, daß Wachstum grundsätzlich positiv sei und zu einer Wohlstandsvermehrung führe, hat jenseits der Systemgrenzen eine vordergründige Plausibilität, die sich aus dem einfachen »je mehr, desto besser« ableiten läßt. So wird z.B. die Industrialisierung im 19. Jahrhundert wie folgt charakterisiert: „Der natürliche Wachstumstrieb, wie er auch dem Menschen eigen ist, konnte sich frei entfalten. Die Bäume der Produktion konnten plötzlich in den Himmel wachsen“ (Kurt Biedenkopf in „Die neue Sicht der Dinge“, 1985, S. 156). Industrielles Wachstum ist aber weder »natürlich« noch – angesichts einer endlichen Welt – unendlich fortzuführen. Bei unseren heutigen Wirtschaftsprozessen handelt es sich, wenn wir im Bild bleiben wollen, großteils eher um krebsartige Wucherungen als um Wachstum.
Eine Kernaussage dieser etablierten westlichen (neoklassischen) ökonomischen Theorie kann man wie folgt formulieren: Ein marktwirtschaftliches System findet unter den Bedingungen vollständiger Konkurrenz, d.h. vor allem bei frei beweglichen Preisen und funktionierendem Wettbewerb, seinen natürlichen und gleichzeitig optimalen Wachstumspfad von allein, aus sich selbst heraus.
In der Realität sind diese Modellbedingungen natürlich nirgends umgesetzt, und das Wachstumsziel wird verfehlt. Deshalb streiten die etablierten Wirtschaftspolitiker über die Reichweite ihrer Aufgabe: Sollen sie Wachstumsförderung allein durch das rigorose Streben nach Annäherung der Realität an die Modellbedingungen betreiben, z.B. über den Rückzug des Staates aus wirtschaftlicher Tätigkeit oder eine Mobilitätsförderung für Arbeitslose, oder sollen sie auch aktiv Wachstum fördern, vor allem durch Technologieförderung (Schlüsseltechnologien), Privilegierung von Investitionen, Steuergeschenke an Unternehmen und massive Exportförderung?
Was so neutral als „Schaffung marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen“ bezeichnet wird, bedeutet in der wirtschaftspolitischen Praxis z.B. das Unterlaufen von Tarifverträgen. Denn: nach unten unflexible »Faktorpreise«, d.h. Löhne und Kreditmarkt-Zinsen, die auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage nicht reagieren, gelten als Wachstumsbremsen. Angriffspunkt neoklassischer Ökonomen sind hier vor allem die Löhne, die in Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit nach unten gehen müßten. Der Sachverständigenrat (die »Fünf Wirtschafts-Weisen«) läßt ja keine Gelegenheit aus, die seiner Ansicht nach „zu hohen“ Löhne gerade auch in Ostdeutschland anzugreifen. Sinken die Löhne nur genügend stark, so das marktwirtschaftliche Credo, dann wird die Beschäftigung auch des letzten Arbeitslosen wieder rentabel. Die Frage, ob damit eine ausreichende Versorgung der Beschäftigten gesichert bleibt, ist für den Propheten der reinen Lehre unwichtig.
Wachstumshemmend sind aber auch alle umwelt- oder sozialpolitisch begründeten Auflagen, also Eingriffe in das angeblich freie Spiel der Märkte. Mit der Forderung nach freier unternehmerischer Entfaltung wird faktisch der Vorrang der Ökonomie vor allen anderen gesellschaftlichen Interessen, auch der Ökologie, durchgesetzt.
Die Mängel des wachstumspolitischen Wirtschaftskonzeptes
Die etablierte Wachstumspolitik beruft sich zur Begründung ihrer weitreichenden Maßnahmen auf ein Konzept, das entscheidende Mängel aufweist:
Das Bewertungs- oder Qualitätsproblem
Die Wachstumstheorie hat kein Konzept, nützliche von schädlichen Gütern zu unterscheiden. Auch schädliche Güter vermehren das Sozialprodukt, auch die Reparatur von Schäden, die aufgrund der Produktionsweise entstehen, wirkt wachstumsfördernd. Ein vermehrter Pestizideinsatz erhöht die chemische und die landwirtschaftliche Produktion, erhöht die Trinkwasser-Aufbereitungskosten und damit den „Wert“ des Trinkwassers – und nicht zuletzt die Krankheitskosten. Alles steigert das Sozialprodukt. Heute wird der Anteil der ökologischen Folgekosten am Sozialprodukt für die BRD auf bis zu 20% geschätzt. Und diese Folgekosten wachsen doppelt so schnell wie das Sozialprodukt.
Die Befriedigung überflüssiger Bedarfe steigert ebenfalls das Sozialprodukt, z.B. der Bau des Transrapid, eines kostentreibenden Fremdkörpers in unserem Verkehrssystem, die Entwicklung und Einführung des hochauflösenden Fernsehens, die bemannte Weltraumfahrt; alles Objekte staatlicher Fördermaßnahmen. Wachstumspolitik braucht unsinnige, überflüssige und schädliche Produkte, bis hin zu Rüstungsproduktion und Rüstungsexporten. Sie produziert einerseits ökologische Zerstörung und soziales Elend, auf der anderen Seite den Schein einer Überflußgesellschaft.
Güter, die keinen Markt und keinen Preis haben, z.B. die Luft, die wir atmen, oder die natürliche Umwelt gehen dagegen unabhängig von ihrer tatsächlichen Bedeutung überhaupt nicht in die Berechnung ein. Das gleiche gilt für Produkte der Tauschwirtschaft; weder die Subsistenzprodukte der Dritten Welt noch die Hausarbeit bei uns tauchen im Sozialprodukt auf.
Das Ressourcenproblem
Das Ressourcenproblem kam mit der Studie des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“ weltweit in die Debatte. Produktionsfaktoren, die keinen Preis haben, werden hemmungslos verbraucht, auch wenn ihr Erhalt lebenswichtig ist. Das »qualitative Wachstum« fordert zum sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen auf, steigert also die Ressourcen-Effizienz, z.B. den spezifischen Energieverbrauch; durch Mengenwachstum wird dieser relative Spareffekt aber häufig überkompensiert. Zudem werden zahlreiche Umwelt-Probleme auch mit modernster Technik überhaupt nicht beherrscht. In manchen Bereichen ist jeder geringe Verbrauch noch zuviel; Schwermetalle oder Dioxine z.B. werden überhaupt nicht abgebaut. Wir müssen also dahin kommen, nicht nur relativ, sondern absolut weniger zu verbrauchen.
Das Verteilungsproblem
Zwar vergrößert das Wachstum des Sozialprodukts den Verteilungsspielraum und entschärft damit vorübergehend das Verteilungsproblem – dies ist ein wichtiger Grund für seine politische Attraktivität, für den „Zwang zum Wachstum“ moderner Industriegesellschaften (Biedenkopf, S.155). Andererseits bleibt die ungerechte Vermögens- und Einkommensverteilung im nationalen und internationalen Maßstab aber unangetastet, ja sie verschärft sich sogar. Die Verteilungsspielräume werden weiterhin ungleich genutzt, die eh schon Bessergestellten profitieren mehr, die anderen weniger oder gar nicht.
Die Wachstumsgläubigen
Die Konfrontation mit den verheerenden Folgen der Wachstumspolitik kann die Rechtgläubigen allerdings nicht erschüttern. Für sie ist die Ursache nicht zuviel Markt, zuviel Wachstum, sondern zuwenig. Sie haben scheinbar auf alle Probleme eine Antwort:
- Wenn nur die Umwelt ihren gerechten Preis erhielte, die VerbraucherInnen nützliche, umweltschonende Produkte nachfragten und die Unternehmen in umweltverträgliche Technologien investierten, dann ließe sich das Umweltproblem schon lösen;
- wenn nur die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand vorangetrieben und eine verstärkte Qualifizierung der Arbeitskräfte realisiert würde, dann ließe sich die Beschäftigung steigern und damit auch die soziale Frage lösen usw.
Ob diese Rahmenbedingungen realisierbar und durchsetzbar, also praxistauglich sind, lassen sie im Dunkeln. Alle Erfahrung zeigt, daß diese geforderten »idealtypischen« Funktionsbedingungen nicht realisierbar und auch nicht wünschenswert sind. Die Löhne dürfen nicht voll flexibel sein, weil die Menschen damit zum Spielball ökonomischer Entwicklungen würden. Selbst noch so niedrige Löhne können nicht verhindern, daß arbeitssparender technischer Fortschritt Arbeitsplätze vernichtet; die gesellschaftliche Antwort hierauf muß Arbeitszeitverkürzung sein und nicht Lohnsenkung. Zahlreiche Umweltprobleme entziehen sich einer rein marktwirtschaftlichen Lösung: die Gefahren der Atomtechnologie, der Gentechnologie, der Chemieindustrie und vieles andere muß gesellschaftlich bewertet, aus der Bewertung müssen Konsequenzen gezogen werden. Hier ist in erster Linie staatliches Handeln gefordert, gestützt auf eine demokratische Entscheidungsfindung.
Wachstumspolitik im Weltmaßstab
Wie der Wachstumsbegriff besitzt auch das Konzept der »internationalen Arbeitsteilung« und des »Freihandels« eine vordergründige Plausibilität: „Soll doch jeder machen, was er am besten kann, dann profitieren alle davon“. Erfahrungen, die jeder Mensch in seinem unmittelbaren Lebensumfeld gesammelt hat, werden pauschal und unzulässig auf die Weltwirtschaft übertragen.
Grundlage für die heutige Außenhandelstheorie, die im Freihandelsdogma ihren entsprechenden politischen Ausdruck gefunden hat, bildet wiederum die (neoklassische) Wachstumstheorie. Im Ergebnis: Freihandel fördert Wachstum und Wohlfahrt aller (!) beteiligten Länder.
Die Außenhandelstheorie, wie sie allen StudentInnen der Wirtschaftswissenschaften beigebogen wird, verbleibt im Prinzip auch heute noch auf dem Stand von David Ricardo Anfang des 19. Jahrhunderts, der mit seinem „Theorem der komparativen Kostenvorteile“ die Vorteilhaftigkeit des Außenhandels für alle Beteiligten, wirtschaftlich Unterlegene wie Überlegene, aufzeigen wollte. Er demonstrierte an einem Beispiel, daß eine wechselseitige Spezialisierung im Handel – hier Tuch, dort Wein – für England und (!) Portugal Vorteile bringen kann.
Ein überraschendes Ergebnis, denn Portugal war damals gegenüber England führend sowohl bei der Wein- als auch bei der Tuchproduktion. Der clevere Engländer Ricardo wollte den widerspenstigen Handelspartnern in Portugal weismachen, daß sie von einer Spezialisierung Portugals auf Wein Vorteile hätten. Mit der Konsequenz, daß die Engländer sich auf das industriell herstellbare Tuch spezialisieren konnten – wirtschaftsgeschichtlich gesehen mit großem Erfolg, denn der Markt für Tuche war der »Markt von morgen«.
Solche Modelle, die von vorgegebenen Produktionsbedingungen und Ressourcenausstattungen ausgehen (natürliche Umwelt, Land und Arbeit bei Ricardo, später Kapital und Arbeit bei Heckscher-Ohlin), können die Charakteristika einer dynamisch wachsenden Weltwirtschaft nicht adäquat abbilden – auch nicht in den mathematisch verfeinerten neuzeitlichen Varianten. Der Begriff »Kapital« ist nämlich doppeldeutig: eine monetäre Wertsumme einerseits, ein realer Produktionsgüterbestand andererseits. Beides aber ist nicht an Ländergrenzen gebunden: Finanzkapital kann ex- und importiert werden, ebenso können Produktionsgüter an verschiedenen Standorten investiert werden. Beide ändern häufig – in Abhängigkeit von internationalen Rahmenbedingungen – ihren Wert bzw. ihre Fähigkeit zur Produktion. Zudem wird der Welthandel nicht von Ländern, sondern von Unternehmen betrieben, ein Großteil des Welthandels sogar zwischen verschiedenen Betrieben des jeweils gleichen multinationalen Konzerns.
Die »gegebene Faktorausstattung« eines Landes wird damit zur Fiktion, sie kann nicht zur Erklärung oder Begründung des Außenhandels dienen – die Theorie ist eigentlich mit ihrem Latein am Ende.
Die Vorstellung, daß ein Land über einen vorgegebenen Bestand an Arbeitskräften und Kapital verfügt, der die relative Vorteilhaftigkeit der Produktion und damit die weltweit günstigste Produktionsstruktur determiniert, ist nicht nur theoretisch unsinnig, sondern auch historisch falsch. Einige Länder wie z.B. Japan haben es – unter dem Schutz einer konsequenten Protektion – geschafft, den Kapitalstock ihrer Volkswirtschaft zu modernisieren und damit Weltmarkt-konkurrenzfähig zu machen. Gerade die Verbesserung der Sachkapital-Ausstattung und der Qualifikation der Beschäftigten muß doch Ziel der Politik sein, nicht die Anpassung des Handels an eine scheinbar naturgesetzlich vorgegebene Ausstattung.
Entsprechend müßte eine Weltentwicklungspolitik darauf ausgerichtet sein, die Voraussetzungen für einen gleichberechtigten Handel zu schaffen, z.B. im Rahmen der GATT-Verhandlungen, nicht den gegenwärtigen Rückstand zu zementieren.
Diese und andere konzeptionelle Fehler werden aber als notwendige Vereinfachungen verharmlost, um zu den gewünschten »praxistauglichen« Folgerungen zu kommen. Und die sind um so eindeutiger: Alle Länder müssen – angeblich im eigenen Interesse – Handel treiben, sich spezialisieren und in den Weltmarkt integrieren. In Ländern mit relativ niedriger Kapitalausstattung und hoher Unterbeschäftigung der Arbeitskräfte, also der Dritten Welt, sind eben die Löhne quasi naturgesetzlich niedrig. Mit anderen Worten: Die billige Arbeitskraft gilt nach Ricardo als „komparativer Kostenvorteil“ der Entwicklungsländer.
In den Worten von Carl-Dieter Spranger, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit: „Freier Handel ist ein wichtiger Entwicklungshelfer“ (Referat am 6.12.1991 in Königswinter). Schließlich erhalten die Dritte-Welt-Länder, so das Argument, doch erst im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung für ihre Rohstoffe und einfachen Produkte die begehrten, technisch hochwertigen Industriegüter – Voraussetzung für Wachstum und Wohlstandsmehrung.
Die behaupteten Vorteilen des Freihandels und der internationalen Spezialisierung werden allerdings durch die konkreten Erfahrungen der Dritten Welt nicht bestätigt:
- Gerade die für die Dritte Welt wichtigen Waren, vor allem Agrarprodukte, Textilien und andere einfache Industriegüter, unterliegen scharfer Weltmarktkonkurrenz und harten protektionistischen Maßnahmen der Industrieländer. Damit sind die Dritte-Welt-Länder strukturell benachteiligt, ihre Terms of Trade verschlechtern sich zunehmend, ihre Weltmarktintegration bringt nicht genügend Devisen, sie bleiben abhängig vom Norden.
- Wenn international operierende Unternehmen, die »Multis«, Teile ihrer Produktion in Entwicklungsländer verlagern, um dort die niedrigen Reallöhne auszunutzen, ist das Sozialdumping. Wo bleibt die Forderung »gleicher Lohn für gleiche Arbeit«?
In der Zeitschrift Impulse, nach Selbsteinschätzung „das Magazin für unternehmerischen Erfolg“ von Dezember 1991 liest sich das so: „Marokko, die beste Werkbank in Afrika. Facharbeiter zu Billiglöhnen gibt es vor allem in den größeren Städten“ (S. 108), oder „Vietnam: Die Löhne sind niedrig, es gibt eine hohe Zahl deutschsprechender Fachkräfte. Viele Projekte mit der ehemaligen DDR sind eine gute Basis für neue Kooperationen“. Solche „verlängerten Werkbänke“, auf denen mit billigen Arbeitskräften, insbesondere auch Frauen, nach westlichem Standard für westliche Märkte produziert wird, dienen vor allem den Interessen der Industrieländer. Gleiches gilt für Investitionen, die der Erschließung von Rohstoffquellen für den Norden sicherstellen.
Die ausbeuterische Handelsstruktur wird quasi naturgesetzlich gerechtfertigt; die Entwicklungsländer werden auf ewig in die abhängige Rolle der Rohstofflieferanten und verlängerten Werkbänke abgedrängt.
Die Schuldenfalle
Die Integration in den Weltmarkt als offensive Wachstums- und Industrialisierungsstrategie führte viele Dritte-Welt-Länder in die Katastrophe. Ihr Versuch einer nachholenden Industrialisierung endete in der Schuldenfalle, der Überschuldung. Per Saldo müssen die Entwicklungsländer mehr Schuldendienst zahlen, als ihnen an Entwicklungshilfe und privatem Kapital neu zufließt.
Zur Erfüllung ihres Schuldendienstes müssen viele Dritte-Welt-Länder ohne Rücksicht auf Verluste exportieren. Von einer sinnvollen Entwicklungsstrategie kann unter solchen Bedingungen nicht mehr die Rede sein, es bleibt nur noch der Ausverkauf des Volksvermögens. Als Beispiel sei hier der hemmungslose Export von Tropenholz in die Industrieländer genannt, der die landwirtschaftlichen Produktionsvoraussetzungen späterer Generationen unwiderruflich zerstört, oder der Import von als Wirtschaftsgut deklariertem Giftmüll.
Trotz dieser negativen Erfahrungen bestehen die Industrieländer auf uneingeschränkter Marktwirtschaft und noch stärkerer Weltmarktintegration für die Dritte-Welt-Länder. Ihnen wird zugemutet, was die Industrieländer im eigenen Bereich nicht umgesetzt haben, nämlich die Durchsetzung marktradikaler Konzepte ohne entsprechende wirtschaftliche Voraussetzungen.
Wer sich nicht nach diesen Auflagen richtet, wird bestraft. Der wichtigste Hebel hierzu sind die internationalen Schuldenverhandlungen. Aber auch die neue »Entwicklungszusammenarbeit« der Bundesregierung z.B. definiert die Einführung eines marktwirtschaftlichen Systems und die Einbindung in den Weltmarkt als Voraussetzung, um einem Entwicklungsland Entwicklungshilfe zu geben.
Mit dieser unbedingten Forderung nach Integration in den Weltmarkt setzen die wirtschaftlich Stärkeren rücksichtslos ihre Interessen durch. Die Fortführung der Ausbeutung kann dann auch noch als »höhere Vernunft« bzw. »Hilfe« deklariert werden.
Daß dieses Konzept vor allem auch zur Aufrechterhaltung des ausbeuterischen Status quo dient, läßt sich schon daran erkennen, daß eine »nachholende Entwicklung« nach dem Vorbild der kapitalistischen Industrieländer heute gar nicht mehr möglich wäre. Dies müßte bereits an dem überbordenden Energieverbrauch scheitern, der sich errechnet, wenn man den Pro-Kopf-Verbrauch eines US- oder Bundesbürgers auf die Welt-Bevölkerung umlegt. Anderes Beispiel: Nordrhein-Westfalen leistet sich genau so viele Autos wie der gesamte afrikanische Kontinent.
Alternativen zum Ziel des Wirtschaftswachstums und der Weltmarktintegration
Wirtschaftswachstum und Weltmarktintegration, Wachstumsraten von Bruttosozialprodukt und Welthandel sind keine sinnvollen, jenseits aller gesellschaftlichen Interessen tauglichen wirtschaftspolitischen Zielgrößen. Sie geben keinen Aufschluß über den tatsächlichen Entwicklungsstand, die Lebensqualität oder die Entwicklungschancen der Menschen.
Auch die Zielgröße „qualitatives Wachstum“ (CDU-Leitsätze 1984) bietet hier keinen Ausweg; „qualitatives Wachstum“ ist nur die propagandistische Antwort auf die massive Wachstumskritik seit den siebziger Jahren. Otto Schlecht, der langjährige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, kennzeichnete diesen postulierten Zusammenhang zwischen Wachstum und Umweltqualität einmal so: „Wachstum ist die Voraussetzung dafür, daß die notwendigen Investitionen zum Recycling, zur Abwasserreinigung, zur Vermeidung von Umweltverschmutzung durchgeführt werden können.“ Mit anderen Worten: Das quantitative Wachstumsmodell soll – durch technokratische Umweltnachsorge geringfügig modifiziert – weiterverfolgt werden. Eine Schrumpfung bzw. sogar der Abbau schädlicher Produktionszweige ist weiterhin tabuisiert; die ökologischen Folgen moderner Wachstumsbranchen, z.B. der Gentechnologie, werden weiterhin systematisch verharmlost. Dies gilt auch für das Modernisierungs-Konzept des »sustainable growth«, des dauerhaften Wachstums des Brundtland-Reports (Oxford 1987, S.92f).
Wir müssen uns vom scheinbar neutralen Wachstumsziel verabschieden. Die Frage „Wachstum: Ja oder Nein?“ ist falsch gestellt. Wachstum darf nicht mehr Ziel an sich sein, sondern nur noch als das statistische Ergebnis eines Entwicklungsprozesses angesehen werden, bereinigt um die Folgekosten des Wirtschaftens; es wird damit zu einem Indikator unter vielen. Das gleiche gilt für das Wachstum des Welthandels und die Weltmarktintegration: Beide sind nicht Werte an sich, sondern Instrumente, die wahlweise und nach sorgfältiger Prüfung selektiv einzusetzen sind. Neue Zielgrößen müssen sein: Sicherung der Grundbedürfnisse, Erhalt der natürlichen Umwelt, Verringerung des Ressourcenverbrauchs, soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung der Erwerbslosigkeit u.a.
Solche Ziele können über Indikatorensysteme dargetellt und nachvollziehbar gemacht werden, die eine Vielzahl von quantitativen und qualitativen Elementen enthalten. Indikatorensysteme lassen sich nicht ohne explizite Wertungen, nicht ohne die Benennung von gesellschaftlichen Interessen aufstellen; sie dürften zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, zwischen Ost und West sehr unterschiedlich ausfallen und Kontext-abhängig sein.
Marktwirtschaft und Weltmarktintegration dürfen nicht ideologisch, sondern nur instrumentell betrachtet werden. Ergebnis des Wirtschaftsprozesses dürfte ein selektives Wachstum sein, in dem einige Sektoren der Wirtschaft wachsen, andere schrumpfen; für die Dritte Welt ist eine selektive Weltmarktintegration anzustreben. Dieser wirtschaftliche Umbau kann nicht einem anonymen Weltmarktprozeß bzw. multinationalen Konzernen überlassen bleiben, sondern muß gesellschaftlich und demokratisch entschieden werden.
Dr. Manfred Busch ist wirtschaftspolitischer Sprecher der GRÜNEN im Landtag NRW.