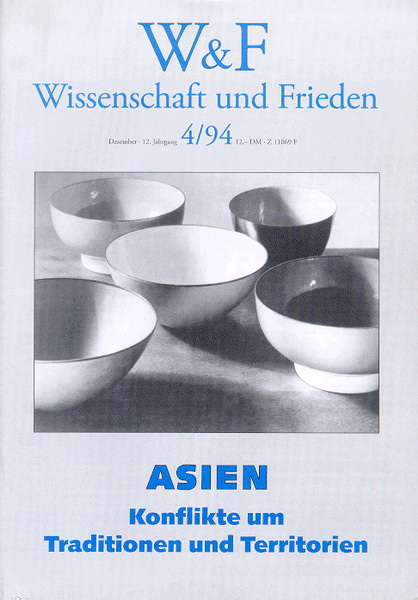Abschied vom Handelsstaat?
Erfahrungen mit der japanischen Blauhelmpolitik
von Hartwig Hummel
Im folgenden Artikel sollen die Entwicklung der Blauhelmdebatte in Japan und ihre Hintergründe näher beleuchtet werden, die aufgrund der Parallelen für die deutsche Debatte von besonderem Interesse sein dürften. Dabei geht es um die Frage, ob die Handelsstaatslogik grundsätzlich weiter gilt oder der in Deutschland sich abzeichnende neue Interventionismus unvermeidlich ist.
Japan und Deutschland gelten als prototypische »Handelsstaaten«1, als Länder, die nicht mehr an den Sinn einer Außenpolitik mit militärischen Mitteln glauben, das Militär deshalb strikt auf Verteidigungsfunktionen beschränken und statt dessen auf den Sachzwang zur zivilisierten Kooperation angesichts weltwirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Problemverflechtungen und Interdependenzen bauen. In den 80er Jahren schien es noch, daß ein langwieriger und schmerzhafter geschichtlicher Lernprozeß – von der »späten« Industrialisierung über den Imperialismus bis zur Niederlage im Zweiten Weltkrieg – in beiden Ländern zur Durchsetzung der Handelsstaatslogik geführt hatte.
Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Proklamation einer »Neuen Weltordnung« stand nun plötzlich die militärische Eindämmung von Regionalkrisen und bedrohlichen »neuen Waffenstaaten« des Südens à la Irak auf der politischen Tagesordnung des Nordens. Beide Länder zwang der zweite Golfkrieg zu einer Grundsatzdebatte über die zukünftige Außen- und Militärpolitik. In beiden Ländern stand die weitere Gültigkeit der Handelsstaatsorientierung auf dem Spiel: sollen und können die bestehenden militärpolitischen Restriktionen weiter aufrechterhalten werden? Oder zeigt der Golfkrieg nicht vielmehr, daß (begrenzte) Kriege wieder gewinnbar und als politisches Instrument nützlich und damit legitimierbar geworden sind? Diese Grundsatzdebatte konkretisierte sich in beiden Ländern schnell auf die Frage nach einem Auslandseinsatz der Streitkräfte bei multinationalen Interventionen vorzugsweise unter dem Dach der Vereinten Nationen (»Blauhelme«).
Japan als Handelsstaat: Kapitulation als soziales Lernen2
Die japanische Politik basierte bis 1945 auf dem Slogan »fukoku kyohei« (reiches Land, starke Armee), also der Verknüpfung eines militärisch starken Staates – nach außen und nach innen – mit der erfolgreichen nachholenden Industrialisierung und Modernisierung Japans. Die Kapitulation Japans 1945 bedeutete das Ende des historischen japanischen Militarismus und die gesellschaftliche Diskreditierung der Militärlogik: Der Krieg hatte Japan international isoliert, eine militärische Eroberungspolitik erwies sich angesichts der Kosten und Opfer des Krieges als unsinnig und ein militärischer Schutz war im Zeitalter des Luftkrieges und der Atombomben unmöglich geworden.
Diese Einsicht prägte die neue Verfassung Japans von 1946. In der Präambel wird ein machtpolitisches Denken abgelehnt und auf die »Gemeinschaft der friedliebenden Völker« als Grundlage der japanischen Sicherheitspolitik verwiesen; damit wird eine Orientierung auf das System der Vereinten Nationen nahegelegt. Artikel 9 der Verfassung verbietet die Aufrechterhaltung von Streitkräften und Kriegspotential in Japan. Die Verfassung wurde ursprünglich auf starken Druck der US-Militärregierung gegen die widerstrebende bürokratische Elite Japans verabschiedet. Spätestens mit dem Beginn des Korea-Krieges verlor die US-Regierung aber das Interesse an der Demilitarisierung Japans und verlangte die Wiederbewaffnung, freilich unter ihrer Kontrolle im Rahmen des bilateralen Sicherheitsvertrags von 1951.
Die Yoshida-Doktrin
Die Wiederbewaffnung Japans wurde zwar von einigen rechten Politikern begrüßt, doch vom seit Ende der 40er Jahre bis 1993 allein regierenden, auf Bürokratie und Wirtschaft sich stützenden konservativ-liberalen Block nur sehr zögerlich umgesetzt und von den Sozialisten und den Gewerkschaften erbittert bekämpft. Praktisch maßgebend wurde die nach dem damaligen Ministerpräsidenten benannte »Yoshida-Doktrin«, d.h. die Konzentration auf die wirtschaftliche Entwicklung bei weitgehender außenpolitischer Zurückhaltung. Nach den Massenprotesten von 1960 gegen den Sicherheitsvertrag mit den USA und dem Rücktritt des nationalistischen Ministerpräsidenten Kishi (ehemaliges Mitglied im Kriegskabinett) setzte sich die Handelsstaatslogik endgültig durch.
Die folgenden Regierungen konzentrierten sich auf die Förderung der exportorientierten Wirtschaft. Außenpolitisch verhielt sich die japanische Diplomatie äußerst zurückhaltend und folgte im allgemeinen der Linie der USA. Dem Militär wurden jedoch enge Grenzen gesetzt:
- strenge zivile (politische) Kontrolle des Militärs und Verzicht auf die Wehrpflicht
- Verbot des Auslandseinsatzes der Streitkräfte und der Beteiligung an kollektiven Verteidigungsbündnissen
- Beschränkung der Bewaffnung und Stärke der Streitkräfte auf Defensivkapazitäten (keine weitreichenden Waffen oder Transportmittel, keine militärische Nutzung des Weltraums, Begrenzung des Militärhaushalts auf 1<0> <>% des Bruttosozialprodukts)
- Verbot von Stationierung, Besitz und Herstellung von Nuklearwaffen in Japan
- Verbot des Rüstungsexports.
Je nach den politischen Kräfteverhältnissen zwischen rechten Falken und Rüstungslobby auf der einen Seite und den wirtschaftsliberalen Tauben und zivilen Großkonzernen auf der anderen Seite und je nach Druck der US-Regierung zu stärkerem militärischem Engagement Japans wurden diese Restriktionen verschärft oder gelockert. Versuche, die Restriktionen aufzugeben, stießen aber sofort auf den erbitterten Widerstand der parlamentarischen Linken und der öffentlichen Meinung, die mit großer Mehrheit hinter der Friedensverfassung stand, auf die Kritik der mißtrauischen Nachbarländer und die Zurückhaltung der Großkonzerne, die ihre Geschäfte nicht durch politische Streitereien stören lassen wollten. In den USA wurde diese japanische Außenpolitik zwar als »Trittbrettfahren« beschimpft, als Abwälzen der militärischen Kosten der Sicherung der japanischen Wirtschaftsexpansion auf die USA, doch letztlich im Rahmen der übergeordneten strategischen Interessen während des Ost-West-Konflikts geduldet.
Japan und das Ende des Kalten Kriegs
In den 80er Jahren wurde angesichts der wirtschaftlichen Probleme US-amerikanischer Unternehmen und des US-Staates die Handelspolitik der USA generell und besonders gegenüber Japan immer konfrontativer. Auch die strategisch motivierte Zurückhaltung gegenüber Japan entfiel mit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Zudem forderten einige Länder Ost- und Südostasiens, Japan solle nach dem teilweisen Rückzug der USA nun regionale Ordnungsfunktionen übernehmen. Die USA verlangten von Japan eine weltpolitische Lastenteilung (»burden sharing«). Daraufhin erhöhte Japan die finanzielle Unterstützung für Flüchtlingshilfe und Wiederaufbauprogramme, schaltete sich diplomatisch in die Beilegung der Konflikte in Afghanistan und zwischen dem Iran und dem Irak ein und entsandte dorthin auch einige zivile Waffenstillstandsbeobachter. Japanische Zivilisten beteiligten sich an den UN-Übergangsverwaltungen in Namibia (UNTAG) und Kambodscha (UNTAC).3
Auch innenpolitisch geriet der Handelsstaat Japan in eine Krise. Die korruptionsanfällige Monopolherrschaft der LDP und die lähmende Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Bürokratie wurden immer stärker kritisiert. 1989 verlor die LDP ihre parlamentarische Mehrheit im Oberhaus. Die Strukturen des politischen System erwiesen sich zudem als ungeeignet, auf die außenpolitischen Herausforderungen angemessen zu reagieren (schwache Position des Ministerpräsidenten, kleiner außenpolitischer Apparat, Rivalitäten zwischen Parteifraktionen der LDP und zwischen Ministerien, Obstruktionstaktik der Opposition).
Die Golfkrise und das PKO-Gesetz
Die Golfkrise 1990/91 zwang Japan schließlich zu einer Grundsatzdiskussion, insbesondere zur Auseinandersetzung mit der zukünftigen Rolle des Militärs. Die japanische Regierung wurde durch die USA massiv bedrängt, nicht nur indirekt, also finanziell und durch die Bereitstellung der US-Basen in Japan, sondern auch direkt und personell zur Golfkriegsallianz beizutragen. Zunächst wollte sich die Regierung vor einer klaren Entscheidung drücken: im Januar 1991 wurden durch juristische Tricks japanische Militärflugzeuge für die Evakuierung von Flüchtlingen aus der Golfregion bereitgestellt, die dann aber gar nicht mehr gebraucht wurden, und im Sommer 1991 beteiligte sich ein japanischer Minenräumverband von 500 Mann ohne klare rechtliche Grundlage an der Minenräumung im Golf. Erst im Juni 1992 billigte das japanische Parlament das Gesetz zur Beteiligung an friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen (»PKO-Gesetz«). Die Regierung war damit zweimal Ende 1990 und Ende 1991 im Parlament gescheitert. Erst ein wesentlich restriktiverer Gesetzentwurf der LDP konnte mit Hilfe von zwei kleineren Oppositionsparteien gegen den erbitterten Widerstand der Sozialisten und Kommunisten verabschiedet werden.
Nach dem PKO-Gesetz darf die japanische Regierung bis zu 2000 Soldaten und Zivilisten zu UN-Einsätzen entsenden, allerdings nur zu friedenserhaltenden Maßnahmen, nicht aber zu Kampfeinsätzen. Bedingungen für die japanische Beteiligung sind ein Waffenstillstand und die Zustimmung aller Konfliktparteien. Sind diese Bedingungen nicht mehr gegeben, muß das japanische Kontingent abgezogen werden. Die japanischen Soldaten dürfen leichte Waffen tragen, die ausschließlich zur Selbstverteidigung bestimmt sind. Auf Drängen der Opposition sind Aufgaben mit militärischem Charakter (z.B. Trennung und Entwaffnung der Konfliktparteien) vorerst nicht erlaubt. Außerdem müßte das japanische Parlament jedem PKO-Einsatz mit militärischem Charakter zustimmen. Gegenwärtig können also japanische Soldaten nur im Logistikbereich (z.B. Kommunikationseinrichtungen, medizinische Versorgung, bestimmte Arten von Transporten) eingesetzt werden. Das PKO-Gesetz muß 1995 einer Überprüfung unterzogen werden.
Die Golfkrise löste ein außenpolitisches Umdenken aus. Die »Nationalisten« wollen nun eine Revision der Nachkriegsordnung (Verfassungsänderung, Aufhebung der Unterordnung unter die USA) und plädieren für eine militärische Selbständigkeit und unabhängige Aufrüstung der »Mittelmacht/Großmacht« Japan – zum Teil bis hin zur nuklearen Bewaffnung. Sie befürworten die Gleichrangigkeit der führenden westlichen Industrieländer und daher eine größere außenpolitische Selbständigkeit Japans auch gegenüber der niedergehenden Weltmacht USA. Der konservativ-liberale »mainstream« sieht Japan weiterhin als Handelsstaat. Die wirtschaftlichen Interessen Japans seien nur in einer kooperativen Beziehung mit den anderen westlichen Industrieländern, vor allem den USA, zu sichern, allerdings müsse Japan zukünftig mehr Aufgaben übernehmen. Die japanischen Streitkräfte werden weniger militärisch begründet, sondern eher als Preis betrachtet, um die Allianz mit den USA (und damit auch den Zugang zum US-Markt) zu erhalten. Im Sinne einer »umfassenden Sicherheit« soll sich die japanische Außenpolitik aber vor allem auf Wirtschaftshilfe stützen. Die »Antimilitaristen« sind sich einig in der Unterstützung der japanischen »Friedensverfassung« als Überwindung des japanischen Militarismus und als Versöhnungsgeste gegenüber den Nachbarländern. Noch bis zum Parteitag im September 1994 lehnten die Sozialisten eine nationale militärische Verteidigung und das Militärbündnis mit den USA ab. Während Nationalisten und »mainstream« eine Beteiligung an UN-Einsätzen befürworten, akzeptieren die Antimilitaristen wenn überhaupt nur eine zivile Beteiligung, möglichst durch ein von den Streitkräften getrenntes ziviles japanisches Friedenscorps.
Blauhelmeinsätze und Regierungswechsel
Im September 1992 schickte die japanische Regierung auf der Grundlage des »PKO-Gesetzes« ein japanisches Kontingent von etwa 600 Soldaten und 75 Zivilpolizisten zur UNTAC, der UN-Mission in Kambodscha, hauptsächlich für den Straßenbau und die Logistik. Gleichzeitig wurden drei Offiziere als Wahlbeobachter nach Angola geschickt, aber gegen den Protest der UNO aus Sicherheitsgründen nach kurzer Zeit wieder zurückberufen. Angesichts der wieder aufflammenden Kämpfe in Kambodscha forderten die Oppositionsparteien unter Berufung auf das PKO-Gesetz den Abzug der japanischen Blauhelme. Anfang April 1993 wurden ein japanischer Wahlhelfer, Anfang Mai ein japanischer Zivilpolizist getötet und acht weitere verletzt. Obwohl in Japan die vorzeitige Rückkehr der japanischen Blauhelme gefordert wurde, beendete die Regierung den Kambodscha-Einsatz planmäßig erst im September 1993. Bitten um Beteiligung an den UN-Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien und in Somalia lehnte die japanische Regierung ab. Im Mai 1993 wurden dagegen 53 japanische Soldaten zur UN-Mission in Mosambik (ONUMOZ) geschickt und übernahmen dort logistische Aufgaben.
Bei den Unterhauswahlen am 18.7.93 verlor die LDP ihre bisherige parlamentarische Mehrheit. Die neuen konservativen Parteien, die sich von der LDP abgespaltet hatten, bildeten zusammen mit den bisherigen nichtkommunistischen Oppositionsparteien die Koalitionsregierung Hosokawa. Trotz tiefreichender politischer Meinungsunterschiede einigte der Wunsch nach überfälligen politischen Reformen die Koalitionsparteien. In der Militärpolitik reichten die Positionen vom Antimilitarismus der sozialistischen Linken bis zur Forderung konservativer Politiker (z.B. Ozawa), japanische Soldaten sollten sich an multinationalen Kampfeinsätzen zur Sicherung des Weltfriedens beteiligen. Die Koalition einigte sich auf die Beibehaltung des Status quo. Einige der bisherigen politischen Bremsen gegen eine Ausweitung militärischer Aktivitäten verloren jedoch an Wirkung. Die Kritik der Sozialisten an der PKO-Politik wurde leiser, nachdem sie bei den Wahlen empfindliche Einbussen hinnehmen mußten und wegen ihrer Teilnahme an der Regierungskoalition vor einer innerparteilichen Zerreißprobe standen. Die Anerkennung der japanischen Kriegsschuld durch Ministerpräsident Hosokawa half, den Widerstand in den asiatischen Nachbarländern gegen eine japanische PKO-Beteiligung abzubauen. Schließlich schwächte sich der kontrollierende Einfluß der US-Regierung auf die japanische Militärpolitik ab, den sie bisher über ihre Verbindungen zur LDP ausübte.
Ernsthafte Spannungen zwischen den Koalitionspartnern wurden im Zusammenhang mit der Krise um Nordkorea Anfang 1994 sichtbar. Die konservativen Parteien der Koalitionsregierung forderten eine Stärkung der Krisenmanagement-Kapazitäten und eine aktive Beteiligung der japanischen Marine bei der militärischen Durchsetzung etwaiger Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea. Die Sozialisten lehnten dies strikt ab. Aus diesem und anderen Gründen verließen sie die Koalition, die unter Hata bis zum Sommer als Minderheitenkabinett weiterregierte.
Ende Juni 1994 trat die Hata-Regierung zurück. Überraschend bildeten Sozialisten und LDP zusammen mit der Sakigake-Partei eine Große Koalition. Die LDP verlangten von den Sozialisten als Bedingung für Koalition und Ministerpräsidentenamt u.a. die Akzeptanz des militärpolitischen Status quo, insbesondere die Anerkennung der Verfassungsmäßigkeit der Streitkräfte und des Sicherheitsvertrags mit den USA sowie die Akzeptanz japanischer Blauhelme. Auf ihrem Parteitag am 3.9.94 verabschiedeten die Sozialisten nach heftiger Debatte ein neues militärpolitisches Programm. Darin heißt es, daß Japan sich aktiv an solchen UN-Friedensmissionen beteiligen soll, die keine Gewaltanwendung beinhaltet. Befürwortet wurde eine Änderung der UN-Charta, um stehende, multinational zusammengesetzte UN-Friedenskräfte unter einheitlichem Kommando aufzustellen. Auch Japan solle einen Beitrag zu diesen Friedenskräfte leisten. Außerdem fordern die Sozialisten die gesetzliche Festschreibung der bestehenden militärpolitischen Restriktionen.
Nach anfänglicher Zurückhaltung griff die neue Regierung die Idee wieder auf, für Japan einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu fordern. Außenminister Kono meldete in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am 27.9.94 offiziell diese Forderung an, machte aber den Vorbehalt, daß Japan sich nicht an militärischen Aktionen beteiligen werde, weil dies die japanische Verfassung verbiete. Japan werde sich jedoch weiterhin an nichtmilitärischen Aspekten von UN-Friedensmissionen nach dem Beispiel der Einsätze in Kambodscha oder Mosambik beteiligen.
Aufgeschreckt durch die Massenflucht aus Ruanda in die Nachbarländer schickte die japanische Regierung im September 1994 mit Billigung der Sozialisten 470 Soldaten, davon 100 Luftwaffenangehörige, zu einem humanitären Hilfseinsatz nach Zaire und Kenia. Eine japanische Beteiligung an der Militärintervention in Haiti lehnte die japanische Regierung dagegen ab. Für das Frühjahr 1995 ist ein Einsatz japanischer Waffenstillstandsbeobachter auf den Golan-Höhen geplant.
Die Zukunft Deutschlands und Japans als Handelsstaaten
Sowohl in Deutschland als auch in Japan scheint die Blauhelmpolitik auf den ersten Blick Tendenzen zu einer Militarisierung zu belegen. Erstmals werden bewaffnete Einheiten der Streitkräfte außerhalb der Landesgrenzen eingesetzt, nachdem die gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Schranken gefallen sind. Beide Länder halten sich in der Außenpolitik nicht mehr zurück, sondern streben einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat an und wollen damit letztlich über den Einsatz von UN-Blauhelmen mitbestimmen. Das Mißtrauen der Nachbarländer und der Widerstand der Öffentlichkeit gegen Auslandseinsätze ist geschwunden. Blauhelmeinsätze scheinen militärischen Maßnahmen in der Außenpolitik wieder einen Sinn zu geben.
Eine nähere Betrachtung zeigt aber keine Abkehr Japans von der Handelsstaatslogik. Unter den neuen Verhältnissen stellte sich der »Pazifismus in einem Land« der Yoshida-Doktrin oder des früheren Parteiprogramms der Sozialisten als hinderlicher Isolationismus heraus und machte einem Konsens zu einer aktiveren Außenpolitik Platz. Dabei wird die Militärlogik allerdings weiterhin als unsinnig angesehen, was das Unbehagen an den von den USA initiierten Militärinterventionen in Somalia und Haiti belegt, an denen sich Japan nicht beteiligt hat. Das PKO-Gesetz schließt folgerichtig die Anwendung militärischer Gewalt aus. Möglicherweise wird es 1995 revidiert werden, aber dann vor allem deshalb, weil einige Bestimmungen nicht zur Realität von Blauhelmeinsätzen passen. Die eher symbolischen Einsätze japanischer Blauhelme werden in Japan primär bündnispolitisch und damit letztlich wirtschaftspolitisch begründet: die Handelsstreitigkeiten mit den USA und anderen westlichen Industrieländern sollen nicht noch weiter angeheizt werden. Eine Beteiligung am Entscheidungsprozeß des UN-Sicherheitsrates macht daher einen ganz anderen Sinn als oben angedeutet: eine unsinnige Militarisierung der doch für die Weltordnung so wichtigen UNO soll gebremst und die innenpolitsch weiterhin umstrittenen Kosten und Opfer der japanischen Beteiligung sollen minimiert werden. Funktion und Image der Streitkräfte haben sich in Japan durch die Blauhelmeinsätze im Grunde nicht verändert: sie werden weiterhin sozusagen als technisches Hilfswerk beim Katastrophenschutz angesehen. Aus dem politischen Entscheidungsprozeß schließlich bleiben sie weiterhin ausgeklammert.
Japan erweist sich somit auch in der PKO-Frage als prototypischer Handelsstaat. Die deutsche Politik scheint sich dagegen zunehmend in Richtung auf eine gesamtdeutsche oder gesamteuropäische Weltpolizistenrolle zu entwickeln und sich dadurch immer mehr am »machtstaatlichen« und immer weniger am »handelsstaatlichen« Denken zu orientieren.
Handelsstaatslogik und strukturelle Gewalt
Über die Handelsstaat-Debatte hinaus sollte eine grundsätzliche friedenspolitische Bewertung der Blauhelmpolitik Deutschlands und Japans aber an einem ganz anderen Punkt ansetzen: Der Grund für eine verstärkte außenpolitische Rolle der Handelsstaaten liegt in deren Wirtschaftsexpansion. Diese ist auf die Aufrechterhaltung der »neuen Weltordnung« angewiesen, einer Weltordnung, die nach wie vor auf asymmetrischen Machtverhältnissen und Lebenschancen beruht und insofern durch strukturelle Gewalt im Sinne Galtungs4 geprägt ist. UN-Blauhelme sind nichts anderes als Teil des »residualen Militärpotential« der verbündeten Handelsstaaten zum Schutz vor den militärischen Machtstaaten im Sinne von Rosecrance und letztlich Teil dieser strukturellen Gewalt.
Anmerkungen
1) Klassisch: Rosecrance, Richard: Der Neue Handelsstaat. Frankfurt/M., 1987. Zurück
2) Ausführliche Literaturhinweise in: Hummel, Hartwig: Japanische Blauhelme. Von der Golfkriegsdebatte zum »PKO-Gesetz«, in: INEF-Report, Heft 3/1992, 2. aktualisierte und verbesserte Auflage, Duisburg, 1994; Hummel, Hartwig: Japan: Schleichende Militarisierung oder Friedensmodell?, in: Militärpolitik Dokumentation, Heft 88/89, Frankfurt/M., 1992. Zurück
3) Yasushi Akashi, ein japanischer UNO-Beamter, erhielt zudem die Leitung von UNTAC und danach von UNPROFOR. Zurück
4) Galtung, Johan, 1969: Violence, Peace and Peace Research, in: Journal of Peace Research 6 (1969), 167-191. Zurück
Dr. Hartwig Hummel war bis 1993 als Politikwissenschaftler am Zentralinstitut für Ostasienwissenschaften der Universität-GH-Duisburg tätig und arbeitet jetzt am Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie der TU Braunschweig.