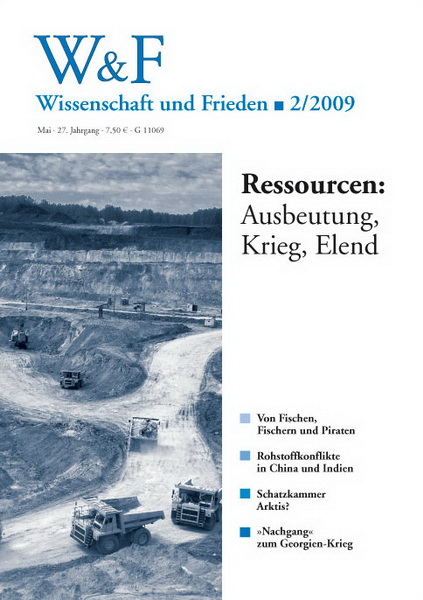Afghanistan – die Dialektik eines prominenten Diskurses
von Thorsten Hinz
Afghanistan gehört seit dem 11. September 2001 zu den Ländern, die in den internationalen Debatten überpräsent sind. Diese Überrepräsentanz hat vor allem mit dem militärischen Engagement des Westens zu tun. Es ist ein Diskurs, der über die Jahre erschreckend wenig Fortschritte und Ergebnisse für die viel geplagte afghanische Zivilgesellschaft erbracht, dafür aber umso mehr Hoffnungen auf internationale Friedenslösungen untergraben hat. Es scheint das alte Wort von Max Horkheimer und Theodor Adorno zu gelten – es darf viel geredet werden, aber niemand hört mehr hin. Es ist ein Reden und Schreiben, das in der Wirkungslosigkeit und im Scheitern zynisch wird. Auch Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisationen sowie Hilfswerke müssen sich im Falle Afghanistan fragen, was sowohl ihre Arbeit als auch ihre Kritik bislang für Folgen gezeitigt hat, inwieweit sie nicht selbst Teil eines sich im Kreise drehenden Diskurses sind.
Terrorgefahr
Die Präsenz des westlichen Militärs in Afghanistan wird durch die Terrorgefahr legitimiert, die sich augenscheinlich im Treiben von Al-Kaida und Taliban zeigt und das als eine weltweite Gefahr gesehen wird. Es ist zum einen dieses Terror- und Bedrohungsargument, das zum größten und teuersten Bundeswehr-Einsatz außerhalb Deutschlands geführt hat, mit mittlerweile rund 4.500 in Afghanistan stationierten Soldaten und Soldatinnen. Das Terrorargument wird aber zugleich von der deutschen und den anderen am ISAF-Mandat beteiligten Regierungen durch das Schutz- und Sicherungsargument ergänzt. ISAF steht für International Security Assistance Force und bezeichnet das militärische Mandat, das der UN Sicherheitsrat mit der Resolution 1386 nach dem Sturz der Taliban zum Schutz der Karzai-Übergangsregierung Ende 2001 ausgesprochen hatte. Das UN-Mandat umfasste damals 5.000 Soldaten. Nach der Niederlage des Taliban-Regimes sollten die im Dezember 2001 auf dem Petersberg bei Bonn benannte Übergangsregierung sowie die afghanische Zivilbevölkerung beim Neuanfang, bei der Neuordnung und dem Wiederaufbau beschützt und begleitet werden.
In Reden über das Terror- bzw. Bedrohungsargument wird von Politikern fast aller Bundestagsfraktionen immer wieder betont, dass die »westliche Freiheit und Demokratie am Hindukusch verteidigt werden müsse«. Die dortige Präsenz der Bundeswehr leiste einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von geplanten Terroranschlägen in der westlichen Welt, so der Tenor. Entsprechend folgerichtig scheint auch die immer wieder mit einer breiten Mehrheit erfolgende Verlängerung des Afghanistan-Mandates im Bundestag zu sein, zuletzt im Herbst 2008. Interessanterweise widersprechen diese Mehrheiten der durch zahlreiche Erhebungen erfragten Stimmung in der deutschen Bevölkerung. Bis zu 70% der Bürger und Bürgerinnen haben sich Ende 2008 in verschiedenen Umfragen eindeutig gegen das Engagement der Bundeswehr in Afghanistan ausgesprochen. Diese Ablehnung speist sich allerdings weniger aus einer grundsätzlichen kritischen Haltung gegenüber dem Bedrohungsargument als vielmehr aus der Sorge, dass die Bundeswehr sich in einen endlosen Krieg mit zahllosen Opfern in den eigenen Reihen verwickeln könnte.
Es ist unbestritten, dass Al-Kaida ein hochgefährliches Terror-Netzwerk ist, das nachweislich in aller Welt schreckliche Attentate mit zahllosen Opfern verübt hat, insbesondere unter der Zivilbevölkerung. Richtig ist auch, dass in Zeiten des Taliban-Regimes Al-Kaida unter Führung von Osama Bin Laden in Afghanistan Unterschlupf gesucht und gefunden hat. Mit dem 11. September 2001 und dem Sturz des Taliban-Regimes ist allerdings eine radikale Wende der Gesamtsituation eingetreten. Al-Kaida und andere weltweit operierende Terror-Netzwerke sind heute extrem mobile und flexible Strukturen, die überall zuschlagen können. Es sind Einheiten, die immer stärker ohne Anbindung an eine Hierarchie agieren, die keinem spezifischen Befehl folgen und die unter bestimmten Bedingungen in nahezu jeder mitteleuropäischen Kleinstadt entstehen können. Die Londoner Bombenanschläge vom 7. Juli 2005 wurden von solcherart Attentäter durchgeführt. Auch die 2008 enttarnte »Sauerland-Gruppe« spiegelt diese ganz andere Bedrohungssituation wider. Es ist eine Bedrohung, die kein afghanisches oder pakistanisches Hinterland mehr braucht. Der Journalist und Taliban-Experte Ahmed Rashid hat in gut recherchierten Beiträgen immer wieder erläutert wie diese moderne »omnipotente Bedrohung«, oder konkreter: ein „weltumfassender Dschihad“, ihren Anfang nahmen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Islamistische Kreise hatten damals die westliche Welt als negative Bedrohungs- und Projektionsfläche entdeckt.
Selbstredend spielt bei den weltweit vernetzten Terror-Netzwerken auch die »elektronische Globalisierung« eine maßgebliche Rolle. Das Internet bietet unzählige Optionen, um sich virtuell zu treffen, zu besprechen und voneinander zu lernen. Baupläne für Bomben und Sprengfallen, Anschlagsaufrufe sowie Attentats-Konzepte kursieren in großer Zahl und lassen sich selbst von Computer-Amateuren mit entsprechenden Sprachkenntnissen relativ leicht finden. Natürlich ist unumstritten, dass in hochsensitiven Konflikt- und Krisenregionen wie beispielsweise in Kaschmir, Palästina, Jemen, Sudan, Somalia, Kongo, Kolumbien oder eben auch Afghanistan asymmetrische Terrorstrukturen viel leichter gedeihen und wachsen als in stabilen sozial-ökonomischen Verhältnissen. Die knappe und bei weitem unvollständige Aufzählung zeigt allerdings das Dilemma, in das die USA die Welt mit ihrem Aufruf zum »war against terror« gestürzt hat. Es ist ein Aufruf, der verlangen würde, dass überall dort, wo sich Terror-Netzwerke aufhalten oder aufhalten könnten, militärisch interveniert werden müsste. Der Aufruf hat eine Hybris entfesselt, in die unter anderem der Irak-Krieg, der Libanon-Krieg zwischen Israel und Hizbollah und die heftigen Konflikte mit dem Iran als einer aus westlicher Sicht potenziell gefährlichen Mittelmacht zu subsumieren sind.
Die Debatte über so genannte »humanitäre militärische Interventionen«, sich berufend auf die UN-Resolution 60/1 (2005), ist seit den »Balkan-Interventionen« und dem Scheitern der Weltgemeinschaft beim Genozid in Ruanda eine der großen Themen auf der Ebene der Vereinten Nationen. Verkürzt dargestellt geht es um die Klärung folgender Frage: Was sind die Eindämmungs- oder Verhinderungspotentiale der Weltgemeinschaft im Falle regionaler oder nationaler massiver Menschenrechtsverletzungen?
In der Diskussion um das Terrorargument muss nicht zuletzt darauf hingewiesen werden, dass die Taliban eine eindeutig regionale, aber durchaus heterogene Bewegung sind, die vor allem zwei Dinge eint: erstens ein radikal sunnitisch geprägter Islam wie er in den Madrassas im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet gelehrt wird und zweitens das Ziel, Afghanistan von jeglicher Fremdherrschaft frei zu halten. Die Taliban haben keine globale Perspektive und taugen entsprechend nur sehr begrenzt für die Bedrohungsszenarien, die in Westeuropa und den USA als Rechtfertigung für den Einsatz dienen.
Schutz und Sicherheit
Das zweite entscheidende Argument für die Präsenz des Westens am Hindukusch dreht sich um den Schutz der afghanischen Bevölkerung. Es ist ein Schutz- und Sicherungsargument, das sich sowohl im militärischen ISAF-Mandat ausdrückt als auch im zivilen UNAMA-Mandat (UNAMA = United Nations Assistance Mission in Afghanistan). Beide Mandate sind Ergebnisse der Bonner Petersberg Konferenz und haben bis heute den Auftrag, die afghanische Regierung zu schützen und zu unterstützen. Die obige kurze Reflexion über die Taliban hat bereits angedeutet, dass das Phänomen »Taliban« mit dem durch US-Kräfte massiv unterstützten Sieg der Nordallianz im Herbst 2001 nicht sein Ende gefunden hat. Die Rückkehr und Machtentfaltung der Taliban ist für viele westliche Beobachter ein Absurdum, sollte doch gerade der afghanischen Bevölkerung das Leid aus den Jahren von 1996 bis 2001 – symbolisiert mit Begriffen wie Burka, Scharia und Steinigungen – noch sehr bewusst sein. Übersehen wird dabei, dass es gerade unverhältnismäßige westliche Militär-Aktionen sind, die die afghanische Bevölkerung verunsichern, ihr den Eindruck einer Besatzung vermitteln und sie für Taliban-Offerten anfällig macht. Allein im Jahr 2008 ist die ohnehin bereits hohe Zahl der Zivilopfer um weitere 40% angestiegen. Hier wirkt auch das kollektive Trauma der sowjetischen Okkupationszeit (1979-1989) nach. Die Gewaltspirale in den Kämpfen zwischen ISAF/NATO- und OEF-Verbänden gegen Taliban und andere Aufständische, bei denen es in den letzten acht Jahren mehrere Tausend zivile Opfer zu beklagen gibt, tut ein Übriges. Viele Afghanen sehen sich inzwischen in Kriegszeiten zurückgekehrt. Es ist ein Krieg, bei dem sie sich von denen, die sie eigentlich schützen sollten, nicht geschützt fühlen. Sie sehen NATO-Truppen, die sich in ihren Camps und Kasernen verbarrikadiert haben und kaum noch Kontakt zur Zivilbevölkerung zulassen. Schließlich sind sie mit einer jungen afghanischen Armee und Polizei konfrontiert, in denen Korruption, willkürliche Gewalt und Überläufertum grassieren.
Astrid Suhrke beschreibt in einem Aufsatz von 2008 wie sich die NATO, die das ISAF-Mandat leitet und maßgeblich ausübt, von der ursprünglich gewollten Stabilisierungs- und Schutzrolle in einen Krieg hat manövrieren lassen, wie aus einem militärischen „light footprint“ ein „heavy footprint“ wurde, mit jetzt mehr als 61.000 NATO-Soldaten in Afghanistan (Stand: 13. März 2009). Einen der entscheidenden Gründe hierfür sieht sie in der immer enger gewordenen Verflechtung von ISAF- und OEF-Mandat (Suhrke 2008). Auch wenn Politiker formell und aus gutem Grund auf die Trennung der beiden Mandate hinweisen, ist diese »Trennung« aus Sicht der afghanischen Bevölkerung nicht mehr existent. Die Bevölkerung sieht keinen Unterschied mehr zwischen Einsätzen, bei denen »Terroristen« gejagt werden, oder solchen, bei denen sie selbst eigentlich geschützt werden sollte und doch im Rahmen der Aufstandsbekämpfung immer wieder die höchsten Opferzahlen zu beklagen hat. Suhrke rät deshalb der NATO dringend größere Kampfeinsätze, Luftangriffe und Offensiven künftig zu vermeiden, will sie nicht den letzten Rest an Vertrauen und Hoffnung bei der Zivilbevölkerung verspielen. Fatal wirken auch Äußerungen von hochrangigen US-Militärs, die immer unverhohlener eine Zusammenführung von ISAF- und OEF-Mandat fordern und damit zusätzlich den eigentlichen Schutz- und Sicherungsauftrag der ISAF untergraben. Bei der Entsendung der deutschen »Tornados« nach Afghanistan war auch nicht von ungefähr eine der kritischsten Fragen, inwieweit diese nicht eher den OEF-Truppen nützen als den ISAF-Truppen. Manche europäische Politiker und Militärs mögen über die zunehmende Feindschaft und Ablehnung innerhalb der afghanischen Zivilbevölkerung alarmiert sein. Sie verhindern damit nicht, dass die Glaubwürdigkeit des Westens immer weiter und immer schneller erodiert. Theodor Fontane hat nach einer von drei gescheiterten britischen Afghanistan-Invasionen eine lyrische Mahnung formuliert, die höchst aktuell klingt: „Die hören sollen, sie hören nicht mehr/ Vernichtet ist das ganze Heer,/ Mit dreizehntausend der Zug begann,/ Einer kam heim aus Afghanistan.“
Schwierige Hilfe
Das kurze Nachdenken über die Legitimierung der westlichen Präsenz in Afghanistan gibt ein besseres Verständnis für die problematischen Rahmenbedingungen, in denen Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisationen sowie Hilfswerke ihrem humanitären Mandat in Afghanistan zu entsprechen versuchen. Es ist ein Kontext, der in den letzten Jahren immer schwieriger und politischer geworden ist. Es ist ein Kontext, in dem die humanitären Mandate ihre Unabhängigkeit immer wieder neu behaupten müssen.
Die Afghanistan-Konferenz in Paris im Juni 2008 hatte Vertreter von 90 Staaten und internationalen Organisationen zusammengerufen, um Bilanz über den Stand von Wiederaufbau, Entwicklung und Stabilisierung zu ziehen. Während der Konferenz wurde auch die so genannte Nationale Afghanische Entwicklungsstrategie (ANDS) vorgestellt. In ihr hat die afghanische Regierung einen Plan für die wichtigsten Bereiche des Wiederaufbaus bis zum Jahr 2012 ausgearbeitet. Das, was die afghanische Regierung im Zusammenspiel und mit Unterstützung von UNAMA und den Unterstützer-Staaten im zivilen Bereich über das »National Solidarity Program« (NSP) und die »Afghanistan National Development Strategy« (ANDS) an Aufbau und Entwicklung zu verwirklichen versuchte, ist allerdings bis heute nur wenig erfolgreich gewesen.
Nach wie vor lebt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in extremer Armut und hat nur geringe Aussichten, dem Kreislauf der Not zu entkommen. Matt Waldman, der Afghanistan-Experte der britischen Hilfsorganisation »Oxfam«, hat im Vorfeld der Pariser Afghanistan-Konferenz gemeinsam mit der Dachorganisation der in Afghanistan engagierten Nichtregierungsorganisationen ACBAR (Agency Coordinating Body For Afghan Relief) die Studie »Falling Short. Aid Effectiveness in Afghanistan« veröffentlicht (Waldman 2008). Die Studie kommt zu einem vernichtenden Urteil über die bislang geleistete Hilfe: 100 Millionen US-Dollar an täglichen Militärkosten für die US-Streitkräfte stehen sieben Millionen US-Dollar an täglichen zivilen Hilfen aller Geldgeber gegenüber. Von 39 Milliarden US-Dollar, die die internationale Staatengemeinschaft für die Jahre 2002 bis 2011 an Hilfe zugesagt hat, wurden bislang nur 40 Prozent eingelöst. Länder wie Indien, Spanien oder Frankreich kommen ihren Zusagen nur sehr schleppend nach. Auch die Asiatische Entwicklungsbank hat bislang nur ein Drittel ihrer Zusagen eingelöst. In den Jahren 2002 und 2003 betrug die Pro-Kopf-Hilfe für Afghanistan jährlich 57 US-Dollar. Das kontrastiert beispielsweise mit Ländern wie Bosnien oder Ost-Timor, in denen die jährliche Pro-Kopf-Hilfe in den ersten zwei Einsatzjahren 679 US-Dollar beziehungsweise 233 US-Dollar betragen hatte. In den Jahren 2007/2008 zeigte sich, dass afghanische Kriegsprovinzen wie Helmand, Zabul, Nimroz und Uruzgan eine Pro-Kopf-Hilfe von jährlich rund 200 US-Dollar erhalten haben. Relativ friedliche Provinzen dagegen, die zudem zu den ärmsten in Gesamtafghanistan zählen, wie beispielsweise Sari Pul, Daikundi oder Takhar, empfingen in diesen Jahren dagegen nur etwa 60 US-Dollar Pro-Kopf-Hilfe. Dieser Umstand hat zu Recht die Bewohner dieser Regionen fragen lassen, ob Krieg ein Kriterium für die Vergabe von zivilen Leistungen sei.
Besonders kritisch ist zudem, dass in Afghanistan große Teile der ohnehin spärlichen Entwicklungshilfe für sicherheitsrelevante Bereiche verausgabt werden und damit nicht mehr der Armutsbekämpfung zur Verfügung stehen. Über die Zivil-Miliärische Zusammenarbeit erfolgt dabei eine hochproblematische Vermischung, teilweise bis hin zu dem Punkt einer direkten Kriegsunterstützung. Ein Beitrag im »Small Wars Journal« (Mann 2008) mit dem bezeichnenden Titel »Die Integration von Spezialeinheiten und USAID in Afghanistan« etwa beschreibt, auf welche Weise die US-Entwicklungshilfeagentur dort einen direkten Beitrag zur Aufstandsbekämpfung leistet. Sie vergibt gezielt Gelder als „Belohnung für Gemeinden, die Aufständische hinausgeworfen haben“ und zur „Stärkung der örtlichen Bereitschaft und der Fähigkeiten, sich den Aufständischen zu widersetzen.“ Weiter gehe es für USAID darum, die „Aufständischen von der Bevölkerung zu isolieren.“ Der Beitrag endet folgerichtig mit dem Fazit: „Die Entwicklungshilfeagenturen müssen die Samthandschuhe ausziehen.“
Vor diesem Hintergrund kritisierte »Caritas international« (2008), dass „die Ausschüttung der Hilfsgelder nicht an den tatsächlichen Hilfs-Bedarf gekoppelt ist, sondern sich vielmehr an der Aufstandsbekämpfung orientiert.“ Damit verlieren zivile Organisationen, selbst die, die eine solche Kooperation ablehnen, ihre – für die Gewährleistung humanitärer Hilfe und für die Sicherheit der Helfer essenzielle – politische Neutralität. Sie werden in den Augen der afghanischen Bevölkerung zu integralen Bestandteilen des Besatzungsregimes und damit zu Gegnern. Zu einem ähnlichen Schluss gelangt auch die »Stiftung Wissenschaft und Politik« (Hoffmann 2008, S.49): „Die Verquickung staatlicher und nichtstaatlicher Ansätze raubt der zivilen Hilfe zunehmend jene Eigenständigkeit, die sie gerade ihrem nicht-staatlichen Charakter verdankt, und lässt sie als Teil der politisch-militärischen Strategie der in Afghanistan präsenten Staaten erscheinen.“
All diese Faktoren tragen dazu bei, dass in Afghanistan erschreckenderweise weiterhin 4,5 Millionen Menschen unter extremem Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser leiden. Eine Millionen Kleinkinder und Babys sind unterernährt und haben weltweit gesehen mit die schlechtesten Chancen, ihr fünftes Lebensjahr zu erreichen. Auch im achten Jahr der internationalen Hilfe für Afghanistan zählt die Mütter- und Kindersterblichkeit zu den höchsten in der Welt. Nahezu fünf Millionen mehrheitlich unfreiwillige Rückkehrer aus den Nachbarstaaten Pakistan und Iran wissen nicht, wie sie ihren täglichen Lebensunterhalt bewältigen und wie sie in einem Land mit zerstörter Infrastruktur soziale und wirtschaftliche Perspektiven aufbauen können.
Auswege
In zwei Positionspapieren fordern die in Afghanistan engagierten deutschen Hilfsorganisationen folgerichtig von der internationalen Staatengemeinschaft dreierlei, will man nicht alsbald in Afghanistan scheitern (VENRO 2008/2009): Erstens muss in gemeinsamen Anstrengungen der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen und eine realistische Exit-Strategie für das Militärengagement definiert werden. Zivile und militärische Mandate dürfen nicht vermischt werden, was in der Konsequenz bedeutet, dass »Regionale Wiederaufbauteams« (PRT) und »Regionale Beraterteams« (PAT) aufzulösen sind. Insbesondere wird auch vor Überlegungen gewarnt, dass die Zivil-Militärische Zusammenarbeit künftig von Afghanistan „auf andere Konflikt- beziehungsweise Post-Konfliktszenarien übertragen wird“ (VENRO 2009). Zweitens muss sich sowohl finanziell als auch in den Aktivitäten ein klarer Vorrang von zivilem Aufbau und nachhaltiger Entwicklung zeigen. Drittens sollen sich alle Seiten dafür einsetzen, Menschenrechte zu schützen und Versöhnung anzuregen. Dazu gehört, dass das von der Karzai-Regierung verabschiedete und von den USA unterstützte Amnestiegesetz zurückgenommen wird. Gerade die Kooperationen von NATO-Truppen und afghanischer Regierung mit ehemaligen Kriegsverbrechern und aktuellen Warlords sorgen für hohe Frustration innerhalb der afghanischen Zivilbevölkerung.
Diese drei Hauptanliegen benennen einen Rahmen, in dem die humanitäre Hilfe in Afghanistan neu gedeihen und ihre Kompetenz und ihre Nähe zur afghanischen Bevölkerung für eine bessere Zukunft einsetzen könnte. Durch eine erfolgreiche und von der afghanischen Bevölkerung anerkannte humanitäre Hilfe, Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit kann ein Beitrag geleistet werden, der insgesamt das Ansehen des Westens in ein vielschichtigeres und positiveres Licht hebt. 2009 wird für Afghanistan ein Schicksalsjahr. Es ist das Jahr, in dem der neue amerikanische Präsident Barack Obama neue Weichen für Afghanistan stellen will und in dem die afghanische Bevölkerung einen neuen Präsidenten wählt. Es ist ein Jahr, in dem die internationale Staatengemeinschaft endlich eine positive »Afghanisierung« zulassen sollte und in dem sie den schon lange verkündeten Strategiewechsel in konkrete Aktivitäten in den Bereichen Koordination, Ownership, Transparenz, Wiederaufbau und Sicherheit münden lassen sollte. Afghanistan braucht nicht mehr internationale Soldaten, sondern Geld und Investitionen, Geduld und Vertrauen, Koordination und Weitsicht – kurzum einen abgestimmten politischen Willen aller wichtiger Akteure.
Um diesen Willen zu rufen und einzufordern, müssen Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisationen künftig noch viel deutlicher machen, dass sie ausschließlich auf der Seite der bedrohten und verletzten afghanischen Zivilbevölkerung stehen, dass sie nicht Teil einer wie auch immer zu verstehenden okzidentalen Bedrohung sind (Buruma/ Margalit 2005). Um ihre Unabhängigkeit zu wahren und Vertrauen zu gewinnen, müssen sie sich gegen jedwede Instrumentalisierung wehren. Sie dürfen sich weder in einer zynischen Dialektik verlieren noch dort hineindrängen lassen. Es ist Zähigkeit und Phantasie gefragt, um den vielfältigen Bedrohungen zu widerstehen, um mit den Menschen in Afghanistan neue Wege der Hoffnung zu beschreiten. Peter Rühmkorf hat für das Widerstehen unvergessene Worte gefunden:
„Widersteht! im Siegen Ungeübte, zwischen Scylla hier und dort Charybde schwankt der Wechselkurs der Odyssee … Finsternis kommt reichlich nachgeflossen; aber du mit – such sie dir! – Genossen! teilst das Dunkel, und es teilt sich die Gefahr, leicht und jäh – Bleib erschütterbar! Bleib erschütterbar – und widersteh.“
Literatur
Buruma, Ian/Margalit, Avishai (2005): Okzidentalismus: Der Westen in den Augen seiner Feinde.
Caritas international 2008: Caritas fordert Strategiewechsel für Afghanistan.
Hoffmann, Claudia (2008): Das Problem der Sicherheit für NGOs in Afghanistan, in: Schmidt, Peter (Hg.): Das internationale Engagement in Afghanistan, SWP Studie, S.49-55.
Mann, Sloan (2008): The Integration of Special Operation Forces and USAID in Afghanistan, in: Small Wars Journal, August 2008.
Suhrke, Astrid (2008): A Contradictory Mission? NATO from Stabilization to Combat, in: International Peacekeeping, 15 (2): 214-236.
VENRO (2008): Perspektiven für Frieden, Wiederaufbau und Entwicklung in Afghanistan. Deutsche Hilfsorganisationen ziehen nach einem Jahr Bilanz. VENRO-Positionspapier.
VENRO (2009): Fünf Jahre deutsche PRTs in Afghanistan: Eine Zwischenbilanz aus Sicht der deutschen Hilfsorganisationen.
Waldman, Matt (2008): Falling short: aid effectiveness in Afghanistan, in: ACBAR advocacy series.
Dr. Thorsten Hinz, Ethnologe und Philosoph, ist Afghanistan-Experte bei Caritas international, dem Hilfswerk der Deutschen Caritas, mit Sitz in Freiburg im Breisgau.