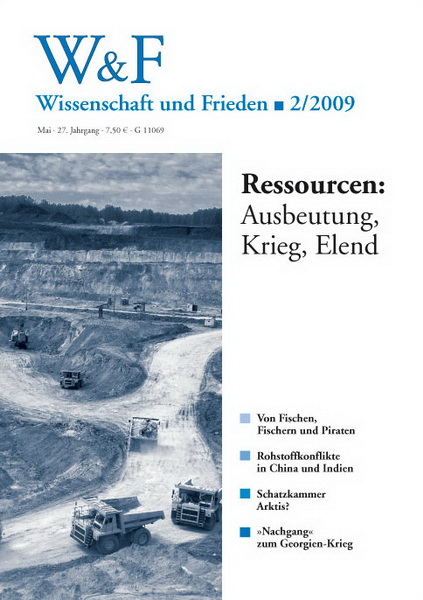Biopiraten im Kreuzfeuer
Die Nutzung genetischer Ressourcen als globales Konfliktfeld
von Michael Frein
Biopiraterie – diesen Vorwurf können sich Unternehmen einhandeln, die genetische Ressourcen nutzen, ohne die Regeln der UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) zu beachten. Dabei geht es um Umweltschutz, aber eben auch um Interessen der Industrie, der Industrie- und Entwicklungsländer, der Forschung und der indigenen Völker. Wie so oft: Den Schlüssel zur Konfliktlösung halten die Industrieländer in den Händen.
Bereits in den frühen Tagen der Debatte traten die Konflikte zwischen Nord und Süd, zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, deutlich zu Tage. Im Anschluss an den 1987 von der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung präsentierten Bericht »Our Common Future« (Hauff 1987) machten sich die Staaten daran, die neueren Erkenntnisse der Debatte um eine nachhaltige Entwicklung in völkerrechtlich verbindliches Recht zu gießen. Dabei hatten die Industrieländer Umweltabkommen im Sinn, die Entwicklungsländer Unterentwicklung und globale soziale Gerechtigkeit. Schlussendlich reflektieren die Ergebnisse der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, beide Anliegen. Die Erklärung von Rio und die Agenda 21 betonen, dass Umwelt und Entwicklung zwei Seiten einer Medaille darstellen.
Dieses Verständnis liegt auch der Konvention über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity – CBD) zugrunde, die neben der Klimarahmenkonvention das einzige völkerrechtlich verbindliche Ergebnis der Rio-Konferenz darstellt. Der Verhandlungsbeginn spiegelt noch das Interesse der Industrieländer am Schutz des tropischen Regenwaldes wider. Die Entwicklungsländer, so die Vorstellung im Norden, sollten verbindliche Verpflichtungen zum Schutz ihrer Primärwälder eingehen. Dieser Ansatz wurde im Verlauf der Verhandlungen gleich mehrfach erweitert: Zunächst wurde der Geltungsbereich des neuen Abkommens auf die gesamte biologische Vielfalt ausgeweitet, sodann sollte es nicht nur um Schutz und Erhaltung gehen, sondern auch um die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt (vgl. Friedland, Prall 2004; Plieninger, Bens 2008) und schließlich um die gerechte Aufteilung der Vorteile, die aus der Nutzung entstehen.
Insbesondere die letztgenannte Erweiterung ist Ergebnis des Drängens der Entwicklungsländer, die der Ausbeutung ihrer genetischen Ressourcen durch die Unternehmen des Nordens Einhalt gebieten wollten. Der Hintergrund ist, dass die biologische Vielfalt der Länder des Südens die Grundlage für viele Medikamente, aber auch andere Produkte wie Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel, enthält, die in Unternehmen des Nordens produziert und vermarktet werden (Holm-Müller/Täuber 2008).
Worum es geht
Dabei hatten die Entwicklungsländer Fälle von Biopiraterie wie den Neembaum im Auge. Auf dem indischen Subkontinent beheimatet, wird er dort seit Jahrhunderten genutzt – das Holz ist resistent gegen Termitenfraß, die Zweige dienen als Zahnbürste mit integriertem Schutz vor Bakterien, die Blätter ergeben Tierfutter mit Wirkung gegen Würmer, aus den Samen werden Seife, Lampenöl und Mittel gegen Insekten- und Pilzbefall gewonnen. Für die letztgenannte Wirkung gab das Europäische Patentamt 1994 einem Antrag des Agro-Unternehmens W.R. Grace und des US-Landwirtschaftsministeriums statt. Mehr als 200 Organisationen aus 35 Ländern konnten mit Hilfe alter Schriften nachweisen, dass es sich dabei nicht um eine neue Erfindung handelte, sondern um ein längst bekanntes Produkt aus der traditionellen indischen Landwirtschaft. Im Jahr 2000 widerrief das EPA seine Patenterteilung; aufgrund des Widerspruchs der Schutzrechteinhaber konnte das Patent jedoch erst im März 2005 endgültig für nichtig erklärt werden. Im Laufe des über zehn Jahre währenden Streites blieben die Rechte des Patentinhabers unberührt. Zudem wurde der Widerruf des Patentes nicht mit einer Verletzung der Regeln der Konvention über die biologische Vielfalt begründet, sondern erfolgte auf Basis des Patentrechts (Frein/Meyer 2008).
Von einem anderen Beispiel, bei dem ebenfalls traditionelles Wissen eine bedeutende Rolle spielt, berichtet die südafrikanische NGO »African Center for Biosafety«. Die Geschichte beginnt im Jahre 1897, als die ärztliche Diagnose für Charles Henry Stevens auf Tuberkulose lautete, zu jener Zeit auch in seiner Heimat Birmingham eine lebensbedrohende Angelegenheit. Sein Arzt riet ihm, des besseren Klimas wegen zu einer Reise nach Südafrika. Dort traf Stevens auf den traditionellen Heiler Mike Kijitse, der ihm aus den gestoßenen Wurzeln einer kleinen Blume einen Trank zubereitete. Das Ergebnis war verblüffend: Nach etwa drei Monaten fühlte sich der Patient wieder vollständig gesund. Stevens erprobte den Zaubertrank noch in Südafrika erfolgreich an weiteren Tuberkulose-Patienten. Zurück in England erklärte sein Arzt ihn für geheilt. Über die Geschichte mit dem Sud aus den Wurzeln der Kapland-Pelargonie, einer ausschließlich in Südafrika und Lesotho vorkommenden Geranienart, schüttelte der Mediziner jedoch den Kopf.
Dennoch: In den 1930er Jahren erreichte der Ruf von den erstaunlichen Fähigkeiten der Kapland-Pelargonie die Berliner Charité. Auch hier verliefen die Tests so erfolgreich, dass ein Unternehmen aus Regensburg, 1923 von dem Apotheker Johannes Sonntag als JSO-Werk gegründet, einen Pelargonienextrakt als Medikament auf den Markt brachte. Heute heißt das Unternehmen ISO-Arzneimittel und gehört zur Dr.Willmar-Schwabe-Unternehmensgruppe aus Ettlingen bei Karlsruhe, das Medikament auf der Basis der Kapland-Pelargonie wird unter dem Markennamen UMCKALOABO vertrieben, mit einem jährlichen Umsatz von ca. 50 Millionen Euro (Koyama/Mayet 2006, African Center for Biosafety 2008).
Die stoffliche Basis für UMCKALOABO bildet die Kapland-Pelargonie. Genau so unverzichtbar ist allerdings das traditionelle Wissen über ihre Nutzung, das über Mike Kijiste, Charles Henry Stevens und die Berliner Charité nach Deutschland gekommen ist. Dazu heißt es auf der Internetseite www.umckaloabo.de, mit der für UMCKALOABO geworben wird: „Wirksame Hilfe kommt erstaunlicherweise nicht aus den Forschungslabors der Chemieriesen, sondern aus der Savanne Südafrikas. Aus dem Wurzelsud der Kapland-Pelargonie, der aus der Volksmedizin der Zulus schon vor über hundert Jahren seinen Weg in die europäische Medizin fand, entwickelten deutsche Pflanzenforscher das Medikament UMCKALOABO.“
Nun mag strittig sein, wie weit man in der Geschichte zurück gehen soll, um von Biopiraterie sprechen zu können. Im Falle der Kapland-Pelargonie geht es allerdings auch um aktuelle Patentanmeldungen (Koyama/Mayet 2006) und weitere Umstände, die den Vorwurf der Biopiraterie begründen können. Wie dem auch sein mag: Solche und ähnliche Biopiraterie-Fälle (vgl. Frein/Meyer 2008) hatten die Entwicklungsländer im Sinn, als sie bei den Verhandlungen zur Konvention über die biologische Vielfalt nach einer gerechten Aufteilung der Vorteile aus deren Nutzung verlangten. Die Industrieländer waren von diesem Ansinnen wenig begeistert, sahen jedoch letztlich keine andere Möglichkeit als zuzustimmen, wenn sie ihr ursprüngliches Ziel, den Schutz und die Erhaltung, durchsetzen wollten. Das ist der übergreifende politische Deal, der zur Konvention über die biologische Vielfalt führte, die im Dezember 1993 in Kraft trat.
Was ist eine genetische Ressource?
Damit hat die CBD drei – gleichberechtigte – Ziele: Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, ihre nachhaltige Nutzung und die gerechte Aufteilung der Gewinne, die aus der Nutzung entstehen. Mit Blick auf das letztgenannte Ziel regelt die Konvention die Nutzung genetischer Ressourcen. Aber was ist eine genetische Ressource? Der Konvention zufolge handelt es sich dabei um genetisches Material von tatsächlichem oder potentiellem Wert, wobei genetisches Material wiederum jedes Material pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs ist, das »funktionale Erbeinheiten«, also Gene, enthält.
Was nicht einfach klingt, ist tatsächlich auch Gegenstand einer erbitterten Debatte. Während Industrie und Industrieländer die These vertreten, dass damit nichts anderes als Gene gemeint sein können, beharren Entwicklungsländer und Nichtregierungsorganisationen darauf, dass diese Definition die biochemischen Extrakte und Wirkstoffe einer Pflanze einschließt. Diese Debatte ist keinesfalls akademisch, dahinter stecken handfeste politische Interessen. Denn tatsächlich spielen pflanzliche Gene für die Herstellung von Kosmetika oder Medikamenten kaum eine Rolle, im Unterschied zu biochemischen Substanzen. Bezöge sich ein internationales Abkommen aber ausschließlich auf Gene, so bliebe deren Nutzung davon unberührt (Meyer 2009).
Gemeinsames Erbe der Menschheit versus staatliche Souveränität
Denn nur mit Blick auf die Gene wären die Nutzer an die CBD-Regeln gehalten. Dort wurde erst einmal festgelegt, dass die biologischen Vielfalt nicht länger ein gemeinsames Erbe der Menschheit darstelle, sondern der Souveränität eines jeden Staates unterstehe, auf deren Gebiet sie vorkomme. Vorbei sind damit die Zeiten, in denen es völkerrechtlich unbedenklich war, in der Fremde Pflanzen zu sammeln, um sie im heimischen Labor mit welchem Interesse auch immer zu untersuchen. Der Zugang ist nun erst einmal versperrt, die CBD knüpft ihn an die vorherige informierte Zustimmung des Bereitstellers. Mit anderen Worten: Ein Unternehmen oder ein Forschungsinstitut muss bei einem ausländischen Staat um Erlaubnis fragen, ob es eine Pflanze nutzen darf. Bei dieser Anfrage muss es auch über Zweck und Art der beabsichtigten Nutzung informieren. Im gleichen Zuge ist dann über einen gerechten Vorteilsausgleich zu verhandeln, der in einer finanziellen Beteiligung, aber auch in Form von Technologietransfer oder in anderer Weise erfolgen kann. Wenn dies alles unterbleibt, sprechen zunehmend nicht länger nur NGOs und indigene Völker von Biopiraterie.
Bei den Bereitstellern einer genetischen Ressource handelt es sich, bei einer UN-Konvention kaum überraschend, um Staaten. Jedoch ist die Nutzung einer Pflanze meist eng mit traditionellem Wissen gekoppelt. Ohne Mike Kijitse gäbe es wohl kein Umckaloabo. Die Träger dieses traditionellen Wissens, meist Angehörige indigener Völker, erkennen den Staat nicht als legitimen Akteur an, wenn es um die Entscheidung über die Nutzung ihrer genetischen Ressourcen geht. Sie kritisieren die CBD, weil sie sie bei der Entscheidung über den Zugang außen vor lässt und in der Frage der Vorteilsaufteilung lediglich vage von der Förderung traditionellen Wissens und Folklore im Rahmen der nationalen Gesetzgebung die Rede ist (Harry, Kanehe 2004). Vertreter indigener Völker verweisen stattdessen auf ihre Rechte an ihrem Land, und, davon abgeleitet, an ihren genetischen Ressourcen (Victoria Tauli Corpuz 2004). Rückenstärkung erhalten sie dabei auch von internationalen Vereinbarungen, so etwa dem ILO-Abkommen über „eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern“ von 1989 und jüngst der UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker aus dem Jahre 2007.
Der gordische Knoten: Industrie, Industrieländer, Forscher, Entwicklungsländer, indigene Völker, NGOs
Die Lage ist mithin von einem Gewirr unterschiedlicher Interessen gekennzeichnet. Die Regierungen der Industrieländer versuchen, die Belastungen für ihre Industrien möglichst gering zu halten. Die USA sind gar nicht erst Mitglied der Konvention geworden. Andere trachten danach, entweder den freien Zugang zu den genetischen Ressourcen der Entwicklungsländer zu erhalten (Japan, Kanada) oder die Kosten möglichst gering zu halten (EU). Dies soll erreicht werden etwa durch den Verweis auf existierende freiwillige Lösungen oder die Verweigerung, die Instrumente des dritten Konventionsziels verbindlich in nationales Recht umzusetzen. Entsprechend verzögern die Industrieländer seit 2004 laufende Verhandlungen für ein neues internationales Regime zu Zugang und gerechtem Vorteilsausgleich, die aus Sicht der Entwicklungsländer genau dies bewirken sollen, und versuchen, wie etwa die EU, eine Art Recht auf Zugang festzuschreiben. Und schließlich gehört in diese Reihe, zentrale Begriffe wie den der genetischen Ressourcen so zu definieren, dass er den eigenen Interessen dient, im vorliegenden Falle die ökonomisch interessanten Fälle aus dem Geltungsbereich des Regimes ausgrenzt. Die Industrie unterstützt und forciert diese Position, weite Teile des wissenschaftlichen Betriebs im Grunde ebenfalls, wenn das Prinzip der vorherigen informierten Zustimmung als Angriff auf die Freiheit der Forschung interpretiert wird. Ob dies aus taktischen Gründen geschieht oder eher naiv die dahinter liegenden ökonomischen und politischen Interessen einfach ausgeblendet werden, bleibt vielfach unklar.
Die Regierungen der Entwicklungsländer streben ein internationales Regime an, das sie in ihren Interessen unterstützt. Dabei führen sie in der Verhandlungsarena gegenüber den Industrieländern die Rechte ihrer indigenen Bevölkerung ins Feld. Gleichzeitig können sie sich jedoch nicht von dem Verdacht befreien, diesen Anspruch nach innen nicht einzulösen. Gegenüber den Industrieländern machen sie – nicht unbedingt immer offen, aber immer offensichtlicher – Fortschritte bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt abhängig von Fortschritten bei der Frage der gerechten Vorteilsaufteilung.
Indigene Völker wiederum sehen sich gleich mehreren Fronten gegenüber: Der Industrie, die ihre genetischen Ressourcen und ihr traditionelles Wissen ohne ihre Zustimmung ausbeutet, werfen sie Biopiraterie vor, ebenso den Regierungen der Industrieländer, die diese Praxis rechtlich absichern. Gegenüber ihren eigenen Regierungen lautet der Vorwurf auf Nichtanerkennung ihrer Rechte, vor allem des Rechts auf ihr Land. Nichtregierungsorganisationen verlangen wie indigene Völker ein Verbot von Patenten auf Leben, sie warnen vor einer Kommodifizierung der Natur (BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie 2005) beziehungsweise fordern, die Rechte indigener Völker anzuerkennen und sie im Verfahren zur vorherigen informierten Zustimmung als entscheidende Instanz zu etablieren (Frein 2008).
Die Lösung: Der Reisepass für genetische Ressourcen?
In diesem Rahmen fokussieren die Diskussionen auf einen Herkunftsnachweis beziehungsweise ein Zertifikat, das genetische Ressourcen auf ihren Reisen um den Globus wie einen Pass begleiten soll. Der Experten-Vorschlag sieht für jede genetische Ressource ein Zertifikat vor, das deren Herkunft offen legt sowie das Vorliegen einer vorherigen informierten Zustimmung und einer Vereinbarung zum gerechten Vorteilsausgleich bescheinigt. Darüber hinaus wird unter anderem vorgeschlagen, dass das Zertifikat Einschränkungen für den Nutzer sowie Bedingungen der Weitergabe an Dritte festhält. Mit Blick auf traditionelles Wissen wird die gesonderte vorherige informierte Zustimmung der Träger dieses Wissens vorgeschlagen.
Die Kollisionen mit dem Patentrecht sind offensichtlich. Denn eine Bedingung zur vorherigen informierten Zustimmung könnte darin liegen, dass der Nutzer auf Patentierung verzichtet. In Anbetracht der tiefen Abneigung indigener Völker in Bezug auf Patente auf Leben ist dieses Szenario nicht unwahrscheinlich. In der Folge müsste das Patentrecht auf globaler wie auf nationaler Ebene angepasst werden. Die Staaten könnten durch das Patentrecht nicht länger verpflichtet werden, grundsätzlich Patente auf Leben zu erteilen und zu schützen, da ihnen das Zertifikat für die Nutzung genetischer Ressourcen dies im Einzelfall verbieten würde. Was für die Frage der Patentierung gilt, trifft im Grund auch auf andere Nutzungsformen zu. Ohne eine im Zertifikat festgehaltene Zustimmung dürften weder Forschung noch Kommerzialisierung erlaubt werden. Verantwortlich für die Befolgung dieser Vorgaben wären die Industriestaaten, die entsprechende Vergehen aktiv verfolgen und sanktionieren müssten.
In der Debatte wird zunehmend deutlich, dass es aus der Sicht indigener Völker, aber zunehmend auch von Regierungen des Südens, nicht in erster Linie darum geht, dass möglichst viel Geld von Nord nach Süd fließt. Es geht um die Frage der Souveränität. Insbesondere für indigene Völker hat die Anerkennung ihrer Rechte Priorität. Auf dieser Basis könnte dann über Zugang und gerechten Vorteilsausgleich diskutiert werden.
Mit einem Abkommen, das sich auf den Naturschutz beschränkt, hat die Konvention damit wenig gemein. Was in den Rio-Verhandlungen als komplexer Prozess einer nachhaltigen Entwicklung versprach, ökologische und soziale Fragen miteinander zu verbinden, harrt fast 20 Jahre später immer noch der Umsetzung. Und, wie so oft, scheint der Schlüssel darin zu liegen, dass die Industrieländer in zwei Bereichen Abstriche machen müssen: Bei ihren ökonomischen Vorteilen, mehr aber noch bei ihrer Entscheidungsmacht. Dass dies schwer fällt, ist hinlänglich bekannt. Dass dies zunehmend unausweichlich ist, allerdings auch.
Literatur
African Center for Biosafety (2008): Knowledge not for sale. Umckaloabo and the Pelargonium Patent Challenges. Johannesburg: African Center for Biosafety.
BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie (2005): Grüne Beute. Biopiraterie und Widerstand. Frankfurt: Trotzdem Verlag.
Frein, Michael (2008): Shampoo auf Bäumen. Über biologische Vielfalt und globale Gerechtigkeit. Bonn: Evangelischer Entwicklungsdienst (EED).
Frein, Michael/Meyer, Hartmut (2008): Die Biopiraten. Milliardengeschäfte der Pharma-Industrie mit dem Bauplan der Natur. Berlin: Econ.
Friedland, Julia/Prall, Ursula (2004): Schutz der Biodiversität: Erhaltung nachhaltige Nutzung in der Konvention über die biologische Vielfalt, Zeitschrift für Umweltrecht 16 (4), 193-202.
Harry, Debra/Kanehe, Le’a Malia (2005): The BS in Access and Benefit Sharing (ABS): Critical Questions for Indigenous Peoples, in: Beth Burrows (Hrsg.): The Catch: Perspectives in Benefit Sharing. Washington, S.81-120.
Hauff, Volker (Hrsg.) (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Greven: Eggelkamp.
Holm-Müller, Karin/Täuber, Sabine (2008): Zugang und Vorteilsausgleich in der CBD, Aus Politik und Zeitgeschichte 58 (3), 24-30.
Koyama, Misaki M./Mayet, Mariam (2006): Bioprospecting, Biopiracy and Indigenous Knowledge. Two case studies from the Eastern Cape, South Africa. Johannesburg: African Center for Biosafety.
Meyer, Hartmut (2009): Was ist eine genetische Ressource? http://www.eed.de/biodiv [Download 9. März 2009].
Plieninger, Tobias/Bens, Oliver: Biologische Vielfalt und globale Schutzgebietsnetze, Aus Politik und Zeitgeschichte 58 (3), 16-23.
Tauli Corpuz, Victoria (2004): Das Recht indigener Völker auf ihr kulturelles Erbe. Biologische Vielfalt, traditionelles Wissen und das Konzept des geistigen Eigentums. Bonn: Forum Umwelt und Entwicklung.
Michael Frein ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Referent für Welthandel und internationale Umweltpolitik beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) in Bonn. Er ist außerdem Sprecher des Forums Umwelt und Entwicklung (www.forumue.de) und hat an den wichtigsten Verhandlungen der CBD in den letzten Jahren teilgenommen.