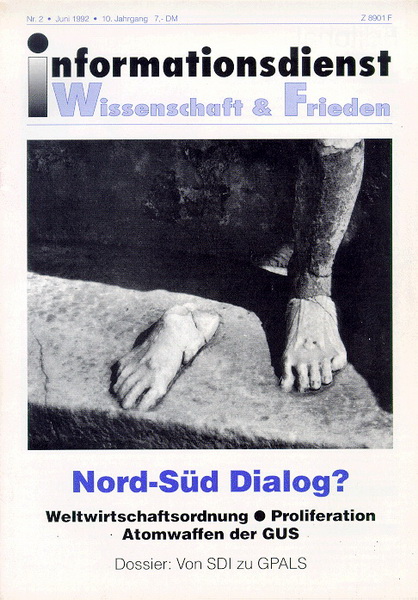»Dauerhafte Entwicklung« und Kommunalpolitik
von Dieter Kramer
Der im Frühjahr 1991 zurückgetretene Frankfurter Oberbürgermeister Volker Hauff formulierte als knappe Zusammenfassung der Ziele seiner Politik: „… die Wirtschaftskraft Frankfurts stärken, zugleich darauf achten, daß der enorme Reichtum, der in dieser Stadt steckt, wirklich dazu genutzt wird, ein Stück soziale Gerechtigkeit und Reichtum für alle zu schaffen und in einer modernen, von wirtschaftlicher Dynamik geprägten Metropole aufzuzeigen, daß Stadt und Natur keine Gegensätze sind. Wir müssen gerade in einem solchen Raum vorbildliche ökologische Lösungen anstreben.“ Man könnte die Offenheit kritisieren, mit der hier unterschiedliche Ziele addiert werden, ohne ihre spannungsreichen Widersprüche zu thematisieren – aber einiges wird wenigstens genannt. Es lohnt sich durchaus, auch für die Einordnung der Kulturpolitik solche Kurzformeln der »Unternehmensphilosophie« einer Kommune ernst zu nehmen.
Zum Vergleich eine andere: „Frankfurt als die blühende Stadt der Liberalität und Experimentierfreude, des intellektuellen Disputes und der europäischen Aura, des produktiven Spannungsverhältnisses von Geld und avantgardistischer Kultur“. Redundante Leerformeln ohne ernsthafte Konsequenzen oder Verpflichtungen, könnte man dazu sagen; gravierender aber noch ist die Abwesenheit von wichtigen Themen wie Ökologie oder Soziales.
Einst waren Wiederaufbau und Fortschritt die »Vision«, die bündelnden Formeln für gemeinsame kommunale Aktivität. Immerhin könnte man sich heute auch noch andere Akzente, andere Ideen für die zukunftsfähige Metropole vorstellen, etwa nach dem Motto: Wenn Wohlstand und Prosperität in diesem Teil Europas einen überzeugenden Sinn haben sollen, dann den, Akzente zu setzen und Wege zu bahnen für eine Zukunft der Überlebensfähigkeit, für den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft und ihrer Lebensweisen als Voraussetzung des Wohlbefindens und des »anständigen Lebens« hier und anderswo. Wer, wenn nicht wir in einem der reichsten Länder der Erde, können dafür Ressourcen freisetzen? Wer kann ohne Verlust an Lebensqualität, ja mit einem Gewinn an solcher, eine ökologische Wende leben? Und wenn wir das tun, dann wird die übrige Welt mit Interesse darauf schauen – und uns vielleicht auch unseren Wohlstand weniger neiden.
Wachstumszwang?
Schöne Leitbilder genügen nicht. Es muß ansatzweise – gedanklich und praktisch – sichtbar werden, wie es denn weitergehen könnte. Man kann nicht die Daten der „Zivilisationskrise“ (Elmar Altvater), der „Begrenzungskrise“ (Kurt H. Biedenkopf), des Brundtland-Berichtes der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung kennen und eine Politik des „Weiter wie bisher“ verfolgen. Es macht keinen Sinn, das Wachstum der »dynamischen Metropole« zu beschwören und dabei zu verdrängen, daß Wachstum nur auf der Basis fortgesetzter weltweiter Ausbeutung, mit Risikotechnologien wie Atomkraft, um den Preis extremer Verletzbarkeit und mit zunehmendem Druck durch die wachsende Bevölkerung der armen Regionen der Erde denkbar ist.
Man kann aber nicht der Lebensstilgesellschaft, den Angehörigen der prosperierenden Schichten der Wohlstandsgesellschaft (und noch viel weniger den »Modernisierungsverlierern«) mit dem missionarischen Pathos der Askese und des Verzichts kommen. Was tun?
Politik muß glaubhafte Perspektiven für Zukunftsprobleme entwickeln. Geht es z.B. um Wachstumskontrolle oder Wachstumsbegrenzung? Durch Nichtausweisung von Gewerbeflächen usw. ließe sich theoretisch Wachstumsbegrenzung betreiben. Aber mit dem Argument des Gemeinnutzes, d.h. dem Programm der gleichmäßigen arbeitsplatz- und durchmischungsfördernden Planung, wird der Forderung nach einer wachstumshemmenden künstlichen Verknappung begegnet: Sie würde, sagt man, bedeuten, daß kapitalschwächere von kapitalstärkeren Nutzungen verdrängt würden (der Tokio- oder Singapur-Effekt). Es gäbe einen Verdrängungsprozess, der weil von externen Strukturen oder Faktoren abhängig, nicht mehr kontrollierbar wäre und der für den Arbeitsmarkt eher negativ wäre, und es würde der Druck auf die unkontrollierte Wohnraum-Umwandlung zunehmen, wird argumentiert.
Aber dieser Druck existiert ja ohnehin schon, und die Verdrängung findet seit Jahren statt. Zu sagen: Es gibt eine durch äußere Faktoren bestimmte Wachstumsdynamik, die politisch nicht zu bremsen ist, das bedeutet eine Kapitulationserklärung vor dem Selbstmordprogramm der Wachstumsgesellschaft.
Die Vorstellung von einem Gleichgewicht zwischen äußerer, fremdbestimmter Dynamik (des Wachstumszwangs), und innerer kommunaler Entwicklung hat hier ihre Grenzen: Wenn die innere (kommunalpolitische) Entwicklung nicht in der Lage ist, Einfluß auf die äußere zu nehmen oder sich ihr zu widersetzen, dann gibt es keine Freiräume. Daß sie sich diesen Zwängen nie wird total widersetzen können, darf kein Argument dafür sein, sich ihnen total auszuliefern. Und wenistens zu prüfen wäre, ob die spezifischen Werte einer Stadt wie z.B. Frankfurt, wie sie in der von den geographischen Lage in dem Eigensinn einer einzigartigen Struktur von Institutionen und Menschen liegen, nicht einen souveränen Umgang mit den fremdbestimmenden äußeren Faktoren ermöglichen statt einer prostitutiven Unterwerfung. Im Grunde kann jede Kommune ähnlich überlegen.
Akzente setzen
Eine Gesellschaft und eine Kommune sind nur dann zukunfts- und friedensfähig, wenn sie den Prinzipien von »Umweltverträglichkeit«, »dauerhafter Entwicklung« und Nachhaltigkeit gerecht werden. Die langfristigen Auswirkungen kommunaler Politik und urbaner Lebensform auf Ökologie und Umwelt müssen berücksichtigt werden, und zwar sowohl bezogen auf die direkte kommunale Lebenswelt, als auch bezogen auf die Fernwirkungen, die von der eigenen Lebensweise ausgehen. Der Kommune als umweltpolitischer Akteur bleiben nur wenige Möglichkeiten – keine Ausrede, sie nicht zu nutzen.
Ein Versuch, hohe Ziele zu stecken, ist das »Klimabündnis« der Städte mit den Indianern des Regenwaldes, bei dem Frankfurt Initiativen ergriffen hat. Die indirekten Wirkungen sind vielleicht noch wichtiger als die direkten (zu denen z.B. Tropenholzboykott gehört): Die Städte werden motiviert, über langfristige Strategien nachzudenken, tauschen Erfahrungen und Ideen aus, treten in einen Wettbewerb der Taten und Pläne ein. Beim sozialökologischen Umbau der Industriegesellschaften erwarten die Menschen von den Städten deutliche neue Akzente bei Verkehr, Energie, Wasser, Entsorgung.
Die ökologische Kommune steht für Zukunftsfähigkeit. Eine gelungen in die Problem-Realität dieser Erde eingeordnete Stadt, die perspektivisch umgeht mit Wohn-Not und Verkehrs-Widersprüchen, die exzessiven konsumaufwendigen Lebensstilen den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zwanglos vermittelt, und die gleichzeitig Menschen mit hohen, neuartigen Ansprüchen an Lebensqualität und Sinnorientierung Raum der Entfaltung und »tätigen Aneignung« wird – eine solche Stadt wäre ein überzeugender Beleg für die Gestaltbarkeit einer lebenswerten Zukunft. Es geht um überzeugende oder mindestens glaubhafte Vorstellungen und Praxisformen einer möglichen Zukunft für eine Gesellschaft, die an den Grenzen der Belastbarkeit ihres Lebensraumes angelangt ist und aus den Sackgassen des exponentiellen Wachstums nicht mehr herauszukommen scheint.
Soziale Qualitäten
Zu den heute gefragten Standortqualitäten der »postmaterialistischen«, zukunfts- und friedensfähigen Stadt gehört, daß hier Lebenspraxen und Lebensentwürfe lebbar und sichtbar werden, die glaubhaft zukunftsfähig sind. Dazu gehören z.B. auch Formen des Umganges mit Zeit, des Zeitregimes und der Mußefähigkeit – auch in der eigenen Lebenspraxis ihrer Repräsentanten, ebenso aber auch in den Formen des Umganges mit Arbeitskraft und Arbeitsmotivation der für die Kommune arbeitenden Menschen: Arbeitsleben und Freizeit müssen auch bei ihnen zu überzeugenden Formen von Lebensqualität zusammenfinden können. Insofern sind auch Sozial- und Tarifpolitik gefragt.
Definitionsmächte
»Kulturelle Öffentlichkeiten« der verschiedensten Art sind das Medium, in dem die Menschen sich über die Normen und Werte ihres Handelns verständigen. Menschen vergesellschaften sich auch kulturell, und wenn es in der heutigen »Begrenzungskrise« darauf ankommt, neue Standards für eine »dauerhafte Entwicklung« zu finden, dann geht dies nicht ohne kulturelle Öffentlichkeiten. Daß diese Standards auch hinreichend Raum für Neugierverhalten und expressive Verausgabungen enthalten müssen, das versteht sich – ohne solche Potentiale wäre Entwicklung nicht mehr möglich und wären heftige Konflikte zwischen den Generationen und Kulturen vorprogrammiert.
Die Städte sind heute bezüglich der globalen Umweltprobleme zentraler Ort gesellschaftlicher Selbstverständigung über deren Bewältigung. In ihnen befindet sich das bedeutendste Potential an »intellektueller Produktivität« daher sind sie in der Lage, Verständigungsprozesse über Umweltprobleme zu initiieren und zu unterstützen. Bei dieser Bereitstellung von Diskussionsfreiräumen sind die Städte besonders gefordert.
Die Zukunftsansprüche der modernen Mittelschichten, auf die Politik sich gerne beruft sind weit komplexer einzuschätzen als üblich. Sie reduzieren sich nicht auf den dekorativen Rahmen für die Inszenierung von Lebensstilen, sie sind auch nicht einfach als abfragbare Bedürfnisse vorhanden. Es ist denkbar, diese Schichten perspektivisch auch für mehr und anderes als »lifestyle« zu gewinnen. Der perspektivische Diskurs über die »zukunftsfähige Metropole«, die Thematisierung des Anspruchs auf „Leben in seiner Fülle“ (Dorothee Sölle), das Recht auf anständige und als sinnvoll empfundene Arbeit eingeschlossen, ist eigentlich ein Motiv, das für jemanden wie mich (schließlich zähle ich ja auch zu dieser Lebensstilgruppe) und die meisten derjenigen, die ich kenne, wichtig ist. Die Wohlstandsgesellschaft produziert auch bei ihren prosperierenden Gruppen Widersprüche und Brüche des »Wünschens und Begehrens«, die sich nicht einfach affirmativ auffangen lassen. Darauf hat Kulturpolitik Bezug zu nehmen, nicht auf »lifestyle«.
Neuartige Ansprüche an die Lebensqualität
Jener Wohlstand und Luxus, den sich die Angehörigen der prosperierenden Lebensstilgruppen in unserer Gesellschaft heute leisten können, wird nicht nur von den Apologeten der Marktgesellschaft, sondern auch von manchen ihrer Kritiker als besondere Chance der Wohlstandsgesellschaft empfunden.
Natürlich, wir wissen, daß die globalen Probleme erst aus dieser auf exzessiven Konsum angewiesenen Lebensweise resultieren, und daß die bloße Fortsetzung dieser Lebensweise die Probleme nur verschärft. Aber in einer prosperierenden Gesellschaft, deren Menschen nicht voll in Anspruch genommen sind durch die Zwänge des Alltags, sind auch Mittel vorhanden, um einen ökologischen Umbau in die Wege zu leiten. Und nur wenn die Menschen entsprechende Schritte nicht als Verzicht empfinden müssen, dann sind sie bereit, dazu beizutragen. Es gilt, diesen Wohlstand und diese Lebensweise so zu organisieren, daß sie mit dem Prinzip von »dauerhafter Entwicklung« in Einklang stehen.
Interessant ist in diesem Kontext das Umpolen von Lebenszeit und Kaufkraft auf »konsumtiven Konsum«, auf die Umsetzung von Zeit, Arbeitskraft und Geld in entsprechende Lebensqualitäten ohne zusätzliche Umweltbelastungen. Die Reichweite solcher Veränderungen ist gewiß nur begrenzt.
Aber wie wäre es, wenn sich bei uns die Standards, an denen Reichtum und Armut gemessen werden, ändern würden? Was würde geschehen, wenn „Leben in seiner Fülle“ plötzlich massiv eingefordert würde von einer jungen Generation, die erfährt, daß sie mittels materiellen Reichtums nicht nur um eine Zukunft in anständiger Umwelt, sondern auch um ein anständiges Leben selbst betrogen worden ist?
Überzeugende lebenskräftige und nachvollziehbare Formen und Praxen dieser Art scheinen mir wichtiger zu sein und eine größere Reichweite zu haben als ökologisch-pädagogische Konzepte und neue Curricula.
Politische Dimensionen des Modernisierungszwanges
In der politisch-kulturellen Diskussion hat sich ein ökonomistischer Determinismus breitgemacht. Von den Determinismen der Geopolitik, des Milieus, der Naturgebundenheit usw. ist die kulturwissenschaftliche Diskussion weitgehend abgekommen – sie favorisiert z.B. in der ethnologischen Diskussion statt des Determinismus einen »Possibilismus«: Die Menschen sind nicht den Umständen hilflos ausgelieefert. Sie können die Spielräume, die ihnen Natur und historische Voraussetzungen bieten, in unterschiedlicher Weise nutzen – das unterstellt dieser Possiblismus.
Die heutige Politik redet uns im Gegensatz dazu immer wieder den Sachzwang Weltmarkt ein, als bestände diesbezüglich nach wie vor ein Determinismus ohne Auswege. Sie konstruiert einen Modernisierungszwang, dem sich die Gesellschaft zu unterwerfen habe, und der ideologisch mit Formeln der Urbanität, der Fetischisierung von Schnelligkeit und avantgardismus abgestützt wird.
Der Politologe Frank Deppe hilft uns zu erkennen, daß es auch andere Interpretationsmöglichkeiten gibt. Er formuliert bezüglich der Aufgaben der Staaten von heute: „Unter den Bedingungen von sozialökonomischen und politischen Krisenprozessen (Massenarbeitslosigkeit, Inflation, Staatsverschuldung) müssen diese sich zwischen dem Ausbalancieren von Wohlfahrtsansprüchen (Ausbau der sozialen Leistungen, Beschäftigungspolitik) und einer weltmarktorientierten Modernisierungspolitik entscheiden. Welche Optionen letztlich auch immer gewählt werden bzw. sich durchsetzen – dies ist freilich niemals ausschließlich der bloße Nachvollzug von äußeren Determinanten, sondern stets auch Resultat von inneren sozialen, politischen und ideologischen Auseinandersetzungen, bei denen sich Blöcke von Klassenfraktionen sowie von Interessengruppen formieren, die mit den bürokratisch-politischen sowie mit den ideologischen Staatsapparaten verbunden sind.“ <|>(S. 123)
Auch damit gewinnt Kultur an Gewicht. Die Option wird auch bestimmt von den sozialkulturellen Standards einer Gesellschaft: Was den Menschen wichtig und wertvoll ist, das geht auch in die politische Prioritätensetzungen ein. Mit ihren Standards entscheidet eine Gesellschaft darüber, wofür sie ihren Reichtum verwenden will.
Die Lebensqualität in einer Gesellschaft hängt in hohem Maße von solchen Standards ab. Sie erst machen gesellschaftlichen Reichtum zum sinnvollen Bestandteil von Lebensqualität.
Attraktivität und Stärke unserer Kultur
„Ich meine, daß die Kultur im sozietären, im deutschen Sinne des Wortes der beherrschende Faktor sein wird. Kultur bedeutet die Fähigkeit, ein Gesellschaftssystem zu strukturieren und für seine Verbreitung zu sorgen. Die Macht und Kraft von Gesellschaften beruht wesentlich auf ihrem Zusammenhalt, ihrer Fähigkeit, für sich selbst stark zu sein; eine starke Kultur ist das Selbstbild einer starken Gesellschaft.“ (Pascal Lamy, TAZ World Media 24.12.1990, S. 30/31)
Wenn wir diese Aussage von Pascal Lamy gelten lassen wollen (und einiges spricht für ihren Realitätsgehalt), dann wird es wichtig, zu klären, was denn unter der Stärke einer Kultur zu verstehen ist: Die Fähigkeit, stabil und dauerhaft sich zu entwickeln und eine überzeugende sowie attraktive Lebensform zu praktizieren?
Die Prosperitätsinseln der frühen Neuzeit, die Renaissance-Städte in Italien, haben aus ihrem Reichtum heraus ein neues humanistisches Menschenbild entwickelt, das vorbildgebend für weite Teile des Abendlandes wirkte. Wäre es nicht denkbar, daß aus unseren heutigen Prosperitätsregionen heraus ein neues, ein zukunftsfähiges Menschenbild des »anständigen Lebens« mit dauerhafter Entwicklung entsteht, das kulturell vorbildgebend wirkt und so die Vorherrschaft Europas nicht wirtschaftlich und militärisch, sondern kulturell abgesichert wird?
Literatur
Elmar Altvater: Die Zukunft des Marktes, Münster 1991
Kurt H. Biedenkopf: Zeitsignale, München 1989
Frank Deppe: Jenseits der Systemkonkurrenz. Überlegungen zur neuen Weltordnung, Marburg 1991
Volker Hauff: Ein Interview mit Claus Gellersen, in: FR 6.3.1991, S. 20
Klimabündnis der Europäischen Städte mit den Indianervölkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre. Dokumentation des Ersten Arbeitstreffens, Frankfurt/M, 1991 (Umweltamt)
Unsere Gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987
Dokumentation
Rigoberta Menchú. Eine Indigena als Kandidatin für den Friedensnobelpreis 1992
Sie ist eine der tapfersten und engagiertesten Frauen der guatemaltekischen Volksbewegung. Stellvertretend für die Menschen ihres Kontinents soll sie den Friedensnobelpreis 1992 erhalten: Rigoberta Menchú aus dem Volk der Quiché. Organisationen aus ganz Lateinamerika erheben diese Forderung. Rigoberta Menchús Geschichte ist die Geschichte ihres Volkes. Von klein auf hat sie sich für die Rechte der Bauern- und indianischen Gemeinden in Guatemala eingesetzt. Am eigenen Leib mußte sie die skrupellose Verfolgung durch Militär und Staatsapparat erleiden. Ihr Vater wurde während einer friedlichen Botschaftsbesetzung zusammen mit 30 weiteren Bauern von der Armee ermordet, ihre Mutter und ihr Bruder zu Tode gefoltert. Obwohl Guatemala inzwischen offiziell eine Demokratie ist, ist Rigoberta Menchú nach wie vor gezwungen, außerhalb ihrer Heimat zu leben. Ein Votum für Rigoberta Menchú wäre ein sichtbares Zeichen für die Unterstützung des indianischen Kampfes um Anerkennung ihrer Rechte.
Dr. Dieter Kramer ist Kulturwissenschaftler und arbeitet in Frankfurt. Ausführlicher beschäftigt er sich mit dem Problem von Lebensweisen, die mit dauerhafter Entwicklung und Nachhaltigkeit in Einklang stehen in einem Buch, das unter dem Arbeitstitel „Ein anständiges Leben mit Zukunft“ voraussichtlich im Frühjahr 1992 im Böhlau-Verlag (Wien, Köln) erscheinen wird.