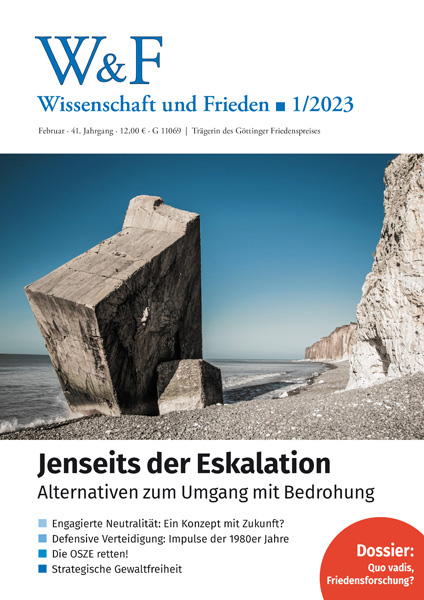Defensive Verteidigung
Orientierungshilfen aus den 1980ern
von Lukas Mengelkamp
Ideen und Konzepte über defensive Verteidigung aus den 1980er Jahren könnten heute Orientierung bieten, wie insbesondere die territoriale Integrität der ostmitteleuropäischen und baltischen Staaten zu garantieren ist, ohne dabei das bestehende Sicherheitsdilemma mit Russland noch weiter zu verschärfen, die Rolle von Nuklearwaffen aufzuwerten und das Wettrüsten auf Dauer zu stellen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über den Entstehungskontext, die Genese und Aktualität dieser militärischen Konzepte.
Als in den 1980ern der Streit um die »Nachrüstung« tobte, wurde den Gegner*innen der Stationierung von US-amerikanischen Pershing-II Mittelstreckenraketen und landgestützten Marschflugkörpern häufig vorgehalten, ihre Alternativvorschläge seien illusionär, naiv und utopisch. Unilaterale Abrüstung oder »soziale Verteidigung«, das heißt gewaltfreier Widerstand, würden die Abschreckung untergraben und Westeuropa der Sowjetunion ausliefern. Dem wurde aus den Friedensbewegungen entgegengehalten, dass die Rüstung der NATO ebenso wenig in der Lage sei, den Konflikt mit der Sowjetunion langfristig einzuhegen oder gar zu lösen. Die heutige Debatte scheint entlang ähnlicher Gegensätze zu verlaufen: Aufrüstung gegen Abrüstung. Betrachtet man die Debatten der 1980er Jahre über Alternativen zur NATO-Strategie jedoch genauer, fällt auf, dass diese weitaus differenzierter waren als in Rückblicken häufig dargestellt. So standen sich nicht schlicht »Aufrüster*innen« und »Abrüster*innen« gegenüber. Das Feld der Unterstützer*innen des NATO-Doppelbeschlusses war vielmehr aufgeteilt in jene, die darin tatsächlich eine Erweiterung der Fähigkeiten zur nuklearen Kriegsführung sahen, und jene, deren Anliegen die Sicherung der Abschreckung in Europa war. Auf Seiten der Kritiker*innen des Doppelbeschlusses befanden sich neben Befürworter*innen von allgemeiner Abrüstung auch prinzipielle Unterstützer*innen der Abschreckung, die jedoch die Nachrüstung für unnötig oder gar gefährlich hielten. Hinzu kamen Friedensforscher*innen und Militäranalyst*innen, die sich für militärisch defensive konventionelle Alternativen stark machten.1
Die NATO-Strategie der »Flexible Response«
Im Jahr 1967 löste innerhalb der NATO die Strategie der »Flexible Response« (Flexible Antwort) die noch aus den 1950er Jahren stammende »Massive Retaliation«-Doktrin (Massive Vergeltung) ab, die auch auf rein konventionelle Angriffe des Warschauer Paktes mit einem massiven nuklearen Angriff auf die Sowjetunion geantwortet hätte. Da der Warschauer Pakt in Europa zumindest zahlenmäßig auf der konventionellen Ebene überlegen war und die Sowjetunion im Laufe der 1960er Jahre die Fähigkeit erworben hatte, auch das US-amerikanische Festland mit Interkontinentalraketen anzugreifen, schien die Androhung eines allgemeinen Nuklearschlages im Falle eines Krieges in Europa nicht mehr glaubwürdig. Für die NATO ergab sich daraus ein Dilemma: Während die europäischen NATO-Mitglieder sicherstellen wollten, dass jeder Krieg auf die strategische nukleare Ebene eskalieren würde, so dass keine Partei jemals ein Interesse daran entwickeln könnte, schien es aus US-amerikanischer Sicht geboten, einen Krieg nach Möglichkeit auf Europa zu begrenzen. Dies erforderte zum einen die Stärkung des konventionellen Elements der NATO-Verteidigung und zum anderen flexiblere und auf Europa »begrenzte« nukleare Optionen, wobei hier die Bandbreite von reiner Demonstration des Willens zum Einsatz von Nuklearwaffen bis hin zur vollständigen Integration »taktischer« Nuklearwaffen in die reguläre Kriegsführung reichte. Aus europäischer Sicht war die Unterscheidung zwischen dem globalen und »begrenzten« Nuklearkrieg jedoch Makulatur, würden beide doch zur vollständigen Zerstörung Europas führen.
Die Strategie der Flexible Response war ein politisch-militärischer Kompromiss, welcher diesen amerikanisch-europäischen Gegensatz überbrücken sollte. Die Strategie war offen genug formuliert, so dass beide Seiten ihre jeweiligen Präferenzen in sie hineininterpretieren konnten. Während dieser Kompromiss auf der politischen Ebene bis in die 1980er Jahre relativ gut funktionierte, ergaben sich auf der militärischen Ebene große Probleme bei der Umsetzung, die letztlich auch wieder auf die politische Ebene durchschlagen sollten. Die konkrete Umsetzung der Flexible Response musste allein aufgrund ihres Kompromisscharakters schwerfallen, denn was auf politischer Ebene Spielraum für die unterschiedlichen Interessen beiderseits des Atlantiks erkaufte, erschwerte Planungs- und Anschaffungsprozesse auf militärischer Ebene. So konnte sich die Nukleare Planungsgruppe (NPG) der NATO erst im Oktober 1986 – nach fast 20 Jahren Beratungen – auf Richtlinien für die Planung des Nuklearwaffeneinsatzes im Rahmen der Flexible Response einigen. Bereits Anfang der 1970er Jahre hatte innerhalb der NATO eine Diskussion darüber begonnen, ob die Flexible Response eine Modernisierung der so genannten »Theater Nuclear Forces« (TNF), der nuklearen Gefechtsfeldwaffen, erforderlich machen würde. Ein Großteil der ca. 7.000 in Westeuropa stationierten taktischen Nuklearwaffen stammte noch aus den 1950er Jahren und damit aus der Ära der Massiven Vergeltung. Darunter fand sich eine Vielzahl an nuklearer Munition für Artillerie und Kurzstreckenraketen. In der Debatte über die Modernisierung der TNF bildete sich eine widersprüchliche transatlantische Koalition aus Experten*innen heraus, die für die Einführung moderner Mittelstreckenwaffen warben, insbesondere die damals noch in Entwicklung befindlichen Marschflugkörper. Während in der Argumentation von US-Experten wie Albert Wohlstetter Überlegungen über die Begrenzbarkeit und Führbarkeit eines Nuklearkrieges Pate standen, ging es aus westeuropäischer und deutscher Sicht insbesondere darum, jene Waffen zu ersetzen, die aufgrund ihrer kurzen Reichweite nur Ziele auf dem Territorium der Bundesrepublik, der DDR oder der Tschechoslowakei angreifen konnten. Zudem war damit auch die Hoffnung verbunden, dass Mittelstreckenwaffen Europa an das strategische Arsenal der USA »koppeln« würden. Mit ihrer Hilfe konnte man von Europa aus die Sowjetunion bedrohen. Damit war auch automatisch die interkontinentale Dimension der Abschreckung berührt. Mit der Aufstellung der SS-20 Mittelstreckenraketen in der Sowjetunion ab Ende der 1970er Jahre intensivierte sich die Debatte über die TNF-Modernisierung schließlich massiv und kam mit dem NATO-Doppelbeschluss 1979 auch in der breiteren Öffentlichkeit an. Die Widersprüchlichkeit der nuklearen Abschreckung im Allgemeinen und der Flexible Response im Besonderen rückte so ins Scheinwerferlicht. Die Vielzahl an unterschiedlichen politischen Deutungsangeboten zur Flexible Response geriet jetzt von einem politischen Vor- zu einem Nachteil. Zum ersten Mal verlangten Bürger*innen millionenfach Auskunft darüber, wann und wie die NATO denn gedenke, die Nuklearwaffen einzusetzen – also genau den Punkt, über den man sich bis dahin selbst innerhalb der NATO gerade nicht einig war. Angesichts der massiven Kritik an der nuklearen Komponente der geltenden Strategie wuchs allenthalben das Interesse an konventionellen Alternativen.
Die Suche nach konventionellen Alternativen
In historischen Rückblicken auf die 1980er Jahre wird das Thema konventioneller Alternativen häufig auf die »AirLand Battle«-Doktrin der US Army und das NATO-Konzept des »Deep Strike« (Tiefer Schlag) reduziert. Die AirLand Battle-Doktrin war Ausdruck der »Wiederentdeckung« der operativen Ebene in der US Army im Laufe der 1970er Jahre. Erstmals fanden hier NATO-Streitkräftestruktur und -Doktrin zueinander: Die großen und schweren Panzerverbände sollten nicht nur wie bisher im Rahmen der Vorneverteidigung eine grenznahe Linie so lang wie möglich gegen die Streitkräfte des Warschauer Paktes halten, sondern Bewegungskrieg führen. Vorgesehen waren Gegenstöße bis auf das Territorium der DDR und der Tschechoslowakei, um die zahlenmäßig überlegenen gegnerischen Streitkräfte an ihren verletzlichen Flanken und im rückwärtigen Raum bedrohen zu können. Während die erste Welle des Warschauer Paktes so besiegt werden sollte, würden tiefe präzise Schläge mit konventioneller Langstreckenmunition auf die Verkehrsadern in Ostmitteleuropa es der zweiten Welle unmöglich machen, rechtzeitig das Schlachtfeld zu erreichen. Doch die angedachte Konventionalisierung der Verteidigung, die die in der Bevölkerung unbeliebte nukleare Komponente zurückdrängen sollte, stieß auf bereits bekannte Probleme und Widerstände. Gleich stand wieder die Kritik im Raum, die Strategie würde einen Krieg in Europa nicht abschrecken, sondern vielmehr wahrscheinlicher machen, da er wieder als führbar gelten könne. Der angedachte Bewegungskrieg würde die NATO-Mitglieder dazu nötigen, ihre konventionellen Streitkräfte massiv auszubauen. Vielen Beobachter*innen erschien dies aus politischen, wirtschaftlichen und auch demographischen Gründen kaum durchführbar. Nicht zuletzt wurde dem Konzept vorgehalten, dass auch begrenzte Vorstöße auf das Territorium des Warschauer Paktes in Moskau als Beginn einer großangelegten strategischen Gegenoffensive wahrgenommen werden und damit der Einsatz von Nuklearwaffen ausgelöst werden könnte. Darüber hinaus schien es fraglich, ob konventionelle Waffen tatsächlich in der Lage sein würden, die Verkehrsadern in ganz Ostmitteleuropa lahm zu legen. So lange nicht massive Vorräte an präzisen Bomben, Raketen und Marschflugkörpern angelegt würden – mit entsprechenden Kosten – würde man zur Blockierung der zweiten Welle im Zweifel doch wieder auf nukleare Mittelstreckensysteme angewiesen sein (Unterseher 1987).
Den Konzepten von AirLand Battle und Deep Strike, die man auch als offensive Varianten der Konventionalisierung bezeichnen könnte, setzten einige Kritiker*innen defensive Alternativen entgegen. Bereits 1970 hatte Carl Friedrich von Weizsäcker die Studie »Kriegsfolgen und Kriegsverhütung« veröffentlicht, die erstmals die katastrophalen Folgen auch eines »begrenzten« Einsatzes von Nuklearwaffen in Europa wissenschaftlich aufarbeitete (Weizsäcker 1971). In Reaktion darauf begann Horst Afheldt, ein Mitarbeiter Weizsäckers am »Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt«, rein konventionelle und defensive Verteidigungsmodelle zu entwickeln (Afheldt 1976).
Diese zielten darauf ab einerseits die sowjetischen Panzerverbände aufzuhalten und gleichzeitig keine lukrativen Ziele für taktische Nuklearwaffen zu bieten. Konkret schlug Afheldt dazu den Aufbau eines Netzwerks aus »Technokommandos« vor, kleinen Infanterieeinheiten, die mit modernen Panzerabwehrwaffen ausgestattet, aus vorbereiteten versteckten Stellungen sowjetische Verbände angreifen sollten. Außerdem sollten diese Infanterieeinheiten zusätzlich durch Artillerie unterstützt werden. In den 1980er Jahren nahm die »Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik« (SAS), die maßgeblich vom Soziologen Lutz Unterseher geleitet und inhaltlich geprägt wurde, die Netzwerkidee auf. Sie reagierte aber auch auf die bestehende Kritik an Afheldts Konzept, dem man vorhielt, »monokulturell« und durch den kombinierten Einsatz von Infanterie, Panzern und Luftstreitkräften überwindbar zu sein. In Untersehers Vorstellung sollte das »Netz« aus Infanterie und Artillerie durch vergleichsweise kleine mobile gepanzerte Kräfte ergänzt werden. Sie sollten an den Orten unterstützend eingreifen, wo das Netz allein einen Angreifer nicht hätte aufhalten können. Entscheidend war jedoch, dass die mobilen Kräfte über keinen großen eigenen logistischen Apparat verfügen würden und stattdessen zur Versorgung auf das Netz angewiesen blieben. Die mobilen Kräfte sollten wie eine „Spinne in ihrem Netz“ agieren können, außerhalb davon aber nicht in der Lage sein zu manövrieren (Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik 1989, S. 153ff.). Insgesamt würde das Konzept, so die Hoffnung, ein unilaterales »Ausklinken« aus dem Wettrüsten ermöglichen, ohne dabei Abstriche an der eigenen Sicherheit machen zu müssen. Unterseher führte dazu den Begriff »Vertrauensbildende Verteidigung« ein: Einerseits Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Verteidigung ohne Nuklearwaffen, da diese zerstören würden, was man hoffte zu verteidigen. Andererseits die Herstellung von Zuversicht auf der Gegenseite, dass keine Absicht bestand, selbst offensive Operationen durchzuführen, da man dazu auch kaum in der Lage war (Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik 1989).
»Differenzierende Abschreckung« oder defensive Verteidigung?
Das Dilemma der Flexible Response, ein politischer Kompromiss zu sein, der sich militärisch nicht umsetzen ließ, führte bereits unter Zeitgenossen dazu, sie als Mythos zu bezeichnen. Da dies im allgemeinen politischen Bewusstsein in Westeuropa und insbesondere in der Bundesrepublik immer offensichtlicher wurde, begann sich Interesse an defensiven Alternativen bis in die Bundesregierung und Bundeswehr zu bilden.
Die Unterzeichnung des INF-Vertrages 1987 ließ die westeuropäischen Regierungen zum Teil ratlos und verärgert zurück: Die »Nachrüstung«, für die sie jahrelang gegen massiven Widerstand in den eigenen Bevölkerungen gekämpft hatten, wurde rückgängig gemacht, ohne dass das konventionelle Ungleichgewicht in Europa adressiert worden wäre. Gleichzeitig ließ die Debatte in den USA über die Militärstrategie der Zukunft auch in etablierten sicherheitspolitischen Kreisen immer stärkere Zweifel an der Flexible Response aufkommen. Im Januar 1988 wurde ein von der US-Regierung in Auftrag gegebener Expert*innenbericht veröffentlicht, der unter dem Titel »Discriminate Deterrence« (Differenzierende Abschreckung) für eine Konventionalisierung der NATO-Strategie eintrat (Iklé und Wohlstetter 1988). Die Nuklearwaffen in Westeuropa sollten weitestgehend abgezogen werden, die verbleibenden modernisiert und wie »normale« Waffen in die Verteidigungsplanung integriert werden. Der Bericht rief in ganz Westeuropa und über das gesamte politische Spektrum hinweg Ablehnung und sogar Empörung hervor. Argumente, die vor kurzem eher aus den Friedensbewegungen zu hören gewesen waren, wurden nun auch von Befürworter*innen der »Nachrüstung« aufgegriffen. Der Verteidigungsexperte der FAZ, Karl Feldmeyer, interpretierte den Bericht als eine Absage an die Flexible Response. An die Stelle der Abschreckungs- würde eine Kriegsführungsstrategie treten. Der erzkonservative Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, geißelte den Bericht bei einem Besuch in Washington als Versuch, einen Krieg auf Europa zu begrenzen und die USA von Westeuropa sicherheitspolitisch abzukoppeln. Gleicher Ansicht waren auch Verteidigungsminister Manfred Wörner und sein Staatssekretär Lothar Rühl, die beide öffentlich Stellung gegen den Bericht bezogen (vgl. zu den Stellungnahmen: Armes 1988, S. 252ff.). Auch wenn sich die neue US-Regierung unter George H. W. Bush angesichts der massiven Kritik aus Westeuropa von dem Bericht distanzierte, legte die Kontroverse doch offen, wie wenig die Strategie der Flexible Response noch in der Lage war, die unterschiedlichen Interessen, Verteidigungskonzeptionen und Wahrnehmungen der internationalen Lage im Bündnis zu integrieren.
Der Rezeptionsprozess der defensiven Alternativen begann sich nun auch in der Sache auf beiden Seiten des Atlantiks zu intensivieren. Die Weißbücher des Verteidigungsministeriums von 1983 und 1985 wie auch der Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten diese lediglich zur Kenntnis genommen und auch dies war wohl eher dem öffentlichen Druck als genuinem Interesse geschuldet. Am Ende des Jahrzehnts setzte sich in der Bundesrepublik mit General a.D. Gerd Schmückle aber ein Schwergewicht des sicherheitspolitischen Establishments öffentlich für defensive Alternativen ein. Zusammen mit Albrecht von Müller, einem Mitarbeiter Horst Afheldts, legte Schmückle im Mai 1988 der Bundesregierung ein Abrüstungsprogramm vor, das die defensive Restrukturierung der Streitkräfte in Ost und West forderte. Im Januar 1989 veranstaltete das der US-amerikanischen Friedensbewegung nahestehende »Institute for Defense and Disarmament Studies« (IDDS) zusammen mit der Pentagon-nahen RAND Corporation einen Workshop zur defensiven Neustrukturierung der NATO-Verteidigung in Europa, auf dem Lutz Unterseher die Ideen der »Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik« vorstellte. Mit RAND war die Debatte über defensive Alternativen nun selbst im intellektuellen Geburtsort der Nuklearstrategie angekommen. Durch den Mauerfall 1989 und den anschließenden Zerfall der Sowjetunion entfiel jedoch das nukleare Dilemma der NATO. Dadurch endete auch die breite Debatte über verteidigungspolitische Alternativen, die in den frühen 1980er Jahren maßgeblich unter dem Druck der Friedensbewegungen begonnen hatte.
Defensive Verteidigung – ein Modell mit Zukunft?
Die heutige Debatte über die zukünftige Verteidigungspolitik in der Bundesrepublik erscheint oft als prinzipieller Gegensatz zwischen jenen, die für das Sondervermögen und eine dauerhafte Erhöhung des Wehretats eintreten, und jenen, die darin lediglich eine Verschwendung von Kapital sehen, welches besser für die Bekämpfung des Klimawandels und den Erhalt des Sozialstaats eingesetzt werden sollte (siehe bspw. »Der Appell« von 2022). Relativ selten wird allerdings die Frage nach dem »wie« der Verteidigung gestellt und wenn, bleibt es häufig bei einer im Allgemeinen verharrenden Gegenüberstellung von Abschreckung und Diplomatie. So heißt es bspw. in dem Aufruf »Der Appell« vom März 2022: „Die Anschaffung von konventionellen Waffen wie Kampfflugzeugen und bewaffnungsfähigen Drohnen als Abschreckung unter atomaren Militärblöcken ist sinnlos.“ (Dieren u.a. 2022) Vor dem Hintergrund der dargestellten Debatten über die Nuklearstrategie der NATO im Ost-West-Konflikt könnte man diesen Satz durchaus als ein Eintreten für eine Strategie der Massiven Vergeltung lesen. Mindestens aber scheint hier ein dichotomes Denken auf, das nur die Alternativen von nuklearer Abschreckung, mit ihren bekannten Paradoxien und Gefahren, und allgemeiner Abrüstung kennt. Umgekehrt haben Befürworter*innen des Sondervermögens und eines langfristig gesteigerten Verteidigungshaushalts bisher selbst keine konkreten Konzepte vorgelegt, wie sie sich die zukünftige Verteidigung etwa des Baltikums vorstellen.
Die zukünftige Verteidigung muss zwei Anforderungen gerecht werden: Sie muss Krisenstabilität gewährleisten, also nicht zur (unbeabsichtigten) Eskalation beitragen und gleichzeitig glaubwürdig in der Lage sein, einen gezielten Angriff, vergleichbar dem auf die Ukraine, abwehren zu können. Für die erste Anforderung stellt sich jedoch unter anderem im Baltikum ein Dilemma: Der begrenzte Raum, die geografische Lage und die Siedlungsdichte schließen eine Rückkehr zu überkommenen, panzerlastigen Konzepten konventioneller Verteidigung aus. Diese würden zu hohen Truppenkonzentrationen auf engem Raum führen, die sich als Ziele für taktische Nuklearwaffen geradezu anbieten. Schweren Verbänden bliebe, um den Raum zu gewinnen, der nötig ist, um ihre militärischen Stärken auszuspielen, nur der Ausbruch in Richtung Belarus und Russland selbst. Auch muss dahingestellt bleiben, ob »tiefe Schläge« im Sinne von »Deep Strike«-Konzepten, selbst wenn sie nur konventionell durchgeführt würden, nicht auch Kommando- und Kontroll-Einrichtungen der russländischen Nuklearstreitkräfte beeinträchtigen würden. Eine Eskalation auf die nukleare Ebene wäre nicht auszuschließen. Im Falle einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland würde damit auf beiden Seiten massiver Druck herrschen, als erster anzugreifen (Präemption), um einem tatsächlichen oder nur vermuteten Angriff des Gegners zuvorzukommen.
Defensive Verteidigungskonzepte nach dem Prinzip der »Spinne im Netz« könnten hier einen Ausweg weisen. Durch die Netzstruktur würden lohnende Ziele für Nuklearwaffen vermieden werden. Mobile gepanzerte Elemente könnten auf Größen begrenzt bleiben, die den geographischen Bedingungen im Baltikum Rechnung tragen. Ebenso würde die Notwendigkeit für präemptive tiefe Schläge ins Hinterland entfallen. Die Anforderung der Krisenstabilität würde also erfüllt werden. Gleichzeitig aber bliebe die zweite zentrale Anforderung durch eine Spezialisierung auf defensive Kräfte erfüllt: Die erfolgreiche Abwehr eines gezielten Angriffs. Unter diesen Bedingungen könnte ein solches Konzept dann langfristig auch Rüstungskontrolle ermöglichen.
Anmerkung
1) Ebenso existente nicht-militärische Verteidigungskonzepte sollen mit diesem Beitrag nicht absichtlich übersehen werden. Der Schwerpunkt liegt mithin aufgrund der gebotenen Kürze des Beitrags auf der Erörterung militärischer Konzepte. Eine Darstellung der »Sozialen Verteidigung« u.a. Konzepte muss an anderer Stelle erfolgen.
Literatur
Afheldt, H. (1976): Verteidigung und Frieden – Politik mit militärischen Mitteln. München: Hanser.
Armes, K. (1988): Discriminate deterrence: Western European comment. The Atlantic Community Quarterly, 26(3), S. 247-269.
Dieren, J. u.a. (2022): Der Appell – HET BONHE – Nein zum Krieg! – Demokratie und Sozialstaat bewahren – Keine Hochrüstung ins Grundgesetz! Veröffentlicht als Homepage, März 2022.
Iklé, F.; Wohlstetter, A. (1988): Discriminate deterrence. Report of the commission on integrated long-term strategy. Washington, DC.: Department of Defense.
Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik (Hrsg.) (1989): Vertrauensbildende Verteidigung – Reform deutscher Sicherheitspolitik. Gerlingen: Bleicher Verlag.
Unterseher, L. (1987): Bewegung, Bewegung! Zur Kritik eingefahrener Vorstellungen vom Krieg. Sicherheit und Frieden 5(2), S. 90-97.
Weizsäcker, C. F. v. (Hrsg.) (1971): Kriegsfolgen und Kriegsverhütung. München: Hanser.
Lukas Mengelkamp, M.A., wohnhaft in Darmstadt, ist Historiker und promoviert an der Universität Marburg über die Geschichte der Kritik nuklearer Abschreckung in den 1970er und 1980er Jahren.