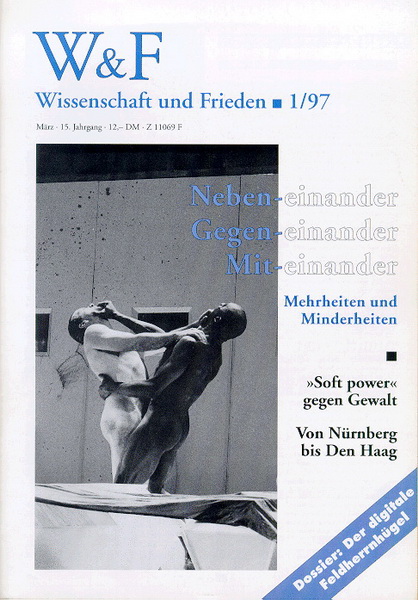Der Erdgipfel und die indigenen Völker
Eigene Territorien – Voraussetzung zum kulturellen Überleben der amazonischen Waldvölker
von Jürgen Wolters
Auf der Tagesordnung des Erdgipfels der Vereinten Nationen zum Thema Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro (UNCED) spielten die Belange indigener Völker eine bemerkenswerte Rolle. Im Vordergrund stand die Anerkennung ihrer Vorbildfunktion für »sustainable development«, das Leitmotiv der Agenda 21. Ohne Frage hat Rio die internationale Wahrnehmung der Belange indigener Völker gefördert und ihre Rechtsansprüche auf kulturelle, soziale und ökonomische Eigenständigkeit gestärkt. Merklich gestiegen ist auch das Selbstbewußtsein vieler Völker auf nationaler wie internationaler Bühne. Aber gewachsene politische Beachtung hat im Alltag auch alte, handfeste Ressentiments belebt und neue Konflikte geschürt. Die indianischen Waldvölker Amazoniens gehören zu den Leittragenden.
Es entbehrt nicht der Pikanterie, daß die internationale Politik im Zusammenhang mit der in Rio geführten, umfassenden Diskussion über die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen die indigenen Kulturen quasi neu entdeckt und scheinbar endlich schätzen gelernt hat. Jahrhunderte lang waren Unterdrückung, Entrechtung und Zwangsassimilation indigener Völker Kennzeichen sowohl der Kolonialpolitik wie der Politik der staatlichen Eliten. Allein in Brasilien wurden so in den vergangenen 500 Jahren über 1200 indianische Völker ausgerottet, 80 noch in diesem Jahrhundert. Übrig blieben nicht einmal 170 amazonische Waldvölker.
Je nach Definition und Abgrenzung existieren heute weltweit noch 4000 bis 5000 indigene Kulturen, die – mißt man sie an der Sprachidentität – allen Verfolgungen zum Trotz immer noch über 90 Prozent der kulturellen Vielfalt der Erdbevölkerung repräsentieren. Von »den« indigenen Völkern zu reden, ist allerdings eine extreme Vereinfachung, die insbesondere den sehr unterschiedlich gelagerten Interessen der einzelnen Gesellschaften keineswegs gerecht wird. Es gibt indigene Völker, die etliche Millionen Menschen umfassen, und andere, deren Mitglieder sich an zwei Händen abzählen lassen. In Brasilien sind sie beispielsweise mit weniger als einem Prozent an der Gesamtbevölkerung numerische Randgruppen und werden auch so aufgefaßt. Sie leben und wirtschaften überwiegend sehr ursprünglich und sehen sich alltäglich Rechtsverletzungen ausgesetzt. Im Nachbarland Bolivien stellen sie dagegen mit mehr als 70 Prozent das Gros der Landesbevölkerung, sind in Parlamenten vertreten und gemessen am Lebens- und Kulturstil nicht mehr generell als Indigene identifizierbar. Gemeinsam ist den meisten Indigenen allein die historische Definition »unmittelbare Nachkommen der Urbewohner«.
Die von UNCED neu angestoßene Diskussion focussiert auf Indigene im kulturell ursprünglichen Sinn, nämlich auf Völker, die sich spirituell, sozial und ökonomisch als Teil eines natürlichen Beziehungsgefüges sehen, konsequent danach leben und wirtschaften. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es zuvorderst utilitaristische Gründe waren, die im Rio-Prozeß zu einer besonderen Anerkennung solcher indigenen Völker führten. So ist in der Rio-Deklaration davon die Rede, daß Indigene (der Ausdruck Peoples wird dabei bewußt vermieden) wegen ihrer besonderen Kenntnisse eine vitale Rolle im Umweltmanagement und der Entwicklung spielen und daß Staaten (deshalb) ihre Identität, Kultur und Interessen anerkennen und unterstützen sollen, sowie ihre effektive Partizipation bei der Erzielung dauerhafter Entwicklung.
Diese Herangehensweise setzt sich konsequent in den diversen Vertragswerken des Rio-Prozesses fort, in dem Weltaktionsplan Agenda 21 und insbesondere in dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention). Hier ist, wenn auch unverbindlich deklariert, sogar von dem Gebot des gezielten Erhaltes und der Förderung der erwiesen naturverträglichen Praktiken indigener Völker die Rede, von der Notwendigkeit politischer Partizipation, vom Aufbau von Beteiligungsmechanismen und der Beseitigung indigenenfeindlicher politischer Praktiken.
UNCED setzt Impulse für internationale Indigenenpolitik
Sicher nicht zufällig hat sich im Umfeld von UNCED die Wahrnehmung der Belange indigener Völker auch auf anderen Ebenen verbessert. Kurz vor dem Rio-Gipfel trat die Konvention 169 der ILO (International Labour Organization) in Kraft, das bis dato fortschrittlichste Instrumentarium zur Anerkennung der Rechte indigener Völker, dem allerdings angesichts einer kläglichen Schar von einem knappen Dutzend Zeichnerstaaten jede größere Wirkung genommen ist. Das Jahr 1 nach Rio wurde von den Vereinten Nationen zum »Internationalen Jahr der indigenen Bevölkerung ausgerufen«. Mehr noch, auf Empfehlung der 1993 in Wien abgehaltenen UN-Weltkonferenz über Menschenrechte wurde 1994 gar die »Dekade der indigenen Völker« postuliert, in der zumindest innerhalb der UNO die politische Partizipation Indigener gestärkt werden soll.
Entscheidende Impulse erhofft man sich jetzt auch für die Arbeit der UN-Working Group on Indigenous Populations, die an einer »Allgemeinen Erklärung der Rechte der indigenen Völker« arbeitet. Fast 15 Jahre ist diese UN-Arbeitsgruppe bereits tätig. Der Durchbruch in den zähen Verhandlungen scheitert bislang an der kontroversen Diskussion über die Definition indigener Völker und vor allem an der Frage ihrer völkerrechtlichen Anerkennung, die schon von der ILO-Konvention 169 ausgeklammert wurde. Die Arbeit der UN-Working Group wird von indigenen Völkern zwar überwiegend positiv zur Kenntnis genommen, aber gleichzeitig fragen viele zu Recht, wieso es angesichts der Tatsache einer längst vorliegenden »Allgemeinen Definition der Menschenrechte« denn noch eine spezifische für Indigene braucht.
Neue Fragen: Kulturelle und intellektuelle Eigentumsrechte
Parallel zu diesen Prozessen haben sich im Zuge des UNCED-Prozesses indigene Völker und ihre Dachorganisationen politisch selbst zu Wort gemeldet. Der Verabschiedung der »Charta der indigenen Stammesvölker der tropischen Regenwälder« Anfang 1992 in Penang folgte nur wenig später die Formulierung der »Erdcharta der indigenen Völker«. Indigene Völker reklamieren hier unmißverständlich ihr Selbstbestimmungsrecht und die unveräußerlichen Rechte an ihrem Land und sämtlichen Ressourcen ihrer Territorien. In der 1993 verabschiedeten Mataatua-Erklärung der indigenen Völker wird insbesondere auf deren kulturelle und geistige Eigentumsrechte Bezug genommen und damit ein Themenkomplex aufgegriffen, der auch in der neuen Biodiversitätskonvention eine wichtige Rolle spielt.
Diese deklariert nicht nur die Grundsätze für den Erhalt der biologischen Vielfalt, sondern beschäftigt sich auch mit dem Zugang zu genetischen Ressourcen, mit Fragen der Verwertung von Nutzungskenntnissen und der Nutzenaufteilung. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage der gerechten Teilhabe indigener Völker an der Verwendung ihrer Kenntnisse der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen ihrer Lebensräume. Insbesondere die Nationalstaaten in den Tropen, die über 90 Prozent der biologischen Vielfalt beherbergen, sind damit politisch und rechtlich erheblich gefordert.
Die aktuelle politische Diskussion von Indigenenfragen beschränkt sich also längst nicht mehr auf originäre Menschenrechtsanliegen, sondern schließt zunehmend auch komplizierte ökonomische Fragen ein. Daß es sich hierbei nicht um Marginalien handelt, verdeutlicht die Tatsache, daß derzeit weltweit allein im Pharmabereich über 40 Milliarden Dollar mit den Ursprungskenntnissen indigener Völker verdient werden. Zwei Drittel der Welternährung hängt nach wissenschaftlichen Schätzungen von indigenem Wissen über die Nutzung genetischer Ressourcen ab. Die Internationale Ethnobotanische Gesellschaft schätzt gar, daß sich mehr als 99 Prozent des gesamten Wissens der Menschheit über die Nutzung biologischer Ressourcen im Besitz indigener Völker befinden.
In der Mataatua-Erklärung fordern diese die Nationalstaaten und die internationalen Organe nicht nur zur Anerkennung ihrer kulturellen und intellektuellen Eigentumsrechte auf, sondern auch zur Entwicklung von Regimen, die die Kontrolle Indigener über die Verwendung ihres Wissens und von Ressourcen aus ihren Territorien ermöglichen. Diesen Ansprüchen steht das deklarierte Souveränitätsrecht vieler Staaten entgegen, dem zufolge Indigene nur beschränkt über die Ressourcen auf ihrem Land verfügen dürfen.
Gemäß der Biodiversitätskonvention sind alle Zeichnerstaaten verpflichtet, im Planungsrecht, im Abgabe-, Patent- und Urheberrecht die Belange und Ansprüche indigener Völker angemessen zu berücksichtigen. Eine Reihe von Staaten verfügt noch nicht einmal über das gebotene Rechtsinstrumentarium etwa zum Urheber- und Patentschutz. Indigene Völker fordern zudem verständlicherweise angesichts jahrhundertelanger Ausbeutung ihres Wissens und ihrer Kulturgüter rückwirkenden Schutz und gemäß ihrem sozialen und kulturellen Verständnis auch einen generationenübergreifenden Schutz von kollektivem geistigen Eigentum. Bestehende Rechtsinstrumente lassen sich darauf im Regelfall gar nicht unmittelbar anwenden.
Das Thema ist brisant. Die gewachsene internationale Diskussion über die Nutzung genetischer Ressourcen hat eine ganze Welle von Bio-Prospektierungsinitiativen ausgelöst. Viele Tropenwaldländer wittern neue Einnahmequellen. Wo, wie in Brasilien, eine zahlenmäßige Minderheit wie die indigenen Völker mehr als sieben Prozent der Landesfläche für sich reklamieren kann – darunter in absehbarer Zeit die Filetstücke noch erhaltenen Regenwaldes – scheinen Konflikte geradezu vorprogrammiert.
Der Rio-Prozeß hat zur Lösung all dieser Probleme bislang nicht mehr als Anstöße gegeben. Konkrete praktikable Lösungen müssen erst noch entwickelt werden. Denkbar ist in diesem Zusammenhang im internationalen Politikbereich etwa die Verabschiedung eines eigenen Protokolls unter der Biodiversitätskonvention, das die Handlungsgrundlagen für die Absicherung der kulturellen Eigenständigkeit und Unversehrtheit indigener Kulturen regelt. Hier ist die internationale Staatengemeinschaft und sind die einzelnen Länder des Nordens gefordert, sich umgehend für entsprechende Fortentwicklungen der neuen Instrumentarien einzusetzen und im eigenen unmittelbaren Handlungsbereich etwa durch Verhaltenscodices für die heimische Wirtschaft und die Entwicklungszusammenarbeit konsequent die berechtigten Interessen indigener Völker zu fördern.
Für die indigenen Völker – und dies darf nicht übersehen werden – stellen mögliche positive Entwicklungen im geistigen Eigentumsschutz natürlich auch große innere Herausforderungen dar. Eine denkbare finanzielle Beteiligung an der Wertschöpfung ihrer Kenntnisse führt nämlich auch zu Kapitalisierungssystemen, die naturgebundene Ökonomie, Gemeinschaftsbesitz und andere kulturelle Charakteristika auf eine große Bewährungsprobe stellen.
Reaktionen in der brasilianischen Indigenenpolitik
Das Wichtigste an der neuen Debatte über die Rechte indigener Völker ist allerdings die Aktualisierung der Frage nach der Absicherung und effektiven Kontrolle indigener Völker über ihre Territorien. Dies bleibt der Kernpunkt der Überlebenssicherung traditioneller indigener Kulturen.
Gerade hierbei drängt sich der Eindruck auf, als habe zum Beispiel in Brasilien, dem Gastland der UN Konferenz zu Umwelt und Entwicklung, die neue Diskussion von Indigenenfragen vor allem die Gegner einer praktischen Anerkennung indigener Rechte auf den Plan gerufen. Während im Vorfeld von UNCED der damalige brasilianische Präsident Collor noch demonstrativ Landebahnen von Goldsuchern in Indianergebieten zerstören ließ, hat sich die Situation der Stammesvölker in der Folge eindeutig verschärft.
Dazu mag ungewollt sogar eine Initiative der G7-Staaten beigetragen haben, deren Bezug zum UNCED-Prozeß ebenfalls unübersehbar ist und die auf einen Vorstoß des deutschen Bundeskanzlers zurückgeht: das »Pilotprogramm zur Bewahrung der Tropenwälder in Brasilien«. Gedacht war das Vorhaben, dem Brasilien nach einigem Zögern grundsätzlich zustimmte, als Musterprogramm für international koordinierte und finanzierte Programme zum Erhalt der Tropenwälder weltweit. Brasilien wurde nicht zufällig als Pilotland ausgewählt. Es beherbergt über 40 Prozent der noch verbliebenen Regenwälder der Erde. Ende 1991 formal auf den Weg gebracht, sollte das Pilotprogramm seine Wirksamkeit binnen drei Jahren beweisen.
Es umfaßt eine Palette verschiedener Handlungsbereiche, von der Stärkung institutioneller Strukturen über Verbesserung des Managements von Schutzgebieten und die Entwicklung nachhaltiger Waldnutzungskonzepte bis zur Forschungsförderung. Auch für Indigene sieht es besondere Investitionen vor, zum Beispiel 30 Millionen Dollar zur Forcierung der Demarkation von Indigenengebieten. Daneben enthält das Programm auch einen eigenen Projektfonds zur Förderung von Kleinprojekten brasilianischer Nichtregierungsorganisationen, der natürlich auch indigenen Völkern zur Nutzung offensteht. Das Gesamtprogramm wird von der Weltbank verwaltet, wobei größere Teilvorhaben auch in direkter bilateraler Kooperation mit Geberländern abgewickelt werden können; in direkter Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik beispielsweise das Projekt zur Demarkation von indigenen Territorien.
Schon in der parlamentarischen Beratung der verschiedenen Teilkomponenten des Pilotprogramms wurde politischer Widerstand gegen das Projekt deutlich. Bezüglich der Demarkation der indigenen Territorien trat insbesondere der brasilianische Justizminister Jobim auf den Plan. Nach der neuen brasilianischen Verfassung von 1988, in der die Anerkennung der Landrechte indigener Völker verbrieft ist, sollten eigentlich schon bis 1993 alle 556 indigenen Gebiete des Landes demarkiert und rechtsverbindlich in den Grundbüchern eingetragen sein. Zum gesetzten Termin war man davon weit entfernt.
Der Justizminister Jobim bestritt der einschlägigen Rechtsverordnung sogar die Verfassungsgemäßheit und setze 1996 ein neues Dekret (1775) durch, demzufolge binnen einer für Frühjahr 1996 terminierten Frist jedermann Einsprüche gegen die Zonierung von rechtlich noch nicht abschließend bestätigten Indianergebieten erheben konnte – immerhin 345 Gebiete mit einem Anteil am gesamten indigenen Territorium von etwa 45 Prozent. Offiziell sollte die neue Vorschrift möglichen zukünftigen Verfassungsklagen vorbeugen, was von diversen brasilianischen Rechtsexperten aber durchaus anders interpretiert wurde.
Das Prüfverfahren der Einsprüche dauert derzeit noch an. Nach inoffiziellen Angaben sollen bis zu 2000 Eingaben gegen 60, möglicherweise sogar 120 Indianerterritorien vorliegen. Die nächsten ein bis zwei Jahre werden zeigen, ob es – wie viele Indianer befürchten – im Rahmen des neuen Dekretes zu einer deutlichen Einschränkung indianischer Lebensräume kommen wird.
Möglicherweise gravierender sind die unmittelbaren Folgen für die Indianer Amazoniens, die sich aus der neu entfachten politischen Diskussion über die Waldvölker ergaben. In verschiedenen Regionen des Landes ist es in den beiden letzten Jahren in erheblichem Umfang zu neuen Invasionen und Übergriffen auf Indianergebiete gekommen. Die Handlungsmöglichkeiten der staatlichen Indianerbehörde haben sich spürbar verschlechtert. Hochrangige Politiker warben zuletzt sogar in Wahlkämpfen mit der endgültigen Lösung der brasilianischen Indianerfrage durch Zwangsintegration. Im Bundesstaat Rondonia, in dem fast ein Viertel aller noch existierenden Völker beheimatet ist, hat sich die Gesundheits- und Ernährungssituation der Indianer dramatisch verschlechtert. Der Katholische Indianermissionsrat (CIMI) dokumentierte im vergangenen Jahr in einen hundertseitigen Bericht aktuelle Verletzungen der Menschenrechte indigener Völker in Brasilien.
Internationale Solidarität mit indigenen Völkern mehr denn je gefragt
Entwicklungen wie die in Brasilien waren absehbar. In dem gleichen Maße, wie sich durch internationale Anerkennung prinzipielle Fortschritte in der Indigenenfrage abzeichneten, wuchsen vielerorts die handfesten politischen Widerstände. Die deutsche Bundesregierung lief sogar Gefahr, mit ihrem fraglos gut gemeinten Engagement zur Absicherung der Territorien brasilianischer Indianer zum Steigbügelhalter indigenenfeindlicher Politik zu werden. Sie hat sich dagegen verwahrt und ihre brasilianischen Partner vor Mißbrauch deutscher Fördermittel gewarnt.
Damit allein ist es allerdings nicht getan. Das brasilianische Pilotprogramm, dessen Teilkomponenten jetzt mit großer Verzögerung schleppend umgesetzt werden, trägt nämlich nur in Ansätzen den Geist von Rio. Es blendet völlig die Verantwortung der Industriestaaten an der Tropenwaldzerstörung und damit auch der Verschlechterung der Lage indigener Völker aus. Es ignoriert längst überfällige Korrekturen in der Handels- und Außenwirtschaftspolitik der Industrieländer gemäß der Agenda 21.
Der UNCED Prozeß hat eine Weichenstellung vorgegeben. Die Impulse, die er gerade auch in der Indigenenfrage gesetzt hat, müßten mit sehr viel größerer Ernsthaftigkeit weiterentwickelt werden und sich in der jeweiligen nationalen Politik der Industrieländer verstärkt wiederspiegeln. Jetzt auf halbem Wege stehen zu bleiben hieße jedenfalls, der Sache der Indigenen gegebenenfalls mehr zu schaden als zu nutzen.
Literatur
Cimi (1996): A violência contra os povos indigenas no Brasil 1994-1995. Brasilia.
Dömpke, S., Gündling, L. u. Unger, J. (1996): Schutz und Nutzung biologischer Vielfalt und die Rechte indigener Völker. Forum Umwelt & Entwicklung. Bonn.
Durning, A.T. (1992): Guardians of the Land: Indigenous Peoples and the Health of the Erarth. Worldwatch Paper 112. Washington.
N.N. (1996): Herausforderungen an das Gelingen des Pilotprogramms. Erklärung deutscher Nichtregierungsorganisationen zur Teilnehmerkonferenz des Pilotprogramms zur Bewahrung der Tropenwälder in Brasilien. Bonn.
Regenwälder Kampagne (1993): Indigene Völker und Wald. Statusbericht, Empfehlungen und Perspektiven für die bundesdeutsche Politik. Bielefeld.
Jürgen Wolters ist Geschäftsführender Vorstand und Referent für Indigenenfragen der Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA e.V.), Bielefeld.