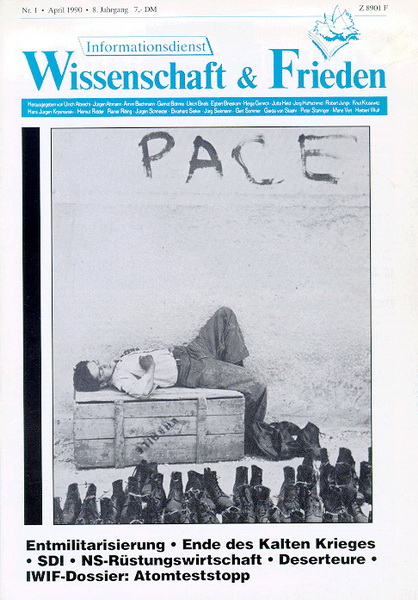Der Niedergang des »bipolaren Systems« oder: Ein zweiter Blick auf die Geschichte des Kalten Krieges (Teil II)
von Gian Giacomo Migone
Das bipolare System schafft sowohl ein unausgesprochenes Einverständnis, als auch eine gegenseitige Bedrohung. Dies ist lebenswichtig für die Sicherung der inneren Stabilität der beiden Supermächte sowie für ihre Macht, den Einfluß und die Kontrolle im Ausland auszudehnen und zu festigen.
Es wäre jedoch ein Fehler, anzunehmen, diese Ziele würden ausschließlich durch Spannung erreicht. Die Geschichte der letzten 40 Jahre hat gezeigt, daß es vielmehr die wechselnde Anwendung von Spannung und Entspannung ist, die die privilegierte Position der vorherrschenden Mächte stärkt. Zuviel Spannung könnte, abgesehen von anderen offensichtlichen Risiken, den Eindruck erwecken, Moskau und Washington seien nicht in Lage, die Welt auf verantwortungsvolle Weise zu führen. Zu lange Phasen der Entspannung könnten das Fundament der bipolaren Disziplin zerstören, die auf einem Notstand basiert. In diesem Sinne muß Entspannung von oben her geregelt werden, von den selben Machtzentren in den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, die in einer vorherigen Phase ihrer Beziehungen einen Zusammenstoß riskiert haben. Auch wenn die Auswirkungen der Entspannung berechnet und ausgehandelt werden könnten und sollten, ist der Übergang von einer Spannungs- zu einer Entspannungsphase stets durch eine bestimmte Krisensituation in einer der Supermächte ausgelöst worden, auf die die jeweils andere in eindeutiger Weise reagiert hat, in der Hoffnung auf weitere Vorteile und mit der Absicht, das bipolare System zu stabilisieren.
Im Rückblick fiel Camp David 1959 (aber auch die abrupte Unterbrechung des Pariser Gipfels nach dem U2 Zwischenfall) mit dem Beginn einer internen Krise zusammen, die damit endete, daß Chruschtschow seine Position als Erster Sekretär der KPdSU verlor. Ebenso reagierte die Entspannung in den 70er Jahren auf das Bedürfnis der USA, nach der Niederlage in Vietnam eine Begrenzung des Wettrüstens auszuhandeln. Es ist kein Zufall, daß dieser Prozeß in den Monaten kulminierte, die dem Rücktritt Richard Nixons als Konsequenz aus der Watergate-Krise vorausgingen. Die gegenwärtige Verhandlungsphase zwischen den Vereinigten Staaten und Michail Gorbatschow ist vielleicht vielversprechender als frühere, weil sie so offensichtlich von internen Schwierigkeiten ausgelöst wurde, von denen, wie wir noch genauer sehen werden, beide Supermächte gleichzeitig betroffen waren.
Zu beachten ist, daß Entspannung, während sie zu Abkommen verschiedenen Inhalts und unterschiedlicher Bedeutung zwischen den Protagonisten führt, zugleich immer auch (zumindest zeitwei se) deren Kontrolle über die Innenpolitik und ihre jeweiligen Interessenssphären verstärkt. Politisch überlebte Chruschtschow auch über die Raketenkrise hinaus. Seine Dialoge mit Moskau und Peking bewahrten Nixon eine zeitlang vor den Folgen von Watergate. Der Vertrag, den Reagan mit Gorbatschow aushandelte, lenkte die öffentliche Meinung Amerikas vom Irangate-Skandal ab, sowie von anderen Fehlschlägen in der Außenpolitik und von den negativen Auswirkungen des Haushalts- und Zahlungsdefizits auf die amerikanische Wirtschaft. Gerade die Symbolträchtigkeit von Gipfeltreffen stärkt die zwei führenden Männer in den Augen ihres jeweiligen Heimatpublikums und der anderen Länder, die daraufhin umso mehr bereit sind, Macht an sie zu delegieren. In der nächsten Krise wird dann eine ähnliche Delegierung von Macht durch die Notwendigkeit gerechtfertigt werden, ein Boot dürfe bei Sturm nicht zum Schaukeln gebracht werden.
Konfrontation und Entspannung komplementär
Konfrontation und Entspannung sind letztlich zwar zwei verschiedene, doch komplementäre Phasen des bipolaren Systems. Was wir Entspannung zu nennen gelernt haben, gefährdet an sich selbst nicht die »raison d`être« der bipolaren Beziehungen. Zunächst einmal wird Entspannung, im gleichen Maße wie Konfrontation, von den Supermächten gelenkt. Von den kleineren Verbündeten wird erwartet, daß sie sich mit einer zeitweisen Verminderung der Gefahr eines direkten Konfliktes zufriedengeben. Die amerikanischen Reaktionen auf Willy Brandts Version von Entspannung in Form der Ostpolitik sprechen dies sehr deutlich aus.
Zum zweiten ist Entspannung kein Hindernis für interne Repression innerhalb der jeweiligen Einflußsphäre. Im Gegenteil: einige der brutalsten Formen der zwangsweisen `Normalisierung' fanden in Entspannungsperioden statt, oder zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Ost-West-Konflikt. Die Invasion Ungarns folgte auf den 20. Parteitag der KPdSU. Die Invasion in die Tschechoslowakei erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die amerikanische Aufmerksamkeit auf anderes gerichtet war. Der Staatsstreich in Chile fiel mit einem der Höhepunkte des sowjetisch-amerikanischen Dialogs zusammen. Allein die jüngsten Versuche, die Lage in Polen zu »normalisieren« stimmten mit den verbalen Feindseligkeiten überein, die so typisch waren für die erste Phase der Präsidentschaft Reagans. Ihr Zeitplan war jedoch relativ unabhängig vom Stand der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen. Es sollte hinzugefügt werden, daß solche Versuche der »Normalisierung« keine ernsthaften Gegenschläge von seiten der Supermacht provozieren, die nicht direkt betroffen ist; sie gibt sich mit dem auf diese Weise erzielten ideologischen und propagandistischen Nutzen zufrieden. Die Sorge um unterdrückte Völker erweist sich (im Interesse der Entspannung) als klug und rein verbal. Daher kann festgestellt werden, daß durch Entspannung eine dritte Grundregel des bipolaren Systems nicht verletzt wird: die Supermächte versuchen nicht ernstlich, die Einflußsphäre des jeweils anderen zu unterminieren, jedenfalls nicht in Europa. In der Nachkriegszeit versuchte die Sowjetunion jegliche revolutionäre Bestrebung kommunistischer Parteien im Westen zu verhindern. Sogar in der Dritten Welt waren kommunistische Parteien immer sehr vorsichtig in ihrer Unterstützung für nationale Befreiungsbewegungen, besonders in deren Anfängen. Unterstützung durch die Sowjetunion bekommen sie immer erst, wenn sie die Staatsmacht erlangt haben. In jüngerer Zeit waren Versuche, den internationalen Terrorismus im Westen mit der Sowjetunion in Verbindung zu bringen, totale Mißerfolge. In ähnlicher Weise war die Unterstützung für osteuropäische Dissidenten minimal und auf das Reich der Propaganda beschränkt.
Wenn diese Grundregeln sich weder in Konfrontations- noch in Entspannungsphasen ändern, sollten wir daraus schließen, daß letztere Drittparteien keinen Nutzen bringen? Man darf nicht vergessen, daß einige Initiativen – noch einmal: die Ostpolitik Willy Brandts – außerhalb des Zusammenhangs der Entspannung nicht möglich gewesen wäre. Außerdem wüede eine solche Schlußfolgerung die Stärke der Entspannung unterschätzen, die in der Verminderung der Kriegsgefahr liegt.
Daher ist die Schlußfolgerung widersprüchlich: Entspannung ist für den Frieden förderlich, weil sie, solange sie andauert, das Kriegsrisiko verringert; sie hilft, Zeit zu gewinnen. Doch auf längere Sicht stärkt sie ein System – das bipolare System – das ganze Völker ihrer Rechte beraubt, die militärischen Bündnisse stärkt, das Wettrüsten beschleunigt und auf Dauer die Gefahren für den Frieden vermehrt.
Daraus folgt nicht unbedingt, daß der gegenwärtige Dialog zwischen den Supermächten einfach eine zyklische Phase der bipolaren Beziehungen ist. Wir bewegen uns auf eine fundamentale Krise des bipolaren Systems zu, die uns in Bereiche jenseits der Entspannung drängen könnte, wie wir sie in der Vergangenheit gekannt haben.
Das internationale System beruht auf der dominierenden Rolle der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Ihr Niedergang, der in den 60er Jahren begann, ist in eine neue und akute Phase getreten. Es ist nicht schwierig, vorauszusehen, daß die Auswirkungen auf das bipolare System als ganzes verheerend sein werden. Der Ausgang ist gleichzeitig vielversprechend und äußerst gefährlich.
Weltökonomie im Umbruch
Die deutlichste Veränderung war wirtschaftlicher Art. Nach dem Krieg war der größte Teil Europas physisch vernichtet. Trotz aller institutionellen Unzulänglichkeiten und aller Zänkereien über wirtschaftliche Fragen hat die Europäische Gemeinschaft heute ein höheres Bruttosozialprodukt und eine größeren Anteil am Welthandel als die Vereinigten Staaten. Ihre Produktivität, obwohl geringer als die japanische, ist höher. Während die Europäer ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht haben, haben militärische Investitionen der amerikanischen Technologie einen dynamischen, wenn auch begrenzten, Fortschritt gebracht. Der Umfang der Zahlungsbilanz- und der Haushaltsdefizite ist eine ständige Bedrohung für die Stabilität der gesamten amerikanischen Wirtschaft. Währenddessen hat der Fortschritt der im Krieg besiegten Nationen in einem beträchtlichen Maße die frühere wirtschaftliche Hierachie wiederhergestellt. Ein dynamischer Industrialisierungsprozeß hat verschiedene Teile der Dritten Welt erfaßt.
Auf der anderen Seite stagniert die sowjetische Wirtschaft und ist äußerst abhängig vom Import westlicher Technologie sowie belastet durch die Unterstützung, die sie einigen ihrer Satellitenstaaten aus Gründen der politischen Stabilität gewähren muß: die letzten Überreste einer traditionellen Form von Kolonialismus, in dem für die politische Kontrolle bezahlt werden muß, statt daß sie wirtschaftlichen Nutzen bringt. Die Last der Militärausgaben ist sogar noch beschwerlicher, weil die sowjetische Wirtschaft im ganzen soviel kleiner ist, als ihr amerikanisches Gegenstück.
Natürlich ist dieser Wandel das Endergebnis eines langen Prozesses, im Verlaufe dessen die Vereinigten Staaten die Fähigkeit verloren haben, die Weltwirtschaft als ganzes zu regeln, wie es im Abkommen von Bretton Woods festgelegt worden war. In den frühen 70er Jahren beendete die amerikanische Regierung, nachdem sie den Vietnamkrieg durch den Export der Inflation finanziert hatte, die Konvertierbarkeit des Dollar und fungierte nicht länger als regulierende Macht der gesamten Weltwirtschaft. Eine ausführliche Geschichte der Ölkrise muß erst noch geschrieben werden, doch gibt es keinen Zweifel, daß ihre Bedeutsamkeit nicht nur in einer längst überfälligen Machtbehauptung der Produzenten lag, sondern auch in einer erheblichen Schwächung jener Industrieländer, die Ölkonsumenten waren, ohne zugleich nennenswerte Ölproduzenten zu sein ( hauptsächlich Westeuropa und Japan).
Vom Vietnam-Syndrom zur Reagan-Doktrin
Dieser vorübergehende Vorteil der Vereinigten Staaten gegenüber den Ländern, die sie inzwischen vor allem als industrialisierte Konkurrenten betrachtete, war nicht genug, um den amerikanischen Niedergang aufzuhalten. In der Zwischenzeit war durch den Vietnamkrieg aus der Politik der Nichteinmischung eine Art Falle geworden, wie es ihre frühen Kritiker – Walter Lippmann, aber auch George Kennan (der sich bald wie ein Zauberlehrling zu fühlen begann) – von Anfang an vorausgesagt hatten. Eine weitgefaßte und zugleich starre Auslegung der Truman-Doktrin hatte die Vereinigten Staaten in den Krieg auf dem asiatischen Kontinent hineingezogen. Die Wilsonsche Tradition, gepaart mit einer natürlichen Tendenz amerikanischer imperialer Interessen, unterwürfige Schützlinge in der ganzen Welt zu unterstützen, führte zu dem, was Psychoanalytiker Größenwahn nennen, und den aufzugeben, Administrationen der Demokraten besonders schwer fiel. Der Vietnamkrieg wurde aufgrund der Überzeugung geführt und verloren, daß ein Kolonialkrieg gleichzeitig mit dem Export des amerikanischen Systems ausgefochten werden könnte. Die Verbindung von unnachgiebigem Widerstand auf vietnamesischer Seite und der dramatischen Spaltung an der Heimatfront führte zu einer traumatisierenden Niederlage, die von nun an im Vorfeld eines jeden bedeutenden Einsatzes amerikanischer Truppen im Ausland wieder eine Rolle spielen sollte. Das sogenannte Vietnam-Syndrom war, und ist immer noch, von großer Bedeutung, weil es nichts mit einem Mangel an Entschlossenheit dieser oder jener Administration zu tun hat, wie die Erfahrung mit der Reagan-Administration schlüssig beweist.
Seit Vietnam ist die amerikanische Außenpolitik eine beharrliche aber ergebnislose Suche nach Möglichkeiten gewesen, die Kluft zwischen Phantasie und rauher Wirklichkeit zu schließen. Allein Präsident Carter versuchte, angespornt durch den Watergate-Skandal, während der ersten Zeit seiner Amtsperiode die Nation dahin zu bringen, die Grenzen der amerikanischen Weltmacht zu akzeptieren. Als deutlich wurde, daß die Revolutionen in der Dritten Welt (Angola, Äthiopien, Mozambique, Zimbabwe, Nicaragua) nicht warten würden, und daß die Sowjetunion darauf bedacht war, aus der amerikanischen Schwäche Vorteile zu ziehen, mußte er den Kurs wechseln und stand ohne eine Politik da. Der Weg war frei für einen Arzt, der, weit davon entfernt, seinem Patienten die wahre Natur seiner Krankheit zu erklären, mehr als bereit war, immer größere Dosen von Morphium zu verabreichen.
Von Anfang an war die Antwort, die die Reagan-Administration auf das Vietnam-Syndrom gab, zunächst und vor allem eine rhetorische: es wurde behauptet, die Enttäuschungen der amerikanischen Außenpolitik seien nicht durch die Disproportion von Absichten und Fähigkeiten verursacht worden, sondern eher durch einen Mangel an Entschlossenheit. Nach dieser Interpretation wurde der Vietnamkrieg verloren, weil die Vereinigten Staaten es nicht wagten, ihn zu gewinnen. Darum sollte das Streben nach Vormachtstellung (nicht mehr nur nach Nichteinmischung) nicht nur aufrechterhalten, sondern verstärkt und die Macht (nach dieser Lesart der Zeitgeschichte vor allem politische und psychologische) ausgebaut werden, die zur Erreichung dieser Absicht notwendig ist.
Anfangs wurden die Ziele dieser Politik klug ausgewählt. Es ging darum, »Punkte zu machen«, um die Reagan-Wählerschaft (nur 29% der Wahlberechtigten, doch genug, um einen »erdrutschartigen« Sieg in einem Land zu erreichen, in dem wenig mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung von ihrem Recht Gebrauch macht) dazu zu erziehen, den Preis für diese reformierte Form der Nichteinmischung zu bezahlen. Deshalb wurde El Salvador plötzlich zum Mittelpunkt der amerikanischen Strategie in der Außenpolitik: Als der Kongreß und die öffentliche Meinung (ebenso wie die wahrscheinlich in den militärischen Rängen des Pentagons angesiedelte Vernunft) die direkte amerikanische Intervention nicht zuließen, die zur Beeinflussung der Machtverhältnisse zwischen dem salvadorianischen Militär und den Guerillas notwendig war, spürte die Reagan-Administration eine Situation auf (vielleicht produzierte sie sie auch, doch dafür haben wir keine Beweise), die geringfügig genug war, um eine direkte militärische Intervention zu vertragen. Doch selbst in Grenada wurde es für die Regierung notwendig, die Berichterstattung durch die Medien auszuschließen, und auf diese Weise setzte sie einen bedeutenden Präzedenzfall, als eine weitere Lektion aus dem Vietnamkrieg.
Als dritten Schritt ihrer mittelamerikanischen Strategie setzte die Reagan Administration auf eine Unterstützungspolitik gegenüber den nicaraguanischen Contras, die sich an der Heimatfront als politisch kostspielig erwies und militärisch als absolut erfolglos. Letztlich war die einzige Auswirkung des mittelamerikanischen Manövers auf der außenpolitischen Seite, daß die Sandinistas und andere oppositionelle Kräfte in Mittelamerika noch autoritärer wurden und vor allem: noch abhängiger von kubanischer und sowjetischer Hilfe. In der Zwischenzeit tat die Reagan-Administration ihr bestes, jegliche diplomatischen Bemühungen zu erschweren, die von ihren traditionellen Verbündeten in der Region ausgingen, sei es von der Contadora-Gruppe oder von den mittelamerikanischen Staaten, die von Costa Ricas Präsident Arras angeführt wurden. Betrachtet man diese ganze Politik aus der Perspektive des Ost-West-Konflikts (dem theoretischen Konflikt), so ist sie so unbegreiflich, daß sie einen zweiten Blick erfordert. In der Sichtweise des eigentlichen Konflikts – in dem der wirkliche Gegner nicht mehr die Sowjetunion ist, sondern Westeuropa, die Sozialistische Internationale, progressive Katholiken und die lateinamerikanische Unabhängigkeit – fängt diese Politik zumindest an, Sinn zu machen. Die unmittelbare Absicht ist nicht, die Sandinistas zu entmachten, sondern jegliche Regierungsform in der westlichen Hemisphäre zu zerstören, die wirklich blockfrei ist, pluralistisch und für soziale Veränderungen engagiert. Die Gründe für die Intervention sind dieselben, die die Nixon-Administration dazu bewogen haben, gegen Allende zu konspirieren, und das Mindestresultat, das bewußt oder unbewußt als kleineres Übel angestrebt wird, ist ein zweites Kuba (wenn ein zweites Chile nicht erreichbar ist). Zumindest wird dann die Lektion angekommen sein, daß in diesem Teil der Welt ein attraktiveres Modell außerhalb des nordamerikanischen Einflußbereichs historisch nicht zur Verfügung steht.
Immerhin hätte dies der eigentliche Zweck der Reagan-Doktrin sein können (wie sie von Fred Halliday analysiert wurde). In gewissem Sinne stammte sie von der Nixon-Doktrin ab, die ursprünglich verkündet wurde, um den amerikanischen Abzug aus Vietnam zu decken. Beide Doktrinen sind, was man im Italienischen „scelte obbligate“ (gezwungene Wahl) nennt: wenn der Kongreß und die öffentliche Meinung nicht gewillt sind, amerikanische Jungs im Ausland in den Kampf zu schicken, bleibt als einziges Mittel, vor Ort Kräfte für diese Aufgabe zu bekommen. Die Amerikaner waren weniger erfolgreich als die Sowjetunion, wenn es darum ging, Kriege durch Stellvertreter ausfechten zu lassen. Die Südkoreaner hätten es alleine nie geschafft, und die Südvietnamesen haben es nie ernsthaft versucht. Die Reagan-Doktrin war weniger ehrgeizig als die Nixon-Doktrin: sie wurde nie auf wirklich große Kriege der »Nichteinmischung« angewendet, sondern bot oppositionellen Guerillas Unterstützung, mit der unmittelbaren Absicht, der legitimen Regierung nicht zu erlauben, ihre Politik unter normalen Bedingungen zu entwickeln. Deswegen war sie erfolgreicher als die Nixon-Doktrin. Das Problem ist, daß es den amerikanischen Verbündeten in beiden Fällen an Unterstützung durch die Bevölkerung fehlt. So werden ihre Bemühungen künstlich, ihre Methoden terroristisch und ihr Charakter und ihre Zusammensetzung ist durch Käuflichkeit gekennzeichnet. Die Sowjetunion war in der Anwendung ihrer Gegenstücke zur Nixon- und Reagan-Doktrin erfolgreicher, weil sie bessere Verbündete hatte, die für sie kämpften. Befreiungsbewegungen, die gegen unpopuläre Militär- und Oligarchieregierungen kämpfen, machen guten Gebrauch von externer Hilfe. Es ist kein Zufall, daß Afghanistan derjenige Fall ist, bei dem die Reagan-Doktrin sehr erfolgreich war, denn hier waren die Rollen der Supermächte vertauscht. Ein weiteres Problem der Reagan-Doktrin ist, daß der Mangel an Legitimität ihrer Nutznießer auch in den Vereinigten Staaten bemerkt wurde. Im Falle der nicaraguanischen Contras war die Regierung gezwungen, zu unorthodoxen Mitteln und zu Rechtsverdrehungen (sogenannte humanitäre Hilfe) zu greifen, um ihre Politik nicht aufzugeben. Aus dieser Perspektive betrachtet hat die Reagan- Administration nichts Neues erfunden, sondern lediglich Praktiken fortgesetzt, die in den Zwängen, die der Ausgang des Vietnamkrieges der amerikanischen Außenpolitik auferlegt hat, ihren Ursprung haben und in der ausdauernden Opposition des Kongresses und der Mehrheit der öffentlichen Meinung gegen jeglichen offenen Einsatz amerikanischer Truppen.
Irangate und die Illusion der Stärke
Trotz der Ergebnisse der Church- und Pike- Untersuchungen Mitte der 70er Jahre war das Bedürfnis nach größerer Flexibilität im Streben nach einer globalen Außenpolitik so groß, daß es die amerikanische Regierung dazu brachte, die Schwelle für versteckte Operationen und verschiedene Formen illegaler Intervention im Ausland herabzusetzen. Bei den Nachwirkungen von Irangate wurde einer ziemlich großen Öffentlichkeit klar, daß diese Formen der Intervention zur Ausweitung des nationalen Sicherheitsapparats geführt haben, der in der Exekutive verankert ist und wichtige Verbündete in privaten Interessengruppen hat; zugleich aber besitzt er zahllose Verzweigungen, die ihn zu einer Art Parallelregierung mit eigenen Prioritäten und Mitteln machen. Präsident Reagan war ein wichtiger Faktor in einer solchen Entwicklung, denn er trug dazu bei mit einer einzigartigen Mischung aus der Bereitschaft, Verantwortung zu delegieren, und persönlicher Rhetorik. Als Reagan die Sowjetunion der „Lüge, des Diebstahls und des Betrugs“ bezichtigte, rechtfertigte er indirekt ähnliche Praktiken innerhalb seiner eigenen Regierung. Das Gewicht, das er auf Anti-Terror-Operationen legte, diente demselben Zweck.
Im ersten Bericht der Trilateralen Kommission schrieb Samuel Huntington, daß der Konflikt zwischen den Grundwerten der amerikanischen Verfassung und der nationalen Sicherheit unversöhnlich geworden sei. Mehr als zehn Jahre später ist dieser Konflikt immer noch vorhanden. Obwohl die illegalen Machenschaften der Regierung zugenommen haben, sind die Wächter der Verfassungstradition noch nicht entwaffnet.
Für Edward Gibbon waren der Untergang des Römischen Imperiums und dessen Unfähigkeit, die eigenen Gesetze zu respektieren, ein und dasselbe. Eine Rückkehr zum Gesetz ist vielleicht noch möglich. Womit es wahrscheinlich für immer vorbei ist, ist die hegemoniale Periode der amerikanischen Außenpolitik. Als Woodrow Wilson diese Rolle zum ersten Mal ins Auge faßte, und sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die Amerikaner sich mit der Weltordnung gleich und gaben und sprachen aus eigener Machtvollkommenheit Recht, indem sie sich zu Konfliktmaklern zwischen anderen Nationen aufschwangen. Die Vereinten Nationen und ihnen angegliederte Organisationen, der Internationale Währungsfond, sogar die regionalen Bündnisse, die nach dem Zerwürfnis mit der Sowjetunion entstanden, waren alle zu einem Großteil Resultat amerikanischer Politik.
In diesen Institutionen kontrollierten die Vereinigten Staaten eine Mehrheit, die amerikanische Interessen in allgemeine Politik umwandeln konnte, indem sie eine Wertigkeit »erga omnes« beanspruchte. Um dem entgegenzuwirken war die Sowjetunion gezwungen, ihre Schwäche bloßzustellen, indem sie auf das Vetorecht zurückgriff. Heute dagegen hat die amerikanische Regierung die UNESCO verlassen und ist bereits zweimal wegen Operationen in Nicaragua vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag verurteilt worden. In der Generalversammlung der Vereinten Nationen sieht sie sich regelmäßig mit gegnerischen Mehrheiten konfrontiert, gegen die die USA nun selbst von ihrem Vetorecht Gebrauch machen muß. Die Vereinigten Staaten haben sogar Probleme, mit ihrem eigenen Bündnissystem fertigzuwerden.
In der gegenwärtigen Phase besteht das Problem der amerikanischen Außenpolitik in ihrer Unfähigkeit, sich der neuen Situation immer noch großer, aber stärker eingeschränkter Macht anzupassen, vielleicht, weil sie sich weigert, sie zu erkennen. Die Sowjetunion verlor ihre hegemonialen Ansprüche in dem Augenblick, als sie sich mit der stalinistischen Formel vom „Sozialismus in einem Land“ zufriedengab, und seit dieser Zeit hat sie ihre Dominanz in verschiedenen Teilen der Welt mit schwankendem Erfolg ausgeübt. Dominanz ist einseitig und erfordert nicht den inneren und äußeren Konsens, auf den Hegemonie Anspruch erhebt. Jedoch ist Dominanz, genau wie Samuel Huntington vorhersah, nur in einem institutionellen Rahmen durchführbar, in dem der nationalen Sicherheit unbestrittene Priorität für das Handeln der Regierung eingeräumt wird; darin liegt ein gravierender Unterschied zu dem Sicherheitssystem, das die Gründerväter vorgesehen hatten. Einige Schritte in diese Richtung gab es seit der Johnson-Administration; die Reagan-Administration allerdings ging weiter als ihre Vorgänger: eine de facto Reduzierung der Wählerzahl, ein außenpolitischer- und Sicherheitsapparat, der unter der theoretischen Kontrolle der Präsidentschaft Amok läuft, Einschränkungen der Befugnisse des Kongresses. Es ist wahrscheinlich, daß diese Tendenz ihren Höhe- und ihren Wendepunkt mit »Irangate« erreichte. Dennoch ist sie stark genug gewesen, um Vorrechte auszuhöhlen, die fest in der amerikanischen Verfassung verankert sind.
Die öffentliche Meinung in Amerika ist bereit, einseitige Aktionen in anderen Ländern ohne allzu große Sorgen um die Zustimmung der jeweils betroffenen Bevölkerung zu akzeptieren, doch sie ist nicht bereit, auf ihr Recht zu verzichten, durch den Kongress oder anderweitig alle Schritte zu kontrollieren oder abzulehnen, die von der Exekutive unternommen werden sollen. Diese Einschränkung hat sich, bis jetzt zumindest, als unüberwindliches Hindernis für eine amerikanische Außenpolitik erwiesen, die auf einseitigen Aktionen ohne die Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung basiert.
Innerhalb dieser Beschränkungen war die Reagan-Administration unfähig, eine schlüssige Außenpolitik zu formulieren, deren Rhetorik sie stattdessen mit einer Reihe gezielter Aktionen durchsetzte. Es wäre jedoch ein Fehler, diese Politik ausschließlich mit der Präsidentschaft Reagans in Verbindung zu bringen. Die meisten Beobachter sind sich einig, daß die jüngste Periode der Konfrontation in der zweiten Hälfte der Carter-Administration als das Resultat einer Reihe von Rückschlägen begann, die die Zeit nach dem Vietnamkrieg kennzeichneten. Rückschläge in der Dritten Welt ebenso wie sowjetische Initiativen (SS-20, Afghanistan, Polen) halfen, die amerikanische Aggressivität wiederzubeleben und verliehen der sowjetischen Bedrohung eine erneute, wenn auch vorübergehende Glaubwürdigkeit. Der »Verlust« des Iran mit der Gefangennahme der amerikanischen Geiseln in Teheran bildete die passende Kulisse für eine Konfrontationspolitik von seiten der nachfolgenden Administration, die sich, in den Augen ihrer militanten Anhänger, vom Erbe der Nixon-Kissinger-Ära befreien mußte. Was die Breschnew-Doktrin nicht lieferte, dafür hatte eine neue und aggressivere Rhetorik zu sorgen. „Das Reich des Bösen“ und weiter ähnliche Begriffe sollten eine bipolare Politik stützen, die in einer fortdauernden Atmosphäre des Dialogs mit der Sowjetunion nicht aufrechtzuerhalten war. Im Theoretisieren über internationalen Terrorismus wurde jeder terroristische Akt mit den Aktionen nationaler Befreiungsbewegungen in einen Topf geworfen, die den imperialen Interessen Amerikas entgegenstanden und angeblich von der Sowjetunion gelenkt wurden.
Trotz ihrer Absurdität erfüllte solch eine Theorie auch diesmal ihren Zweck der bipolaren Deutung der Welt, die stark an die in den 50er Jahren so populäre Rhetorik vom „internationalen Kommunismus“ erinnerte. Die Funktion solcher Vereinfachungen, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart, ist die Rechtfertigung der Interventionspolitik gegen einen einheitlichen Feind. Wird dieser quasi prototypische Feind schwächer, reizt dies zu noch schärferer Rhetorik und gewagteren Theorien.
Die Konfliktkonstellation Naher Osten
An dieser Stelle muß angemerkt werden, daß sich die vorherrschende Politik mehr und mehr auf die Dritte Welt und insbesondere auf den Nahen Osten ausgerichtet hat. Das intellektuelle Klima dieser Radikalisierung, die sich primär gegen die Länder der Dritten Welt richtet, ist Ergebnis einer politischen Umorientierung in den Vereinigten Staaten was die Außenpolitik betrifft. Einige besonders einflußreiche Teile der öffentlichen Meinung, die mit Israel sympathisierenden journalistischen und akademischen Kreisen nahestehen, haben ihre traditionell gemäßigte Sichtweise des Ost- Westverhältnisses aufgegeben. Wahrscheinlich als Folge des wachsenden arabischen Einflusses in den Vereinigten Staaten, haben die jüdische Gemeinde und ihre intellektuellen Verbündeten die Überzeugung gewonnen, daß die amerikanische Solidarität mit (oder vielmehr Unterwürfigkeit gegenüber) der israelischen Regierung isoliert von anderen Fragen nicht länger gesichert war. Die Kontinuität der pro-israelischen Politik machte eine generelle Radikalisierung der amerikanischen Außenpolitik erforderlich. Im Falle eines angespannteren Klimas sind die Vereinigten Staaten auf Israel als einen verläßlichen Vorposten westlicher Interessen in einem sowohl unruhigen als auch äußerst wichtigen Teil der Dritten Welt angewiesen, auf der Basis dessen, was Alexander Haig den strategischen Konsens zwischen zwei Regierungen genannt hat.
Diese Entwicklung hat die Washingtoner Regierung weiter in die Verwicklungen im Nahen Osten hineingezogen, doch sie hat sie zugleich unfähiger gemacht, eine schlüssige Politik für die Region als Ganzes zu formulieren. Darüber hinaus hat das amerikanische Unvermögen, militärische Operationen zu unternehmen, wo Leben von Amerikanern auf dem Spiel stehen, der Reagan-Administration ernsthafte Schwierigkeiten bereitet. Die Intervention im Libanon endete kläglich, als die Marinetruppen gezwungen waren, sich nach einem erfolgreichen Angriff shiitischer Terroristen zurückzuziehen. Die derzeitigen Flottenmanöver im Persischen Golf sind mit ähnlichen Risiken verbunden. Das wichtigste Ergebnis auf Seiten Washingtons war im übrigen in beiden Fällen, daß sie die Politik der EG gegenüber dem Nahen Osten zunichte machte, indem sie drei der europäischen Regierungen in von den Vereinigten Staaten angeführte Aktionen hineinzog, die von den meisten arabischen Staaten als feindselig angesehen wurden.
Ansonsten zeigen die militärischen Aktivitäten Amerikas im Nahen Osten – vor allem gegen Libyen – eine für die Zeit nach Vietnam typische (aber in der traditionellen amerikanischen Kriegsführung verwurzelte) Tendenz, auf ständige militärische Präsenz zugunsten exzessiven und einseitigen Gebrauchs von Militärtechnologie zu verzichten. Die Bombardierung von Tripolis, der, wie in der Folge durch Regierungsquellen aufgedeckt wurde, die Manipulation von Informationen vorausging, hatten anderen Effekt als Oberst Ghaddafis Position im eigenen Land zu stärken, traditionelle Verbündete Amerikas im Mittelmeerraum in Verlegenheit zu Bringen und erneut auf dramatische Weise das Fehlen einer schlüssigen und umfassenden Politik zu offenbaren. Die Illusion der Stärke, angestrebt aus innenpolitischen Gründen, wurde eindeutig auf Kosten der längerfristigen amerikanischen Interessen in der Region erkauft.
Zusammengefaßt: das Auf und Ab während der Präsidentschaft Reagans hat auf dramatische Weise etwas offenbart, was in den letzten Jahren latent vorhanden gewesen war. Nicht nur gehört die amerikanische Hegemonie der Vergangenheit an, die Bewohner des Weißen Hauses finden es auch zunehmend schwerer, einen Übergangskurs zu steuern, der sich mit den widersprüchlichen Stimmungen der öffentlichen Meinung in Amerika vereinbaren läßt.
Wechselwirkung von Innen- und Außenpolitik in Ost und West
Die innenpolitische Krise ist in starkem Maße beeinflußt, wenn nicht verursacht, durch eine übermäßig ausgeweitete Außenpolitik, die zu einer übertriebenen Ausdehnung der Rolle der Exekutive führte. Watergate und Irangate sind ernstzunehmende Symptome, aber das allmähliche Schrumpfen der Wählerzahlen und der sowohl politische als auch sozioökonomische Ausschluß eines wesentlichen Teils der Bevölkerung (die „zwei Amerika“, von denen Mario Cuomo 1984 auf dem Parteitag der Demokraten sprach) deuten auf eine Situation, in der das eigentliche Prinzip der demokratischen Regierungsform bereits in bedenklicher Weise untergraben ist. Politische und kulturelle Stimmungen haben gravierende Folgen. In den 60er Jahren zeigte die Linke überall im Westen vorzeitig das Ende der Demokratie an. Wo ist sie jetzt, da die Krankheit bei weitem akuter ist?
Viele Beobachter stimmen überein, daß diese Probleme nicht ohne strukturelle Veränderungen gelöst werden können, die die öffentlichen und die Zahlungsbilanzdefizite betreffen. Reagan packte dieses Problem nicht richtig an, als er die Sozialausgaben kürzte, und auch eine veränderte Besteuerung könnte es nicht lösen, selbst wenn die gewählten Funktionäre in Zukunft gewillt wären, Steuern zu erhöhen. Die Defizite haben in den Militärausgaben ihren Ursprung, und diese können ohne eine grundlegende Veränderung der Außenpolitik nicht reduziert werden.
Ich habe bereits versucht deutlich zu machen, wie tief Innenpolitik und Interessenkoalitionen im Osten wie im Westen durch die bipolare Politik beeinflußt worden sind. Daher können weder in den Vereinigten Staaten noch in der Sowjetunion die Bedingungen im Inneren ernsthaft verändert werden ohne einen tiefgreifenden Wandel in der Außenpolitik. Aus diesem Grund ergeben sich aus dem gleichzeitigen Verfall beider Supermächte großartige Möglichkeiten, aber auch ernstzunehmende Gefahren. Das internationale politische System steht auf dem Spiel, und eine klare Richtung für den Übergang zu einem wie auch immer gearteten neuen System ist nicht in Sicht.
In dieser Phase hat die gegenseitige Abhängigkeit der Supermächte die Probleme, mit denen jede von ihnen konfrontiert war, radikalisiert. Aus der Sicht der Vereinigten Staaten war der Dialog zwischen Nixon und Breschnew ein überlebenswichtiger Faktor in der qualvollen Zeit nach Vietnam und Watergate. Grundsätzlicher noch hat die fortdauernde Existenz eines einigen und potentiell bedrohlichen Sowjetblocks die führende Rolle Amerikas im Westen gerechtfertigt und gestärkt. Daher ist – für jeden offensichtlich außer für NATO-Propagandisten – der Verfall der relativen Macht Amerikas gebunden an die Brüchigkeit der sowjetischen Vormachtstellung im Ostblock.
Vor allem die ideologische Glaubwürdigkeit der Sowjetunion hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kontinuierlich abgenommen. Die für die sowjetische Gesellschaft typische Verbindung von wirtschaftlicher Ineffizienz und Mangel an demokratischen Freiheiten wirkte auf niemanden inspirierend, es sei den auf unverbesserliche Stalinisten in den westlichen Ländern und wurde in der Dritten Welt höchstens als notwendiges Übel betrachtet. Es gab nie Anzeichen einer wirklichen Einheit des Ostblocks, der vor dem Auseinanderfallen allein dadurch bewahrt blieb, daß die Sowjets fähig waren, das notwendige Maß an militärischer Repression anzuwenden. Der Ausgang der polnischen Krise hat bewiesen, daß auch diese Fähigkeit der Sowjets nicht mehr als selbstverständlich gelten kann. Da das, was E.P. Thompson die Verdauungsprobleme der Sowjets genannt hat, so offensichtlich ist, hat die militärische Bedrohung Westeuropas (von dauerhafter Wichtigkeit für den Bestand der NATO) mehr und mehr an Glaubwürdigkeit verloren. Selbst NATO-Hardliner gestehen privat ein, daß das klassische Szenario von der Invasion Westeuropas durch die Rote Armee unwahrscheinlich ist, wenn diese die größten Schwierigkeiten hat, das festzuhalten, was sie bereits besitzt. Die ganze Theorie von der »Finnlandisierung« ist nur erfunden worden, um diesem Einwand zu begegnen. Die Sowjetunion, mit wackliger Ökonomie aber militärischer Überlegenheit, würde von den fetten aber selbstzufriedenen Westeuropäern Zugeständnisse in Sachen politischer Souveränität erpressen, falls die NATO ihren nuklaren und konventionellen Schutzschirm aufgäbe. So läuft die Argumentation, die nicht nur George Kennans schlichten Einwand ignoriert – es gibt keinen Grund, einer Drohung nachzugeben, die nicht umgesetzt werden kann –, sondern auch die Tatsache, daß ihre wirtschaftliche Schwäche die Sowjetunion weit eher zu Reformen und stärkerer ökonomischer Bindung an den Westen drängen wird, als zur Verletzung europäischer Souveränität.
Es ist vor allem der wirtschaftliche Aspekt der Krise, der Gorbatschows Reformbewegung wesentlich von dem unterscheidet, was Chruschtschow in den 50er Jahren versucht hat. Gorbatschow mußte die sowjetische Außenpolitik ändern und Zugeständnisse machen, um einen Prozeß der Abrüstung in Gang zu bringen, der es ihm ermöglichte, Mittel aus dem militärischen Bereich auf andere umzuverteilen. Die Behauptung Konservativer, Gorbatschow sei zu dieser Politik durch die Steigerung der amerikanischen Rüstungsausgaben gezwungen worden, ist eine grobe Vereinfachung, wenn auch mit einer Spur von Wahrheit. Sie ist eine grobe Vereinfachung, weil die Änderung einer Politik eine Koalition von Interessen und Macht erfordert, die nicht über Nacht improvisiert werden kann.
Die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, sind begrenzt, aber nach dem, was wir wissen und was wir vermuten können, wird Gorbatschow von den dynamischen, stärker nach außen orientierten Teilen der Bürokratie und des KGB unterstützt. Gleichzeitig ist es nicht unwahrscheinlich, daß der bipolare Status Quo gerade durch die Aggressivität und den militärischen Eifer der Reagan-Administration ins Wanken gebracht wurde, denn durch sie wurde sowohl der Rüstungswettlauf als auch die Spannung zwischen den gegnerischen Lagern bis auf einen Punkt getrieben, an dem sie zur Stärkung der Position der Erneuerer innerhalb des sowjetischen Systems beitrugen. Mit den Vorteilen der UdSSR, die mit der Krise nach Vietnam zusammenhingen, war es vorbei. Die Reagan-Administration wollte nicht einfach zum traditionellen Gleichgewicht des bipolaren Systems zurückkehren, das für die Ära Breschnew typisch gewesen war. Daher gab es für die UdSSR nur zwei Möglichkeiten: entweder Washington in einem immer kostspieligeren Wettrüsten zu folgen, das durch sich stetig steigernde Spannungen getragen wurde, oder eine neue Politik zu versuchen. Diese zweite Reaktionsmöglichkeit sah sich wahrscheinlich dadurch ermutigt, daß es eine westeuropäische Friedensbewegung gab, die zwar nicht stark genug gewesen war, die Aufstellung von Cruise Missiles und Pershing II zu stoppen, aber doch fähig, einer weniger unbeweglichen sowjetischen Politik Ansporn und Unterstützung zu geben. Dies trifft besonders zu, falls es die Absicht Gorbatschows und der sowjetischen Reformer ist, über das bipolare System hinauszugehen und sich in Richtung eines Plurizentralismus zu bewegen. In diesem Fall wäre eine größere Unabhängigkeit Westeuropas von den Vereinigten Staaten, aber auch ein potentiell selbständigeres Osteuropa eher eine notwendige Bedingung als eine Gefahr.
Die »occasio«
Damit jedoch die Strategie Gorbatschows auch nur anfangen konnte, erfolgreich zu sein, mußten die sowjetischen Zugeständnisse anerkannt und durch eine ähnliche Bereitschaft Washingtons beantwortet werden, in eine Phase der Verhandlungen einzutreten. Hier, an diesem Punkt bot sich das, was der große schwedische Staatsmann des 17. Jhs. Axel Oxenstierna als den wichtigsten Faktor einer jeden Politik betrachtete: die „occasio“, die historische Gelegenheit. Die Präsidentschaft Reagans brauchte eine dramatische Wende in ihrer Politik, um sich vor dem Zusammenbruch ihrer Außenpolitik zu retten, vor einer Ökonomie im Aufruhr und ihrem sinkenden Erfolg bei Wahlen. Die Tatsache, daß die Reagan-Administration nicht durch die konventionelle bipolare Orthodoxie gebunden war, sondern inspiriert durch eine radikalere und aufrichtigere Form des Antikommunismus, erwies sich paradoxerweise als ein befreiender Faktor.
Es wäre ein Fehler, „occasio“ mit reinem Opportunismus zu verwechseln. Ronald Reagans Reaktion läßt sich nicht einfach durch seinen Wunsch (oder den seiner Frau) erklären, seine Amtszeit in einer würdigeren Weise zu beschließen, obwohl dies eine wichtige persönliche Motivation gewesen sein mag. Der entscheidende Punkt aber ist, daß die Krisen, mit denen die beiden führenden Mächte sich konfrontiert sahen, parallel verliefen und in dramatischer Weise einen Verfall ihrer relativen Macht bewirkten, der mit ihrer jeweils dominierenden Rolle im internationalen System unvereinbar war. Insbesondere haben beide auf die Notwendigkeit reagiert, in den Militärbereich investierte Mittel umzuverteilen. Die Dringlichkeit und die Art dieser Veränderungen mögen unterschiedlich sein, ihre Gründe sind ähnlich: die übermäßige Belastung der heimischen Ökonomie durch die Außenpolitik. Bedeutet das, daß die Entwicklung unumkehrbar ist? Daß wir in eine Phase eintreten, in der ein militärisches Gleichgewicht auf stetig sinkendem Niveau angestrebt wird? Wo Entspannung eine wirklich neue Qualität erhalten und schließlich die Supermächte demokratisieren und ihre Satellitenstaaten befreien wird?
Diese Fragen sollten, aus vielerlei Gründen, vorsichtig beantwortet werden. Zunächst einmal sind Abrüstung und Entspannung an sich nicht unvereinbar mit dem bipolaren Verhältnis und daher per definitionem umkehrbar, wann immer Spannungen im Interesse der Hauptakteure liegen.
Ein bedeutsamer Aspekt anderer Episoden oder Phasen der Entspannung ist die Stärkung der Kontrolle der Supermächte über die kleineren Verbündeten gewesen. Werden die Reformen Gorbatschows die Beziehungen innerhalb des Warschauer Pakts einschließen und, wichtiger noch, werden sie die entscheidende Bewährungsprobe einer Umwälzung in einem osteuropäischen Land bestehen, oder wird Gorbatschow gezwungen sein zu reagieren wie Chruschtschow in Ungarn? Werden auf der anderen Seite die westeuropäischen Länder größere Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen und sich die Fähigkeit erwerben, eine unabhängige Politik für die übrige Welt zu formulieren?
Zum dritten ist es überaus wichtig, daß sich die Veränderungen in der Außenpolitik bis zu einem Punkt entwickeln, an dem sie sich auf die inneren Reformen der Supermächte auswirken können. Solange die totalitären Strukturen des gesellschaftlichen und politischen Systems der Sowjetunion nicht ernsthaft berührt werden, bleiben die außenpolitischen Entwicklungen gefährdet und folglich umkehrbar. Unter diesem Gesichtspunkt ist die größere Freiheit der kulturellen Diskussion in der Sowjetunion mindestens ebenso bedeutsam für den Frieden, wie die Verschrottung hunderter von Atomraketen. Es ist wichtig, zwischen dem zu unterscheiden, was von »oben« kommt und dem, was sich von »unten« her entwickelt und von der institutionalisierten Obrigkeit toleriert wird. Daß es überhaupt Konflikte gibt, ist bezeichnender als jeder Konsens, wie ansprechend dieser seinem politischen Gehalt nach auch sein mag. Was am Ende der gegenwärtigen Entwicklung der Ereignisse stehen wird, ist unsicher. Es gibt jedoch keinen Zweifel daran, daß sich auf das bipolare System nichts destabilisierender auswirken würde als weitere Fortschritte auf dem Weg zur Demokratie.
Natürlich ist die Situation in den Vereinigten Staaten anders. Doch auch hier ist es nicht nur notwendig, daß sich ein Großteil der öffentlichen Meinung auf eine weniger kriegslüsterne Stimmung einstellt; es ist weitaus wichtiger, daß diejenigen, die aus dem politischen System ausgeschlossen sind, ihre Ansichten und Interessen zum Tragen bringen. So gesehen war die Kandidatur Jacksons eine bedeutsame politische Entwicklung, obwohl die Kampagne zur Präsidentschaftswahl selbst – und vor allem die Unfähigkeit der Demokraten, eine alternative Außenpolitik zu formulieren – anzeigte, daß noch ein weiter Weg zurückzulegen ist.
Die Art dieser Bewährungsproben, die schlichte Tatsache, daß sie überhaupt realistischerweise definiert werden können, verdeutlicht, was auf dem Spiel steht. Die jüngsten Entwicklungen sind nicht nur wichtig, weil sie auf ein Ende des Rüstungswettlaufs hindeuten, der nicht mehr rückgängig zu machen schien. Der Dialog zwischen Reagan und Gorbatschow ist hervorgegangen aus dem Verfall der Supermächte und der Krise des bipolaren Systems.Wie wir gesehen haben, hat dieses System nicht nur die Außenpolitik beherrscht, sondern sich auch auf die inneren Machtverhältnisse aller Länder ausgewirkt. Es gibt herrschende Klassen mit Macht und Einfluß, politische Eliten, militärische und zivile Bürokratien, die in den Vereinigten Staaten wie in der Sowjetunion an der bipolaren Politik ein Interesse haben. Regierungen in Randzonen verdanken ihre örtliche Macht ihrem untergeordneten Verhältnis gegenüber den Supermächten. Die Krise des bipolaren Systems verlangt daher nicht nur einen Wandel in der Außenpolitik, sondern sie bedeutet auch soziale und politische Instabilität in vielen Teilen der Welt. All dies ist schwierig, sogar gefährlich, doch wäre es das nicht, so wäre die Entspannung, von der wir sprechen, keine neuartige und die Aussicht auf Frieden so ungewiß wie eh und je.
Gian Giacomo Migone ist Chefredakteur der italienischen Zeitschrift L'Indice und zus. mit Pierre Bourdieu u.a. Herausgeber der europäischen Literaturzeitschrift Liber.