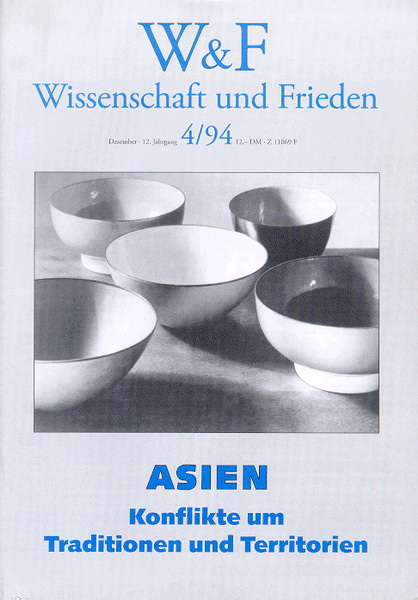Deutsche Soldaten in alle Welt?
Zur Problematik einer militärischen Instrumentierung der deutschen Außenpolitik
von Rudolf Hamann • Volker Matthies • Wolfgang R.Vogt
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Juli 1994 zum Streitkräfteeinsatz markiert eine historische Zäsur der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Nach dem Spruch der obersten Richterinnen und Richter in Karlsruhe ist das Spektrum für weltweite Einsätze der Bundeswehr geöffnet worden.
Die juristische Diskussion ist mit dem höchstrichterlichen Urteil weitgehend abgeschlossen, aber die eigentliche politische und gesellschaftliche Debatte über mögliche Auslandseinsätze der Bundeswehr steht noch aus. Regierung und Parlament haben bislang vor allem darauf gedrängt, den verfassungsrechtlichen Aspekt derartiger Einsätze zu klären. Sie haben es aber versäumt, die außenpolitischen Ziele und Interessen Deutschlands zu präzisieren und daraus ableitend die militärischen Anteile einer am Frieden orientierten Politik zu definieren. Die Leerformel von der »größeren weltpolitischen Verantwortung« des wiedervereinigten Deutschlands erschöpft sich bisher vor allem in der Fixierung auf die militärische Option und den Anspruch auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
»Größere weltpolitische Verantwortung« durch militärische Einsätze?
Da der Auftrag der Bundeswehr nach dem Wegfall der Bedrohung durch den Warschauer Pakt nicht im Rahmen einer diese historisch einmalige Situation hinreichend reflektierenden Außen- und Sicherheitspolitik formuliert wurde, verlagerte sich diese Aufgabendiskussion zunehmend in die Bundeswehr selbst. Die Diskussion bezieht sich dabei auf den strukturellen Umbau der Bundeswehr von einer reinen Verteidigungsarmee zu einer in Teilen prinzipiell weltweit einsatzfähigen Interventionsstreitkraft und dem damit eng verbundenen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel von einer klar definierbaren raumzeitlichen Bedrohungssituation hin zu einer vagen, diffusen und allgegenwärtigen weltweiten Risikolage.
Dieser Paradigmenwechsel kontrastiert auf merkwürdige Weise mit dem enormen Zugewinn an Sicherheit für Deutschland und Westeuropa nach der Auflösung des Ost-West-Konfliktes und der auch mehrfach wiederholten offiziellen Aussage, daß Deutschland „von Freunden umzingelt“ (Bundeskanzler Kohl) und deshalb keine unmittelbare militärische Bedrohung mehr gegeben sei und die meisten »Risiken« nicht-militärischer Natur seien. Anstatt eine aus der Logik der internationalen Beziehungen seit 1989 sich ergebende Entmilitarisierung der Sicherheitspolitik zu betreiben und Zivilisierungsfortschritte in den internationalen Beziehungen zu erzielen, lassen sich falsche Weichenstellungen und Prioritäten für die Zukunft der Sicherheitspolitik und der Streitkräfte feststellen. Problematisch ist vor allem,
- daß die bisherige Debatte außerhalb und innerhalb der Bundeswehr viel zu verkürzt auf die Rolle von Streitkräften und militärischer Machtausübung fixiert ist, als wenn sich hierin die Neubestimmung deutscher Sicherheitspolitik und größerer weltpolitischer Verantwortung erschöpfte. Hauptverantwortlich für die Verkürzung der Diskussion sind große Teile der Parteien, des Parlaments und der Medien, die sich aus dieser Diskussion weitgehend ausgeblendet haben;
- daß die Zukunft der Sicherheitspolitik und Streitkräfte im Hinblick auf Aufgaben und Legitimation, Umfang und Struktur wesentlich von der militärischen Führung des Verteidigungsministeriums selbst definiert und eine eigentlich genuin politische Diskussion durch militärisches Denken übersteuert worden ist.
Gerade weil Organisationen dazu neigen, sich nach Fortfall der Aufgaben, auf die hin sie strukturiert wurden, neue zu suchen, hätte zum Beispiel das Auswärtige Amt die nicht-militärischen Anteile friedenssichernder Politik frühzeitig und eindeutig bestimmen müssen. Da das Auswärtige Amt es aber insgesamt versäumt hat, ein außen- und sicherheitspolitisches Gesamtkonzept vorzulegen, das den grundlegend gewandelten Verhältnissen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes gerecht wird, hat das Verteidigungsministerium – und vor allem die militärische Führung – dieses Vakuum genutzt und es im Sinn militärischer Interessenwahrung und Selbstlegitimation ausgefüllt;
- daß in den einschlägigen offiziellen sicherheitspolitischen Dokumenten und in Teilen der Debatte nationalkonservative Zungenschläge anklingen und Retraditionalisierungstendenzen aufscheinen. Dies zeigt sich unter anderem in der Betonung »nationaler Interessen« Deutschlands, in der Definition Deutschlands als einer »Mittelmacht mit weltweiten Interessen«, in der Forderung nach Rückkehr zu nationalstaatlicher »Normalität« (was immer das heißen mag) sowie in der starken Betonung des Militärs als Faktor und Instrument deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Bedenklich stimmt in diesem Zusammenhang auch, daß von konservativer Seite neuerdings versucht wird, einen Einsatz der Streitkräfte auch im Inneren zu propagieren. Dies ist eine unzulässige Vermischung der Aufgaben von Polizei und Militär sowie von innerer und äußerer Sicherheit. Es spricht alles dagegen, in dieser Frage eine Erosion des Grundgesetzes zuzulassen.
Auch in der Truppe gibt es deutliche Retraditionalisierungstendenzen, die auf eine Intensivierung der militärfachlichen Anteile in der Ausbildung zu Lasten der Politischen Bildung und der Inneren Führung drängen und für eine Wiederbelebung klassischer soldatischer Tugenden plädieren. Gerade das vereinte Deutschland hat jedoch allen Grund, auf dem Hintergrund seiner unseligen Militär- und Kriegsgeschichte eine Kultur äußerster Zurückhaltung beim Umgang mit dem militärischen Gewaltinstrument zu pflegen und keine mißverständlichen und irritierenden Signale auszusenden;
- daß die neuen sicherheitspolitischen Formeln und Aufgabenstellungen für Streitkräfte, wie sie zuletzt im neuen Weißbuch dargelegt wurden, analytisch zu kurz greifen, zu vage und diffus sind, zu wenig plausibel und legitimatorisch überzogen.
Sie sind in wesentlichen Teilen abgeleitet aus den Überlegungen in der NATO selber, die ebenfalls auf der Suche nach einer neuen, alle Mitglieder verbindenden Aufgabe ist, wobei die Scheinalternative »out of area or out of business« darüber hinwegtäuscht, daß für Einsätze außerhalb des Bündnisses derzeit weder die strukturellen noch die materiellen Voraussetzungen vorliegen.
Darüber hinaus ist die Diskussion selbst zutiefst widersprüchlich:
- Zwar wird in deklamatorischen Reden führender Politiker und Militärs immer wieder die überragende Bedeutung präventiver, nicht-militärischer Konflikt- und Krisenbearbeitung herausgestellt, tatsächlich aber zu deren Lasten nach wie vor ein kosten- und ressourcenaufwendiger Aus- und Umbau des militärischen Instruments betrieben.
- Zwar operiert auch das Militär neuerdings zu Recht mit einem erweiterten Begriff von Sicherheit, de facto werden aber auch nicht-militärische Friedensgefährdungen (z.B. Rohstoffversorgung, Migration) unter der verkürzten Perspektive militärischer Konfliktbearbeitung diskutiert.
- Zwar heben sowohl die offiziellen sicherheitspolitischen Stellungnahmen als auch Äußerungen von Spitzenmilitärs nachdrücklich hervor, daß den nicht-militärischen Risiken wie maroden Kernkraftwerken, fortschreitender Umweltzerstörung und wirtschaftlicher Unterentwicklung, die unsere Sicherheit bedrohen, nicht angemessen militärisch begegnet werden kann, aber dennoch dient der erweiterte Sicherheitsbegriff merkwürdigerweise dazu, eine »neue Unübersichtlichkeit« der Risikolage zu konstatieren, die auch des Zugriffs durch militärisches Krisenmanagement bedürfe. Die militärische Führung beansprucht offensichtlich eine umfassende Kompetenz für Sicherheitsfragen jedweder Art und monopolisiert auf diese Weise die Sicherheitsvorsorge.
- Zwar besteht weitreichender Konsens darüber, daß uns nicht mehr in erster Linie feindliche Panzerarmeen, Raketen oder kriegslüsterne Diktatoren bedrohen, aber gleichzeitig richtet man sich vor dem Hintergrund einer alarmistisch aufgebauten Drohkulisse auf klassische militärische Gewaltanwendung ein. An die Stelle der ehemaligen Ost-West-Bedrohung wurde ein diffuses Risikoszenario gesetzt, das letztlich dem tiefverwurzelten und nicht aufgearbeiteten Feindbilddenken entspricht. In diesem Kontext macht die alarmistische Akzentuierung einer »neuen Gefahr aus dem Osten« (etwa in Gestalt eines großrussischen Chauvinismus oder chronisch unberechenbarer Instabilität) oder einer »neuen Gefahr aus dem Süden« (in Gestalt von Proliferationsproblemen, aufstrebender aggressiver Regionalmächte, des Islamismus, eines »Krisenbogens« von Marokko bis Indonesien) wenig Sinn, weil man auf diese Weise leicht in eine »Realismusfalle« (Czempiel) dergestalt geraten kann, daß militärisch gestützte Sicherheitspolitik durch ihr Denken und Handeln genau diejenigen Zustände mit herbeiführen hilft, mit denen sie dann ihre Legitimation begründet.
- Zwar wird die Landesverteidigung als Hauptaufgabe des Militärs betont, aber die Legitimitätsbeschaffung vollzieht sich zur Zeit primär über eher periphere Aspekte wie humanitäre Hilfe, Umweltschutz und UNO-Einsätze. Durch eine bewußt betriebene Funktionsausweitung auf die Wahrnehmung nicht-militärischer Aufgabenfelder wird den Streitkräften eine Multifunktionalität zugeschrieben, die sie in der Öffentlichkeit zur eigenen Imagebildung geschickt vermarktet.
Schließlich ist auffällig, daß die Umrüstungen der NATO und der Bundeswehr auf weltweit einsetzbare Interventionskräfte in einem krassen Gegensatz zu dem erreichten Konsens und den Verpflichtungen (z.B. in der KSE-Vereinbarung von Wien) stehen, die eine strikte »strukturelle Nichtangriffsfähigkeit« für die zukünftigen Streitkräfte in Europa verbindlich vorschreiben.
Wachsende Dysfunktionalität von militärischer Gewalt
Am Beispiel von UNO-Operationen mit dem Versuch, durch militärische Gewaltanwendung in Bürgerkriegssituationen friedensstiftend tätig zu werden, zeigt sich die Bedeutungsminderung und tendenzielle Dysfunktionalität von militärischer Gewalt.
Die Fixierung auf militärische Großkonflikte in fernen Ländern nach dem Muster des zweiten Golfkrieges ist eine Festlegung auf eher untypische, singuläre, zwischenstaatliche Konfliktlagen mit regulärer Kriegsführung und Orientierung an einem klassischen Kriegsbild, das in den meisten Konflikten der Gegenwart und Zukunft, den innerstaatlichen Auseinandersetzungen und Bürgerkriegen, nicht anzutreffen ist. In innerstaatlichen Konfliktlagen aber vermögen klassisches Militär und auch sogenannte »robuste« Blauhelme durch Intervention von außen aus strukturellen Gründen (soziale Desintegration, Fragmentierung politischer Kräfte, unklare Fronten und schwer identifizierbare Aggressoren) keine wesentliche friedenserzwingende und schon gar keine friedensstiftende Rolle zu spielen (z.B. Somalia oder Bosnien-Herzegowina). Wie die Bilanz vergangener und gegenwärtiger UNO-Blauhelmeinsätze zeigt, agiert die UNO dort relativ erfolgreich, wo ihr die Kooperation der Konfliktparteien entgegenkommt, sie flankierend und abstützend bei der friedlichen Transformation der Konflikte behilflich ist, sie weitgehend auf Erzwingungselemente verzichtet und statt dessen vor allem Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung betreibt. Dies aber erfordert Verbände, die nicht primär auf Kampf und Sieg ausgelegt, sondern eher auf zivile Aktionen und diplomatisch-politische Verhaltensweisen hin orientiert sind.
Angesichts der offenkundig begrenzten Möglichkeiten des Militärs bei der Lösung der zukünftig wahrscheinlichsten Konflikte und Kriege wirkt der derzeitige Umfang der Bundeswehr überdimensioniert und nicht plausibel begründet. In den am 26. November 1992 vom Bundesverteidigungsminister erlassenen »Verteidigungspolitischen Richtlinien«, der verbindlichen Planungsgrundlage für die Entwicklung der Streitkräfte, wird der Auftrag der Bundeswehr in fünf Strichaufzählungen wie folgt definiert. „Die Bundeswehr
- schützt Deutschland und seine Staatsbürger gegen politische Erpressung und äußere Gefahr,
- fördert die militärische Stabilität und die Integration Europas,
- verteidigt Deutschland und seine Verbündeten,
- dient dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen,
- hilft bei Katastrophen, rettet aus Notlagen und unterstützt humanitäre Aktionen.“
Sieht man einmal davon ab, daß die Förderung der europäischen Integration und der Dienst am Weltfrieden keine originären Aufgaben von Streitkräften sind und die Katastrophenhilfe nur eine subsidiäre Funktion darstellt, dann bleibt als gleichsam klassische Kernfunktion die Verteidigung Deutschlands und seiner Bündnispartner im Rahmen der NATO und WEU. Neu hinzugekommen ist die Beteiligung an UNO-Einsätzen. Entsprechend den Vorgaben der NATO setzt sich die Bundeswehr zusammen aus den Hauptverteidigungskräften für die Landesverteidigung und Krisenreaktionskräften, die sowohl für die Landesverteidigung als auch in NATO und WEU zur Krisenbewältigung und Konfliktverhinderung sowie zur Verteidigung und im Rahmen der UNO oder KSZE eingesetzt werden können.
Da Aufgabe und Fähigkeit, Deutschland gegen einen militärischen Angriff von außen zu verteidigen, aber nicht aus einer konkreten Bedrohung herzuleiten sind und außerdem nur als Beitrag im Rahmen des derzeitigen Systems kollektiver Verteidigung (NATO) wirksam werden, sind dafür auch Kräfte weit unterhalb des derzeitigen Soll-Umfanges von maximal 370.000 Mann (faktisch derzeit 340.000) ausreichend.
Die 50.000 Mann umfassenden Krisenreaktionskräfte sollen für ein breites Spektrum von Einsätzen, von humanitären Maßnahmen bis hin zu Kampfeinsätzen, zur Verfügung stehen. Aus diesem Reservoir sollen auch Truppen für Peace-keeping-Einsätze im Rahmen der UNO rekrutiert werden. Obwohl diese Truppen anders ausgerüstet, ausgebildet und geführt werden müssen als typische Kampfverbände, wird weder eine Unterscheidung zwischen klassischen Blauhelm-Einsätzen und Kampfeinsätzen getroffen noch ist das Ausmaß der Beteiligung hinreichend geklärt.
Aber selbst wenn man die Beteiligung an UNO-Einsätzen als eine notwendige Funktion von Streitkräften akzeptiert, müßten zunächst einmal, und das ist wiederum primär eine politische Aufgabe, die Kriterien eines möglichen Einsatzes präzisiert werden.
Dazu gehört unter den derzeitigen und absehbaren Rahmenbedingungen die Klärung einiger fundamentaler Fragen wie:
- Stehen zentrale humanitäre bzw. internationale Rechtsgüter auf dem Spiel? (Legitimitätskriterium)
- Basiert der Einsatz auf einer unumstrittenen völkerrechtlichen Grundlage? (Legalitätskriterium)
- Rechtfertigt sich der Einsatz, weil die eigene Sicherheit gefährdet ist? (Sicherheitsbedrohung)
- Ist der Einsatz ethisch-moralisch vertretbar? (Moralkriterium)
- Gibt es einen gesellschaftlichen Konsens für den Einsatz? (Akzeptanzkriterium)
- Ist ein Einsatz im Rahmen des Bündnisses konsensfähig? (Bündniskonsens)
- Gibt es glaubhafte und klare politische Zielsetzungen? (Zielklarheit)
- Lassen sich die politischen Ziele mit den einzusetzenden militärischen Mitteln realisieren? (Ziel-Mittel-Relation)
- Sind die erforderlichen Mittel überhaupt vorhanden? (Ressourcenverfügbarkeit)
- Lassen die spezifischen Bedingungen des Krisengebietes/Kriegsschauplatzes eine erfolgversprechende militärisch-operative Umsetzung zu? (Machbarkeitskriterium)
- Ist sichergestellt, daß sich die politische Lage nach dem Ende des UNO-Einsatzes verbessert haben wird? (Erfolgswahrscheinlichkeit)
- Stehen die Kosten in einem realistischen Verhältnis zu einem möglichen Erfolg? (Kosten-Nutzen-Relation)
- Was passiert, wenn der Konflikt eskaliert? (Eskalationsrisiko)
- Ist die politische Kontrolle durchgängig und verläßlich gewährleistet? (Primat der Politik)
- Ist ein jederzeitiger Ausstieg bei gleichzeitiger Schadensminimierung möglich? (Ausstiegsoption)
- Sind unbeabsichtigte Spät- und Nebenfolgen einkalkuliert? (Folgenabschätzung)
Eine prospektive Antwort auf die meisten dieser Fragen macht deutlich, daß die Rolle militärischer Gewalt zur Lösung der heute vorherrschenden Konflikte eher marginal oder sogar dysfunktional ist.
Für eine Zivilisierung von Sicherheitspolitik
Vor dem Hintergrund zunehmender Dysfunktionalität militärischer Gewalt und der nicht-militärischen Natur der meisten akuten und sich abzeichnenden Sicherheitsprobleme muß sich eine zukunftsorientierte und friedenspolitisch ausgelegte Sicherheitspolitik nach der historischen Zäsur von 1989 von vier Prinzipien leiten lassen:
1. Priorität des Ausbaus nicht-militärischer Instrumente der Konfliktbearbeitung; (Prinzip ziviler Konfliktbearbeitung)
2. Entwicklung einer präventiven Konfliktbearbeitung, die schwerpunktmäßig an gewaltträchtigen sozio-politischen und sozio-ökonomischen Strukturen als dem Nährboden von Kriegen und Katastrophen ansetzt; (Prinzip der Prävention)
3. Ausbau kollektiver Sicherheitssysteme, die mit einem Minimum an gemeinsam kontrollierter und politisch legitimierter Ordnungsgewalt auskommen; (Prinzip der Kollektivität)
4. Förderung transnationaler Vernetzungen in der »Gesellschaftswelt« und systematische Beteiligung der nicht-staatlichen Organisationen und Bewegungen (NGOs) an den politischen Entscheidungsprozessen. (Prinzip der Partizipation)
Im Kontext dieser vier Prinzipien plädieren wir:
- für einen glaubwürdigen und konsequenten Ausbau internationaler Ordnungsstrukturen zur Krisenprävention und Konfliktbearbeitung im Rahmen kollektiver Sicherheitssysteme, namentlich der UNO und regionaler Einrichtungen nach Kapitel VIII der UNO-Charta wie z.B. der KSZE, die nicht länger zugunsten militärischer Bündnisse wie NATO und WEU vernachlässigt, ausgehöhlt und entwertet werden dürfen, um nicht Renationalisierungstendenzen von Sicherheitspolitik Vorschub zu leisten. Wie auch Altbundespräsident von Weizsäcker kürzlich betonte, kann und darf die Gewaltoption „nicht länger ein Monopol nationalstaatlicher Verfügungsmacht bleiben“. An die Stelle des Rechts des Stärkeren sollte die Stärke des Rechts treten;
- für massive politische, ökonomische, ökologische und soziale Hilfs- und Stützungsprogramme sowie strukturelle Anpassungsleistungen der westlichen Industrieländer und Deutschlands für die Krisenregionen im Süden und Osten, um auf diese Weise die eigentlichen Wurzeln und Ursachen statt die Symptome von Unsicherheit, Instabilität und Gewalt zu bekämpfen;
- gegen jedweden von Deutschland mitgetragenen WEU-gestützten Interventionismus in außereuropäische Regionen, der sich außerhalb des UNO-Rahmens stellt sowie gegen jeden (heute noch rein hypothetischen) eigenverantwortlichen nationalen Einsatz deutscher Streitkräfte außerhalb der Landesverteidigung. Wir warnen in diesem Zusammenhang nachdrücklich vor der sich abzeichnenden Gefahr, daß deutsche Streitkräfte durch das Drängen Frankreichs in fragwürdige Interventionen und in unübersehbare militärische Abenteuer namentlich in Afrika hineingezogen werden könnten;
- für den umfassenden Aufbau und die praktisch-politische Erprobung von nationalen und internationalen Institutionen und Verfahren nicht-militärischer präventiver Konfliktbearbeitung, Krisenvorbeugung und Problemlösung. Dabei geht es um den kreativen Einsatz differenzierter Methoden und Mittel »sanfter Gewalt«, also ziviler Beeinflussungsinstrumente sowie der verstärkten Einbeziehung einer Infrastruktur nicht-staatlicher Akteure in dieses Handlungsfeld. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell viel Geld für militärisch gestützte Sicherheitspolitik und Militäroperationen bereitgestellt wird, ganz im Unterschied etwa zu der Kürzung entwicklungspolitischer Mittel und zu der Unterfinanzierung und Vernachlässigung ziviler Aktivitäten. Im Hinblick auf die Zukunft muß ein klares Bekenntnis zur Subsidiarität militärischer Maßnahmen gegenüber nicht-militärischen Mitteln abgelegt werden und vor allem konsequent in praktische Politik umgesetzt werden;
- für den zügigen Aufbau nationaler und internationaler ziviler Infrastrukturen und Hilfswerke zur Katastrophenvorbeugung und zur humanitären Hilfe für Menschen in Krisen- und Kriegssituationen. Insbesondere wären Bemühungen der UNO bei der Schaffung eines international zusammengesetzten und dezentral agierenden Netzwerkes ziviler Hilfswerke und eines Systems »Humanitärer Diplomatie« zu unterstützen;
- für die rigorose Einhaltung der restriktiven Grundsätze deutscher Rüstungsexportpolitik, die auch auf europäischer Ebene nicht verwässert werden dürfen. „Will man Unfrieden schaffen mit immer mehr Waffen?“ Es erscheint als wenig sinnvolle Aufgabe, erst Waffen zu exportieren, um dann deutsche Soldaten auszuschicken, um diese Waffen unter Lebensgefahr wieder einzusammeln. Stattdessen fordern wir eine massive Reduzierung der Rüstungsexporte und darüber hinaus eine umfassende und konsequente Abrüstungs- und Rüstungskonversionspolitik;
- wir unterstützen nachdrücklich alle Ansätze (etwa auf der Ebene des Außenministeriums oder des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit), klassische Militär- und Ausrüstungshilfe sowie die Ausbildung ausländischer Offiziere speziell aus Ländern der 3. Welt an Einrichtungen der Bundeswehr zugunsten einer »Demokratisierungshilfe« und »Zivilisierungshilfe« (u.a. Rechtsstaatlichkeit, Wahlhilfe, Aufbau demokratisch und rechtsstaatlich kontrollierter Sicherheitskräfte) einzuschränken, umzuwidmen bzw. neu zu konzipieren;
- wir fordern nachdrücklich die überfällige Auszahlung der viel beschworenen »Friedensdividende« aus Abrüstungsmaßnahmen und Einsparungen bei den Militärausgaben und Militärhilfeprogrammen.
Wir unterstützen in diesem Zusammenhang den aktuellen Vorschlag des Entwicklungsprogramms der UNO (UNDP), 20 % dieser Mittel in einen weltweiten Fonds zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung menschlicher Entwicklung und sozialer Sicherungssysteme einzuzahlen. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur präventiven Bekämpfung von Gewalt- und Konfliktursachen. Des weiteren fordern wir mehr Mittel für eine bessere Ausstattung wissenschaftlicher und praktisch-politischer Friedensarbeit. Die Devise muß heißen:
Mehr Friedensakademien statt Militärakademien, mehr Friedensforschung statt Rüstungs- und Militärforschung.
Fazit: Falsche Weichenstellung
Die derzeitige Umrüstung der NATO und der Bundeswehr, die eine Reaktivierung und Effektivierung militärischer Gewalt als ein Mittel aktiverer Macht- und Interessenpolitik der westlichen Industrienationen zum Ziel hat, basiert letztlich auf einem tradierten Denken, das dem Militärischen eine zentrale Rolle in Politik und Gesellschaft beimißt und Kriege sowie Streitkräfte als quasi Naturkonstanten begreift. Dem Militär wird in der »post-cold-war-era« eine unangemessene ordnungsstiftende Rolle und Bedeutung zugewiesen, die in einem krassen Widerspruch zu den verteidigungspolitisch begründbaren Erfordernissen und Herausforderungen steht. Statt einer konsequenten Entmilitarisierungspolitik, die die Überrüstungen und Altlasten aus der Zeit des Kalten Krieges abbaut, wird eine potentielle militärische Vereinnahmung der Außen- und Sicherheitspolitik vollzogen.
Hamburg, im September 1994
Rudolf Hamann, Volker Matthies, Wolfgang R. Vogt (Führungsakademie der Bundeswehr Hamburg).