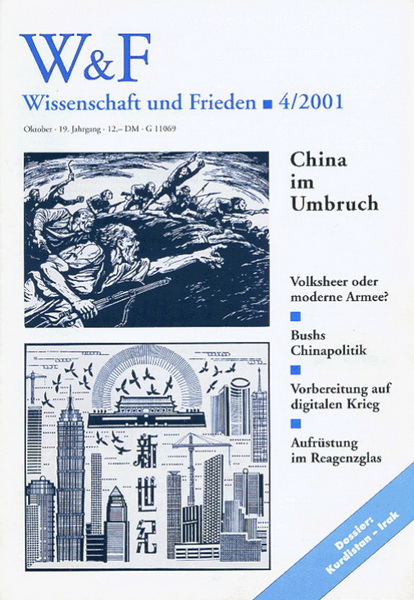Du sollst nicht töten!
Das 5. Gebot und das Töten im Krieg
von Heinz-Günther Stobbe
In der vorletzten Nummer dieser Zeitschrift hat Albert Fuchs kritisch gegen die Lehre vom Gerechten Krieg Stellung bezogen. Er billigt ihr eine „beachtliche ethische Plausibilität“ zu (W&F 2-2000, S. 12), unterstreicht die Fragwürdigkeit einer pauschal diffamierenden Kritik, die ihre Stärken ignoriere (S. 13) und räumt am Ende sogar die Möglichkeit einer von Schwächen entlasteten hilfreichen Fassung ein (S. 15). Das lädt ein zu weiterem Nachdenken, das sich im Folgenden auf einige hoffentlich weiter führende Aspekte konzentrieren soll.
Als die eigentliche Achillesferse der BLJ bezeichnet der Autor den „unabdingbaren Widerspruch zwischen Mittel und Zweck bzw. von Tötungstabu und Tötungslizenz“, der sich nach seinem Urteil in der jüdisch-christlichen Tradition deshalb zuspitzt, weil diese seit alters her beansprucht habe, das in allen Kulturen vorhandene Tötungstabu „radikal verallgemeinert, auf alle Artgenossen ausgeweitet zu haben.“ (S. 14)
Offenbar hat der Autor bei dem Hinweis auf Juden- und Christentum das 5. Gebot des Dekalogs im Sinn, das üblicherweise lautet: »Du sollst nicht töten!«. Besser würde es heißen: »Du sollst nicht morden!«, doch kann auch diese Übersetzung nicht ganz befriedigen. Der Grund dafür eignet sich gut, um die historische und sachliche Schwierigkeit der von Fuchs vorgetragenen These zu beleuchten. Zunächst aber: Es erscheint wenig glücklich, in diesem Zusammenhang von einem »Tötungstabu« zu sprechen. Religionsgeschichtlich betrachtet handelt es sich bei einem Tabu ganz allgemein um ein Verbot, allerdings sehr eigener Art. Das wird unter anderem deutlich im Fall der Tabu-Verletzung und ihrer Sanktionierung: Wer gegen ein Tabu verstößt, zieht sich in jedem Fall eine Strafe zu – und zwar völlig unabhängig davon, ob der Verstoß wissentlich und willentlich vollzogen wurde. Das bedeutet: Das Tabu markiert eine vormoralische Grenze menschlichen Verhaltens, die sich mit dem modernen Verständnis moralisch verantwortlichen Handelns schwer vereinbaren lässt. Ob es historisch und inhaltlich angemessen ist, allen Kulturen ein »Tötungstabu« zuzuschreiben (S. 14), darf bezweifelt werden. Das wäre schon deshalb unstimmig, weil gerade Tabu-Verletzungen oft ihrerseits mit dem Tod bestraft werden.
Das Alte Testament kennt eine Fülle höchst unterschiedlicher Tabus in allen Bereichen des Zusammenlebens von Menschen sowie von Mensch und Tier. Besonders die sexuellen Beziehungen innerhalb der auf engstem Raum zusammenlebenden Großfamilie sind, wie etwa das Buch Levitikus belegt, in hohem Maße durch Tabu-Regeln normiert, denen meist noch magische Vorstellungen zugrunde liegen. Das Tötungsverbot des Dekalogs jedoch gehört auf keinen Fall zu den Tabus.
Tatsächlich gibt es, so weit kann Fuchs zugestimmt werden, keine Kultur ohne irgendeine Art von Tötungsverbot. Aber dieser allgemeine Befund sagt wenig aus, so lange nicht dessen jeweilige Eigenart und Reichweite bestimmt wird. Das lässt sich am Beispiel des 5. Gebots recht gut erläutern. Zwar wirft die historisch-kritische Interpretation des Dekalogs bzw. der Zehn Gebote recht verzwickte Fragen auf, immerhin jedoch besteht in der alttestamentlichen Forschung in drei Punkten Konsens. Zum ersten repräsentieren die beiden vorliegenden Fassungen des Dekalogs vergleichsweise späte Entwicklungsphasen. Das heißt konkret: Sie stammen mit Sicherheit aus dem späten Exil, unter Umständen sogar aus der nachexilischen Zeit. Zum zweiten: Die Einzelgebote der so genannten zweiten Tafel greifen älteres Traditionsgut aus dem Bereich des Familien- und Sippenrechts auf, das definitionsgemäß keine universale Geltung beansprucht. Zum dritten: Das Konstruktionsprinzip des Dekalogs besteht darin, diese traditionellen Elemente in den Rahmen des Gottesrechts einzuordnen. Ihr Geltungsgrund und ihre Reichweite hängen deshalb strikt vom 1. Gebot ab, das mit den Worten beginnt: „Ich bin Jahve, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus.“ (Ex 20, 2) Der Dekalog entfaltet demnach Gottesrecht als Bundesrecht des so genannten Sinai-Bundes und bezieht sich infolgedessen weder auf die Menschheit insgesamt noch auf andere Völker, sondern ausschließlich auf das Volk Israel als Jahves Bundesvolk. Man kann die Grenzen der einzelnen Gebote und Verbote sogar noch enger ziehen: Vorrangig geht es um den Rechtsschutz innerhalb der Familie, der sich ursprünglich nicht am Prinzip der Verschuldenshaftung, sondern am Prinzip der Erfolgs- bzw. Ergebnishaftung orientiert, also eine rechtswidrige Tat unabhängig vom Tatvorsatz bewertet. Daher unterscheidet die Verbotsnorm nicht zwischen Tötung im Allgemeinen und Mord im Besonderen. Das geschieht erst im Zuge der Verlagerung der Sanktionsgewalt weg vom Familienoberhaupt hin zur Ortgerichtsbarkeit und damit des Ausbaus rechtsförmiger Verfahren, in dessen Folge dann auch die Tatstrafen je nach Delikt differenziert werden. Obgleich es unhistorisch wäre, für die Entstehungszeit des Dekalogs eine klar und sauber durchgeführte Unterscheidung von Ethos bzw. Sitte einerseits und Recht andererseits zu erwarten, gehört das 5. Gebot dennoch primär in die Rechtssphäre, nicht in den Bereich der Ethik.
Die Eigenart des 5. Gebots lässt sich noch besser erkennen durch den Blick auf eine vergleichbare Stelle. Im Buch Genesis findet sich folgende Version des Tötungsverbotes: „Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder.“ (9, 5) Erneut ist der theologische Bezug entscheidend: Dem Gott Israels wird eine allgemeine Strafandrohung in den Mund gelegt, die nach Art einer Generalprävention jedes Blutvergießen verhindern soll. Anders jedoch als im Dekalog begründet der (priesterschriftliche) Autor den Rechtsanspruch Gottes auf alles Blut (=Leben) nicht mit dem besonderen Verhältnis zwischen Jahve und seinem Bundesvolk Israel, sondern er verortet ihn im so genannten Noah-Bund (vgl. Gen 9, 1-17), der das ursprüngliche Schöpfungshandeln Gottes fortsetzt. Darum greift er auf den Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen zurück, den er bereits im ersten Kapitel eingeführt hatte (vgl. Gen 1, 26. 27): „Denn: Als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht“ (Gen 9, 6b). Erst dieser Begründungsschritt verleiht dem Tötungsverbot einen wirklich universellen Charakter. (Nur am Rande: Wie fern und fremd uns dennoch die zugrunde liegende Vorstellungswelt in anderer Hinsicht ist, zeigt die Einbeziehung der Tiere in die Strafandrohung Jahves, ein Echo altorientalischen Rechtsdenkens.) Selbst in dieser allgemeinsten Fassung allerdings bedeutet das Tötungsverbot mitnichten, dass überhaupt kein Töten erlaubt wäre. Schon Gen 9, 6a stellt ausdrücklich fest: „Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen.“ Im Übrigen kennt das Alte Testament unbeschadet der Geltung des Dekalogs zahlreiche Strafdelikte im sozialen und kultischen Leben, die mit dem Tode geahndet werden dürfen, ja sogar zwingend die Todesstrafe fordern. Dafür drei Beispiele: a) Ex 21, 16: „Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, wird mit dem Tode bestraft.“ b) Deut 22, 23 für den Fall des Beischlafs einer verlobten Frau mit einem Liebhaber: „Ihr sollt sie steinigen, und sie sollen sterben…“ Schließlich c) aus dem Bereich des Kriegsrechts für den Fall einer erfolgreich belagerten Stadt: „Wenn der Herr, dein Gott, sie in deine Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen.“ (Deut 20,13)
Aus alledem ergibt sich eindeutig: Es ist verfehlt, das 5. Gebot im pazifistischen Sinne als ein uneingeschränktes ethisches Tötungsverbot zu interpretieren, das keinerlei Ausnahme zuließe. Sein Ziel als Rechtsnorm besteht darin, inner- und interfamiliäre Beziehungen vor den gefährlichen Folgen von Tötungsdelikten zu schützen, während dieselbe Funktion im Kontext des Verkehrs zwischen verschiedenen Sippen durch die Institution der Blutrache erfüllt wird. Wo das Verbot in seiner prohibitiven Funktion versagt, wird seine Übertretung ihrerseits in der Regel mit dem Tod geahndet. Den elementaren Schutz-Charakter dieser Tat/Sanktions-Folge »Leben gegen Leben« illustriert eindrucksvoll das Beispiel des Mordes durch einen unbekannten Täter, der durch die Tötung einer Kuh durch die Ältesten gesühnt werden muss: „Sie sollen feierlich sagen: Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen, und unsere Augen haben nichts gesehen. Deck es zu, zum Schutze deines Volkes Israel, das du freigekauft hast, Herr, und lass kein unschuldig vergossenes Blut in der Mitte deines Volkes Israel bleiben. Dann ist das Blut zu ihrem Schutze zugedeckt.“ (Deut 21, 7. 8)
Man erkennt leicht die tiefe Einbettung praktischer Verhaltensformen im Umgang mit erlittener Gewalt in eine religiöse Vorstellungswelt, die weit entfernt ist von einer eigenständigen Ethik des Lebensschutzes. Darin wenigstens gleicht das Alte Testament den archaischen und antiken Kulturen. In ihnen existiert kein Widerspruch zwischen Tötungsverbot und Tötungsgebot. In Wahrheit verhält es sich umgekehrt: Gerade die Heiligkeit des Lebens verlangt zwingend danach, »unschuldig vergossenes Blut« durch Blut zu sühnen. Das und nichts anderes macht den Inhalt des Tötungsverbotes in allen bekannten Kulturen und Gesellschaften aus: das Töten unschuldigen Lebens zu verhindern.
Ein Letztes: Weder das Tötungsverbot noch das Institut der Blutrache haben mit dem Krieg zu tun. In keiner frühen Kultur wird der Krieg überhaupt als Problem der Ethik wahrgenommen. Auch hier hat die religiöse Perspektive unbedingten Vorrang: Der »Feind« verkörpert ja keineswegs nur einen politischen Gegner, sondern die Chaos-Mächte, die als solche die Ordnung der Welt und mit ihr die Grundlagen des Friedens bedrohen. Da er per definitionem nicht zu dieser Ordnung gehört, fällt er auch nicht unter die konstitutive Unterteilung in unschuldiges und schuldiges Leben. Man könnte in gewissem Sinne sagen, der »Feind« erscheine eigentlich nur als Un-Mensch, sofern dabei im Blick bleibt, dass seine Un-Mensch-lichkeit keine moralische Degeneration oder Perversion signalisiert, sondern seinen ontologischen Status. Das erklärt die unerhörte Brutalität der Kriegsführung: Der Feind als Feind kann ohne alle moralische Bedenken vertrieben, versklavt oder eben vernichtet werden, eben weil er weder als moralisches Subjekt noch als Träger von Rechten in den Blick kommt. Allen frühen Gesellschaften eigen ist mithin eine ethnozentrische Sichtweise, aufgrund derer die eigene Gruppe mit der »Menschheit« identifiziert wird, und nur innerhalb ihrer Grenzen ergibt sich die Notwendigkeit, das Töten zu rechfertigen. Entsprechend taucht nirgendwo die Frage nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Krieges im spätantiken oder gar modernen Sinne auf. Das »Legen der Feinde« zählt selbstverständlich zu den elementaren Herrschaftspflichten etwa des ägyptischen Pharao, der im Krieg und durch den Krieg nicht allein die politische und soziale, sondern zugleich und mehr noch die kosmische Ordnung schützt.
Die Lehre vom Gerechten Krieg (BJL) erweist sich demnach als Ergebnis einer höchst voraussetzungsvollen Entwicklung, im Verlauf derer religiöse, ethische und politische Reflexion allmählich auseinander treten, um sodann gerade in der Form dieser Lehre in eine neue Beziehung zueinander gebracht zu werden. Für dieses Bemühen stehen zumal ihre christlichen Vertreter, allen voran Augustinus. Wie immer man jedoch deren Anstrengungen beurteilen mag, dem Krieg einen Ort in der moralischen Weltordnung zu geben und ihn damit überhaupt einer ethischen Beurteilung unterwerfen zu können, fest steht ihr historisches Scheitern. Der geistesgeschichtliche Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit markiert neben manch anderen emanzipativen Bewegungen auch und nicht zuletzt die Ablösung der Lehre vom Gerechten Krieg von ihrem traditionellen religiösen oder theologischen Fundament. Mehr noch: Sie verliert gleichzeitig, wie das Verständnis der Politik weithin, auch den Bezug zur Ethik. Am Ende dieses Prozesses steht das Ius ad Bellum als wesentlichster Ausdruck absoluter staatlicher Souveränität und Autorität, die in der Wahrnehmung des Rechts zum Krieg keiner übergeordneten Instanz mehr rechenschaftspflichtig sind und ausschließlich dem Kalkül politischer Rationalität folgen. Es bedurfte offenbar der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts, um nachhaltige Zweifel daran zu säen, ob dieser theoretische und praktische Stand der Dinge als der menschlichen Weisheit letzter Schluss angesehen werden kann.
An einer der wenigen Stellen seiner »Anmerkungen«, an denen ihr sachlicher Grundzug ironisch gebrochen wird, behauptet Fuchs, der vielfach belegte Missbrauch der BJL irritiere deren Vertreter so wenig wie die Logiker „Fehler von Laien beim schlussfolgernden Denken“ (W&F, S. 13). Woher er das weiß, verrät er allerdings nicht, und obgleich er wörtlich den Hirtenbrief der Deutschen Bischofskonferenz von 1983 (»Gerechtigkeit schafft Frieden«) zitiert, der ihre ideologische Anfälligkeit ausdrücklich feststellt, versäumt er es, ebenfalls mitzuteilen, dass am gleichen Ort die BJL in ihrer klassischen Form verabschiedet wird. Gänzlich immun gegen geschichtliche Erfahrung scheint man wenigstens auf kirchlicher Seite nicht zu sein. Vor diesem Hintergrund freilich wird in der Tat die von Fuchs abschließend aufgeworfene Frage unausweichlich: „Was bleibt?“ (S. 15), Die deutschen Bischöfe antworten zunächst mit einem terminologischen Vorschlag: „Angesichts der neuzeitlichen Wirkungsgeschichte der säkularen Theorien des »gerechten Krieges« mit ihren vielen problematischen Ausformungen empfiehlt es sich, folgerichtig eher von »gerechter Verteidigung« zu sprechen.“ (Nr. 3. 5. 1) Sachlich betrachtet, so die Bischöfe weiter, „behält der ethisch-normative Kerngehalt der Lehre »gerechter Verteidigung« innerhalb einer umfassenden Friedensethik der Kirche eine beschränkte, im konkreten Fall schwierige, dennoch für die ethische Orientierung bis jetzt unersetzliche Funktion, nämlich im Hinblick auf den Grenzfall einer fundamentalen Verteidigung des Lebens und der Freiheit der Völker, wenn diese in ihrer elementaren physischen und geistigen Substanz bedroht oder gar verletzt werden.“ (Nr. 4. 1) Man wird einräumen müssen, dass diese allgemeine bzw. grundsätzliche Bestimmung noch keine einfach zu handhabende Kriteriologie an die Hand gibt, um »im konkreten Fall« entscheiden zu können, ob die Anwendung militärischer Gewalt ethisch legitim wäre oder nicht. Immerhin aber lässt sie keinen Raum für die von Fuchs mit Blick auf die Problematik so genannter humanitärer Interventionen vorgetragene These, Staatenbündnisse oder gar alle einzelnen Staaten würden durch eine „globale Solidaritätspflicht“ (Spieker) eo ipso „in jedem Fall“ zum militärischen Eingreifen verpflichtet. (S. 14) Einen derartigen Automatismus kann es weder in völkerrechtlicher noch in ethischer Hinsicht geben. Zwar fehlt es bislang an einer Kasuistik relevanter Rechtsbrüche, dennoch liegt auf der Hand, dass fundamentale Rechtsgüter in beträchtlichem Ausmaß gefährdet sein müssen und infolgedessen selbst die Verletzung von Menschenrechten als solche nicht als Interventionsgrund ausreicht. Darüber hinaus fordert die BJL ja nicht nur einen schwerwiegenden Rechtsgrund (»causa iusta«), sondern das Vorliegen zusätzlicher Bedingungen, die allesamt eine automatische, sprich: unterschiedslose Gewaltanwendung ausschließen.
Zu diesen Bedingungen zählt unverändert auch die Notwendigkeit einer legitimen Entscheidungsinstanz, in der christlichen und katholischen Soziallehre üblicherweise mit der rechtmäßigen Regierung eines Staates gleichgesetzt. Fuchs hält diesen Standpunkt für „gewiss obrigkeitsgefällig,“ sieht jedoch einen Widerspruch zu „der in eben dieser Tradition betonten moralischen Letztverantwortung des Einzelnen“ sowie zur „grundgesetzlich garantierten unverletzlichen Gewissensfreiheit.“ (S. 14) Auch dieser Einwand hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Zunächst stellt „die Einforderbarkeit bzw. Erzwingbarkeit des Gehorsams der Regierten gegenüber dem Anspruch der Obrigkeit“ mitnichten „eine zentrale Funktionsbedingung eines bellum iustum“ dar (S. 14). Das trifft nicht einmal für die Funktionsfähigkeit des Militärs zu, geschweige denn für das Verhältnis von Regierung und Volk im Rahmen eines demokratischen Rechtsstaates. Das Soldatengesetz der Bundesrepublik Deutschland billigt in § 10(4) Vorgesetzten Befehlsgewalt „nur unter Beachtung der Regeln des Völkerrechts, der Gesetze und der Dienstvorschriften“ zu und schreibt den Soldaten in § 11(1) zwar eine grundsätzliche Gehorsampflicht gegenüber seinen Vorgesetzten zu, hält dann aber fest: „Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird, der die Menschenwürde verletzt oder der nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist.“ § 11(2) verbietet ausdrücklich den Befehlsgehorsam, „wenn dadurch eine Straftat begangen würde.“ Schon rechtlich also hat der »Anspruch der Obrigkeit« Grenzen, erst recht in moralischer Hinsicht. Kein Staat hat das Recht, die Gewissensfreiheit einzuschränken oder gar aufzuheben, niemand kann sich aber auch auf Amtspflichten oder Rechtsbefugnisse berufen um sich der Pflicht zu entziehen, sich auch in politischen Angelegenheiten ein moralisches Urteil zu bilden und dem eigenen Gewissen zu folgen. Art. 38 des Grundgesetzes bekräftigt ausdrücklich die exklusive Gewissensbindung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der nach Art. 80a GG über den so genannten Spannungsfall entscheidet.
Es lässt sich deshalb nur schlecht nachvollziehen, wie Fuchs dazu kommt, einen prinzipiellen Widerspruch zwischen Gewissensfreiheit und Gehorsamspflicht anzunehmen. Richtig ist allerdings: Eine garantierte »Folgebereitschaft der Regierten« kann und darf es nicht geben, weder im demokratischen Rechtsstaat noch überhaupt, weder für Bürger und Bürgerinnen im allgemeinen noch für solche in Uniform im Besonderen. Vorbehaltlose Zustimmung verdient, was die Wiener Philosophin H. Pauer-Studer jüngst geschrieben hat: „Die Konsequenzen von Entscheidungen zum Kriege und die Art der Kriegführung an moralischen Standards zu prüfen, ist eine Minimalbedingung ziviler Gesellschaften.“ (Ethik des gerechten Krieges, in: Liessmann, K.P.,Hg.: Der Vater aller Dinge. Nachdenken über den Krieg, Wien 2001, 93-117, dort 99)
Mit Rücksicht auf diese Sachlage kann keine Rede davon sein, die BJL verwandle gleichsam unter der Hand Mord in eine „prosoziale(n) Handlung“, in eine „Tugendheldentat“, einfach deshalb, weil er „von Staats wegen“ ausgeübt wird. Da der Begriff des Mordes per definitionem eine moralisch verwerfliche und rechtlich strafbare Tötung bezeichnet, lässt sich Mord schon aus analytischen Gründen niemals moralisch rechtfertigen, auch nicht dank einer „staatlichen Lizenz zum Töten“. Staatlich angeordneter Mord bleibt Mord und also ein Verbrechen. Dass in der Realität kaum ein Staat besonders ausgeprägte Neigungen zeigt, Staatsverbrechen effektiv zu verfolgen, liegt sozusagen in der Natur der Sache und sollte niemand verwundern, ändert aber nichts am Grundtatbestand: Gerade deshalb kann es nur als Fortschritt begrüßt werden, wenn mittlerweile begonnen wird, gegebenenfalls selbst Regierungschefs die Immunität zu entziehen, um sie strafrechtlich belangen zu können.
Nun lässt die Argumentation von Fuchs durchscheinen, dass er schon die Idee für untragbar hält, Töten könne jemals moralisch erlaubt oder sogar geboten sein. Wäre das richtig, müsste in der Tat auch das staatlich angeordnete Töten im Krieg eo ipso moralisch verurteilt werden. Das berühmt-berüchtigte Schlagwort, alle Soldaten seien Mörder, bringt genau das zum Ausdruck. Und natürlich macht es keinen Sinn, von besonderen Kriegsverbrechen zu sprechen, wenn der Krieg als solcher zum Verbrechen erklärt wird. Nur, mit allen derartigen Wertungen ist bereits vorweg entschieden, was erst noch zu klären wäre: Ob das Töten eines Menschen in jedem Fall und besonders im Krieg als moralisch verwerflich gelten muss. Strenge Pazifisten bejahen das, doch widerspricht dieser strenge Standpunkt sowohl unserem Rechtssystem als auch dem allgemeinen Rechtsempfinden. Beide unterscheiden vergleichsweise trennscharf zwischen Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge u.a.m., beziehen also in die rechtliche und moralische Beurteilung einer Tötungshandlung die ihr zugrunde liegende Absicht bzw. das Tatmotiv mit ein. Im Vergleich mit früheren Kulturen stellt das ohne Zweifel eine bedeutsame zivilisatorische Leistung dar, und man kann sich deshalb durchaus fragen, ob der Pazifismus nicht im Namen eines vermeintlich höheren moralischen Anspruchs solche Errungenschaften des moralischen Bewusstseins preisgibt. Wenn es keinen moralischen Unterschied macht, ob ein Soldat im Gefecht tötet oder einen wehrlosen Gefangenen erschießt, dann spricht das keineswegs für ein gesteigertes Moralempfinden, sondern für moralische Blindheit. Freilich: Der Tod eines Menschen bleibt unaufhebbar und immer ein Übel, selbst wenn er aus moralisch einsichtigen Gründen herbeigeführt oder in Kauf genommen wird. Für Heldenverehrung derer, die für ihn verantwortlich sind, sollte da keinerlei Raum sein. Die Alte Kirche hat christlichen Soldaten, die im Krieg getötet hatten, harte Bußübungen auferlegt. Sie wusste oder spürte noch, dass jedes Blutvergießen einer Welt Tribut zollt, die dem Willen Gottes widerstrebt. Es wäre gut, sich dessen wieder zu erinnern. Wer sich am Krieg begeistern kann, leidet an einer Perversion des Gemüts und der moralischen Urteilskraft. Die wahren Heldinnen und Helden sind immer noch jene Menschen, denen es gelingt, inmitten einer vom Krieg gequälten Welt ein wenig Frieden zu stiften.
Ein kurzes persönliches Wort zum Schluss: An einer Stelle schreibt Fuchs beiläufig den Anhängern der BJL einen „Glauben an militärische Gewalt“ zu (S. 14). Dagegen möchte ich mich entschieden verwahren. Ich kenne niemanden, der an militärische Gewalt glaubt, und jedenfalls für mich gilt, dass ich einzig und allein an Gott glaube, an nichts sonst, am wenigstens an Gewalt. Deswegen empfinde ich eine derartige Formulierung – mit Verlaub – als blasphemisch. Wenn ich unter Umständen selbst tötende Gewalt akzeptiere, dann nicht, weil ich an sie glaube, sondern weil ich wider Willen gelernt habe, dass es noch schlimmere und unmenschlichere Formen der Gewalt gibt als den Tod.
Professor Dr. Heinz Günther Stobbe