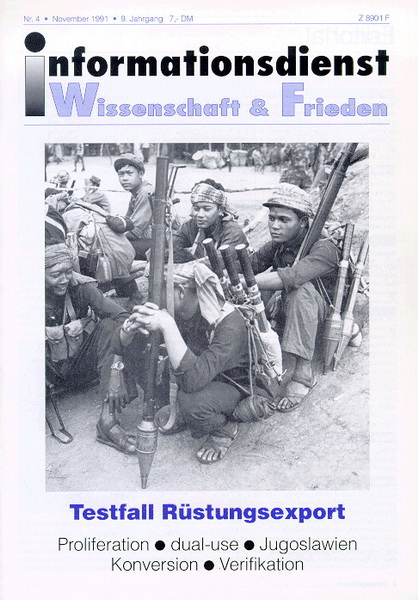Ende eines angekündigten Niedergangs
Zur amerikanischen Diskussion über »grand strategy« und Neue Weltordnung
von Lothar Gutjahr
Der Golfkrieg hat in den USA eine neue Debatte über die Ziele amerikanischer Außen- und Verteidigungspolitik entfacht. Nationale Sicherheit soll nun, da das Vietnam-Syndrom überwunden ist, neu definiert werden. Während sich die ExpertInnen noch über einen Rückzug versus neue Vorherrschaft streiten, hat die Bush-Administration bereits einen nationalen Konsens vorbereitet.*
In den vergangenen Jahren ist viel über Paul Kennedy's „imperial overstretch“ und den Niedergang der amerikanischen Hegemonie diskutiert worden. So wurde festgestellt, daß die USA es sich wirtschaftlich nicht länger leisten könnten, weltweit alleine zu agieren1. Eines der wesentlichen Elemente der Ordnung von Jalta, die amerikanische Fähigkeit, einseitige Entscheidungen – oft eher auf innenpolitischen Überlegungen denn auf außenpolitischen Zwängen beruhend – durchzusetzen, hatte während der sechziger und siebziger Jahre rapide abgenommen: das Vietnam-Syndrom als Beleg des amerikanischen Machtverlustes.
Es gab aber auch andere Stimmen, die meinten, die Position der Vereinigten Staaten sei nicht so sehr vom Niedergang gekennzeichnet. Geänderte Rahmenbedingungen hätten zu einem Einflußverlust geführt2. Anders als noch 1945 könnten sich die USA nicht mehr ausschließlich auf eigene Machtressourcen stützen. Sie hingen vielmehr vom Austausch mit verschiedenen Teilen der Welt ab. Allerding sind diese Abhängigkeitsverhältnisse durchaus nicht symmetrisch. Im Gegenteil. Sie sind gerade eine Machtquelle, die an Bedeutung gewonnen hat3. Für diese ExpertInnen ist die entscheidende Frage, wie die amerikanische Gesellschaft und insbesondere ihre außenpolitischen Entscheidungseliten auf die Veränderungen im internationalen System reagieren. Wichtiger als der Verlust wirtschaftlicher Dominanz ist ihnen die politische Strategie Washingtons im Umgang mit dem Wandel. Das Haushalts- und Außenhandelsdefizit interpretieren sie als Zeichen zunehmender gegenseitiger Abhängigkeiten4, nicht als Machtverlust.
Ob Niedergang oder Interdependenz, die beiden Ansätze zeitigen recht unterschiedliche Konsequenzen für die amerikanische Grand Strategy. In der Frage, wie mit den Veränderungen umgegangen werden soll, differenzieren sich die Ansätze. Die einen meinen, die USA sollten sich nun endlich auf ihre unmittelbaren Interessen konzentrieren, da sonst der ökonomische Niedergang nicht mehr zu stoppen sei. Andere hingegen sagen, »new leadership« bestehe gerade darin, multilaterale Partnerschaft zu etablieren und im amerikanischen Sinne zu nutzen.
Die Isolationisten
Auch nach 1989 ist ein Teil der amerikanischen Politikvorstellungen von Isolationismus und »superpower-disengagement« geprägt5. Gerade die Revolutionen in Ost-Europa, so meinen diese TheoretikerInnen, sollten den Vereinigten Staaten dazu verhelfen, sich jetzt wieder auf die westliche Hemisphäre zu konzentrieren. Solche Vorstellungen werden nicht nur von der traditionsbewußten politischen Rechten vertreten. Während dort auch im vierten Jahrzehnt der Nato die Abneigung vor dauerhaften Bündnissen grassiert6, wollen liberale DemokratInnen eine dynamische Wirtschaft, basierend auf dem internen Markt, aufbauen7.
Die Interventionisten
Von der Prämisse des Niedergangs amerikanischer Macht gehen übrigens auch die »InterventionistInnen« aus – mit gänzlich anderen Resultaten. Charles Krauthammer beispielsweise vertrat in der Zeitschrift Foreign Affairs zu Beginn des Jahres die Ansicht, daß die USA einen robusten wenngleich schwierigen Interventionismus benötigten sowie ohne falsche Scham die Regeln der internationalen Beziehungen festlegen sollten8. Wenn man den Persischen Golf nicht als lebenswichtige Interessensphäre sehe, so bliebe nur noch, die Florida-Küste gegen eine Invasion zu sichern. Er sieht den ökonomischen Niedergang als Problem der amerikanischen Politik; von imperialer Überdehnung will er allerdings nichts wissen. Die USA seien die einzig verbleibende Supermacht, so seine Ausgangsüberlegung. In der Tradition von Bushs Amtsvorgänger Reagan sehen die InterventionistInnen nach dem Ende von »Jalta« die Chance, wiederum eine amerikanische Hegemonialstellung, ähnlich der nach 1945, zu erlangen. Anders als Bush reflektieren sie allerdings nicht die Erfahrungen der Jahre 1981-1989. Die außenpolitische Restauration unter Reagan erwies sich bereits damals als kaum machbar und war politisch nicht durchzuhalten9.
Die Interdependenztheorie
TheoretikerInnen der Interdependenz beziehen sich demgegenüber in ihren Analysen auf die Diffusion von Macht und die Relativierung staatlicher Souveränität. Dies führt sie zu gänzlich anderen Schlußfolgerungen als die VertreterInnen der Niedergangsthese. Ihres Erachtens müsse Washington seine Führungsrolle modifizieren und zugleich wieder stärker wahrnehmen. Die U.S.-Administration müsse „akzeptieren, daß die Innenpolitik, ökonomische Bedingungen sowie der Stand von Technologie, Erziehung und Infrastruktur in anderen Ländern, die Interessen der USA unmittelbar berühren“ 10. In einer Welt, die durch gegenseitige Abhängigkeit und Verwundbarkeit gekennzeichnet sei, könnten sich die Vereinigten Staaten eine geopolische Abstinenz nicht erlauben. Washington müsse nationale Interessen in den verschiedenen Weltregionen artikulieren und im Rahmen multilateraler Prozesse durchsetzen.
Militärische Macht als Mittel globalen Einflusses
Allen »Schulen« ist gemeinsam, daß sie militärische Macht als wesentliches oder zumindest noch mögliches Instrument globalen Einflusses sehen. So verwundert es nicht, daß sich in diesem Bereich ein neuer Konsens vorbereitet hat. Kleiner, mobiler, in allen Regionen einsetzbar und effizienter soll die Streitmacht der USA werden11. »Überdehnung« bezüglich ihrer finanziellen Mittel und »Unterengagement« gemessen an den Gestaltungsnotwendigkeiten der Weltpolitik sind unterschiedliche Ausgangspunkte für die gleiche Schlußfolgerung: »power projection« als neue Militärstrategie. Die Vornestationierung soll verringert, die Reserveeinheiten sollen aufgestockt und die Beschaffungen restrukturiert werden, um eine größere Stationierungsgeschwindigkeit zu erzielen.
Aber Machtprojektion ist mehr als nur eine militärische Strategie. Sie umfasst auch ein außenpolitisches Konzept. Die Alliierten sollen von den USA politische und militärische Rückendeckung erhalten12. Statt selber in einzelnen Gebieten massiv präsent zu sein, will Washington lediglich intervenieren, wenn die Stabilität der jeweiligen Region bedroht ist. Ansonsten liegt diese Aufgabe bei Kernverbündeten »vor Ort«.
Diese Strategie stellt sowohl die Antwort auf Haushaltsrestriktionen, als auch auf neue Herausforderungen dar13. Unterschiedliche Ausgangspositionen und Paradigmen können durch power projection zu einer Strategie gebündelt werden. Die notwendigen Veränderungen im diplomatischen Stil und in der weltweiten Vornestationierung können entweder als amerikanischer Rückzug (IsolationistInnen) oder als Versuch gewertet werden, unter den Bedingungen der Interdependenz die Manövrierfähigkeit der USA zu verbessern (InterventionistInnen). In jedem Fall stützt sich die Außenpolitik des Weißen Hauses auch weiterhin auf bilaterale Kooperation mit regionalen Hauptmächten im Rahmen multilateraler Strukturen. Militärische Machtprojektion in diesem Sinne ist das Herzstück einer breit angelegten Strategie der Machtübertragung an wesentliche Alliierte und entsprechende Bündnisse14.
Machtprojektion und Regionalismus
Das politische Potential der power projection scheint von der Bush-Administration erkannt und geschickt zu einem neuen potentiellen Konsens in der amerikanischen Außenpolitik genutzt zu werden. Stabilität, so meinten verschiedene VertreterInnen der U.S.-Administration, sei der Hauptgegner. Die „Aufgabe vor uns ist es, die Früchte der friedlichen Revolutionen zu sichern und die Architektur herzustellen, die weiteren friedlichen Wandel ermöglicht“ 15. Mit dieser Kernvorstellung erscheint die Bush-Regierung als recht konservativ – im Sinne von bewahrend – wo doch eigentlich nicht viel zu erhalten ist. Stabilität ist kein den fundamentalen Veränderungen des internationalen Systems angemessenes Ziel. Die USA können es sich machtpolitisch kaum leisten, die Neustrukturierung der internationalen Beziehungen nur ihren Verbündeten in den Regionen zu überlassen – auch nicht in Europa. Stabilitätssicherung im Sinne von Status-quo-Erhalt ist langfristig destabilisierend16.
Zweifellos hat die macht- und militärpolitisch gefärbte Diskussion in den USA den Präsidenten und seinen Außenminister dazu verleitet, ökonomische Aspekte, sowie die Substanz der politischen Veränderungen zugunsten der formalen Prozeßsicherung zu vernachlässigen. Die neue „Melange europäischer Verhältnisse“ 17 hat insofern keinen Paradigmenwechsel der amerikanischen Politik hervorgebracht, als Washington nach wie vor in erster Linie als Bewahrer der internationalen Ordnung auftritt. Oder anders formuliert: Ein politischer Rückzug der USA findet nicht statt – lediglich eine Umdefinierung ihrer Rolle. »Regionalismus« – traditionell ein Markenzeichen liberaler Außen- und Verteidigungspolitik, scheint von der Bush-Administration gekidnapped worden zu sein. Das Einverständnis, Macht zu delegieren18 um die Gesamtkontrolle zu behalten, ist eine Vorstellung, die das Weiße Haus offensichtlich von den TheoretikerInnen der Interdependenz übernommen hat, ohne die Option von Interventionen grundsätzlich aufzugeben19.
Nach dem Golfkrieg scheint sich ein neuer Konsens über die nationalen Interessen innerhalb der politischen Klasse der Vereinigten Staaten anzubahnen, der sich um die Leitbegriffe Machtprojektion und Regionalismus gruppiert. Lediglich die IsolationistInnen unterschiedlicher Parteizugehörigkeit und einige vereinzelte InterventionistInnen des rechten republikanischen Flügels betätigen sich im Rahmen der Grand Strategy-Debatte als Bedenkenträger20.
Neueinschätzung der UdSSR
Bezüglich Europas sprechen Bush, Baker und Cheney seit 1989 von der Überwindung der Containment-Politik. Hauptelement dieser Politikveränderung war – ausgelöst durch die ost-europäischen Revolutionen – eine Neueinschätzung des amerikanischen Verhältnisses zur UdSSR. Moskau wird nicht mehr als Repräsentant einer antagonistischen Ideologie angesehen dessen Macht eingehegt werden muß. Vielmehr begann sich ein differenzierteres, obgleich noch nicht endgültig fixiertes Bild zu formen. Es setzt sich aus drei Teilen zusammen:
1. In Europa bleibt die Sowjetunion die Hauptquelle der Unsicherheit – wegen innenpolitischer Probleme – und der potentielle Gegner, aufgrund ihres verbleibenden konventionellen und atomaren Militärpotentials. Das Ziel Stabilität jedoch diktiert die Integration der UdSSR in die europäische Sicherheitsstruktur und die Bush-Administration ist bemüht, die prekäre Lage beispielsweise im Baltikum nicht unnötig zu komplizieren21.
2. Außerhalb Europas hat die UdSSR aufgehört eine Supermacht zu sein. Ihre Fähigkeit der machtvollen Einflußnahme in unterschiedlichen Weltregionen ist zusammengeschmolzen, so daß ihr Rivalitätspotential gegenwärtig als gering eingeschätzt werden kann22. Langfristig bzw. aktuell-militärisch, wird der Kreml allerdings auch weiterhin als Konkurrenz gesehen23.
3. Um das fortexistierende Konfliktpotential zu isolieren, soll die Sowjetunion ökonomisch und politisch in eine neue Weltordnung integriert werden24. Diese Partnerschaft für weltweite Stabilität wurde im Golfkrieg getestet und soll durch Ausbau der Interdependenz25 in Zukunft verhindern, daß ein machtpolitischer Antagonismus neu entsteht.
Immer schwankend zwischen dem Willen, neue Möglichkeiten zu nutzen und alt-neues Konfliktpotential zu minimieren, hofft Washington einerseits auf die Zentralregierung Präsident Gorbatschows, da diese am ehesten in der Lage zu sein scheint, ein Minimum an Berechenbarkeit und Stabilität zu garantieren.
Die neue Rolle Deutschlands
Andererseits benötigt Bush für seine Politik aber auch ein oder mehrere solide Partnerländer in der Region Europa, um hierdurch genügend Einfluß auf die weitere Gestaltung der Beziehungen zu behalten. Diese Funktion, so scheint es, ist im Zuge der Vereinigung dem neuen, jetzt souveränen Deutschland zugedacht. Zwar wurden vereinzelt Ängste vor einem »4.Reich« bzw. vor der „Germanisierung Zentraleuropas“ 26 artikuliert, aber diese waren nicht bestimmend für die Politik des Weißen Hauses. Auch andere Traditionalisten machten sich ein falsches Bild der Entwicklungen in Europa, wenn sie meinten, die Rückkehr zur »Normalität« bedeute die Wiedererstehung einer anarchischen Gesellschaft unabhängiger Nationalstaaten. Da alle Akteure nach den überkommenen Insignien der Macht(politik) streben, wolle auch Deutschland über kurz oder lang eigene Atomwaffen. Die beste Politik der USA wäre es demnach, den unausweichlichen Proliferationsprozeß zu steuern. Wenn möglich solle nur die Bundesrepublik neue eigene Nuklearsysteme erhalten27.
Die Vorstellungen von denen sich Bush und Baker leiten ließen, waren demgegenüber realistischer. Sie analysierten, daß das vereinigte Deutschland nicht länger ein Frontstaat des Kalten Krieges sein könne, sondern eine Schlüsselmacht in der Region Europa werden würde28. Das wirtschaftliche Potential der Bundesrepublik macht sie zu einem natürlichen Hauptverbündeten der USA bei der Neustrukturierung der europäischen Verhältnisse, nicht zuletzt weil wirtschaftliche Kraft immer mehr zu einer entscheidenden Machtressource wird. So sprach Präsident Bush bereits 1989 in Mainz von „Partnern in der Führung“ 29, was er zwar zum damaligen Zeitpunkt nicht näher ausführte, später jedoch immer eindeutiger als Komplementärfunktion Deutschlands im Rahmen der neuen amerikanischen Regionalpolitik deutete. „Die eine, wichtigste neue Realität ist die veränderte Machtbalance zwischen den zwei Staaten und ihre neugefundene Perzeption dieses Gleichgewichts. Die Bundesrepublik ist stärker geworden und die Vereinigten Staaten weniger dominant“ 30.
Im geographischen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum Europas gelegen, soll der Bundesrepublik die entscheidende Rolle bei der Neuordnung des Alten Kontinents zukommen31, während die USA die Stabilität des globalen Systems sichern. Rhetorik auf beiden Seiten des Atlantiks über die gestiegene Verantwortung Deutschlands in der Welt bezog sich auf diese neue Arbeitsteilung, verdeckte aber zugleich die politischen Grenzen der Zusammenarbeit. Diese sollten erst durch den Golfkrieg offenbar werden, als Friktionen zwischen dem deutsch-beeinflußten Kontinentalsystem und der anglo-amerikanischen Weltordnung32 auftraten. Hatten VertreterInnen der amerikanischen Regierung die Partnerschaft als neue geopolitische Rolle der Bundesrepublik mißdeutet, so belegte die zögerliche Politik der Bundesregierung und die machtpolitischen Einschränkungen des Grundgesetzes, daß die Reichweite bundesdeutscher Gestaltungsmacht auch weiterhin auf die Region Europa begrenzt sein würde.
Multilaterale Hegemonie
Im Gefolge des Golfkrieges schienen die USA für viele erneut als »Weltpolizist«. Die Aussagen von Präsident Bush zur Neuen Weltordnung wurden als neuer Hegemonialanspruch mißverstanden. Eine genauere Auswertung der amerikanischen Politik bestätigt aber weder die republikanischen InterventionistInnen noch rechte und linke IsolationistInnen: Die Bush-Administration suchte bewußt die Kooperation unter dem Dach der Vereinten Nationen, um ihren militärischen Einsatz mit den begrenzten Haushaltsmitteln in Einklang zu bringen. Der Krieg war keine Demonstration amerikanischer Weltherrschaft, sondern der technologischen Überlegenheit von Industriestaaten gegenüber den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Der Begriff multilaterale Hegemonie beschreibt die amerikanische Politik wohl treffender als die diffusen anti-amerikanischen Ängste einiger KritikerInnen. Als Instrument einer solchen Interventionsfähigkeit der »Ersten Welt« gegenüber den Entwicklungsstaaten soll die Nato dienen, indem sie in Europa die Sicherheitsordnung »nach Jalta« politisch prägt und ihre militärische Macht in andere Regionen der Welt projeziert.
Der bislang auch in der Bundesrepublik vorherrschende Niedergangsdiskurs trägt zum Verständnis dieser Entwicklungen denkbar wenig bei. Die Entscheidungseliten in Washington und Berlin/Bonn sind da schon weiter.
Literatur
Baker, James A., Adress to the Berlin Press Club, Transcript 12.12.1989.
Bush, George, Declares Berlin Wall „Must Come Down“, Speech in Rheingoldhalle, U.S. Policy Information and Texts, 1.6.1989, S.1ff.
Cooney, Stephen, The Impact of Europe 1992 on the United States, in: Wessell, Nils H. (ed.): The New Europe. Revolution in East-West Relations, The Academy of Political Science, New York 1991, S.100ff.
Crist, Gen. George B., A U.S. Military Strategy For A Changing World, Strategic Review, Winter 1990, S.16ff.
Etzold, Thomas H., The Strategic Environment of the Twenty-First Century: Alternative Futures for Strategic Planners, Strategic Review, Spring 1990, S.23ff.
Hunter, Robert E. The Future of European Security, The Washington Quarterly, Autumn 1990, S.55ff.
Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, New York, Januar 1989.
Keohane, Robert O./Nye, Joseph S., Power and Interdependence, Boston 1989.
Krauthammer, Charles, The German Revival, The New Republic, 26.3.1990, S.18ff.
Krauthammer, Charles, The Unipolar Moment, Foreign Affairs 1/1991, S.23ff.
Layne, Christopher, Superpower Disengagement, Foreign Policy, Winter 1989/90, S.17ff.
Mead, Walter Russell, American Grand Strategy After the Cold War, World Policy Journal, Winter 1989/90, S.35ff.
Mead, Walter Russell, Coming to Terms with the New Germany, World Policy Journal, Fall 1990, S.593ff.
Mearsheimer, John J., Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War, International Security, Summer 1990, S.5ff.
Mueller, John, A New Concert of Europe, Foreign Policy Winter 1989/90, S.3ff.
Nye, Joseph S., Die Debatte über den Niedergang der Vereinigten Staaten, Europa Archiv, 25.7.1990, S.421ff.
Ravenal Earl C., The Case for Adjustment, Foreign Policy, Winter 1990/91, S.3ff.
Scrowcroft, Brent, Die Vereinigten Staaten bleiben eine europäische Macht, Europäische Wehrkunde/WWR, 3/90, S.155ff.
Smyser, W.R., Restive Partners: West Germany and the United States Face a New Era, The Washington Quarterly, Winter 1990, S.17ff.
Stinnes, Manfred, Die amerikanische Europa-Politik und die Ost-West-Beziehungen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 3.11.1989, S.14ff.
Taft, William, Rede vor dem International Institute for Strategic Studies am 8.2.1991, Amerika-Dienst, 13.2.1991.
Ward, George F., Herausforderungen für die Deutsch-Amerikanischen Beziehungen in den Neunziger Jahren, Ansprache bei der Amerikanischen Handelskammer in Stuttgart am 26.2.1991, Amerika-Dienst, 27.2.1991.
* Das Manuskript wurde vor den neueren Entwicklungen in der UdSSR und vor der Bush-Abrüstungsinitiative verfasst. Die Grundaussagen sind dennoch weiterhin gültig.
Anmerkungen
3) Keohane/Nye, 1989:18. Zurück
8) Krauthammer, 1991:32f. Zurück
11) Scrowcroft, 1990:156. Zurück
13) Nunn, in: „Im Senat wird der Ruf nach Truppenabbau lauter“, Süddeutsche Zeitung, 21./22.4.1990.. Zurück
14) v.a. an die Nato; vgl. Taft, 1991:3. Zurück
15) in: Baker, 1989:37. Zurück
16) vergleiche hierzu die amerikanische Regionalpolitik und die Rolle des Irak nach der Machtergreifung Khomeinis im Iran. Zurück
19) Frankfurter Rundschau 26.2.1991. Zurück
20) Als Beleg möge man sich die Kongreßdebatten und -hearings zum Thema Golfkrieg ansehen. Dort werden sowohl der Konsens als auch abweichende Minderheitspositionen deutlich. Zurück
21) vgl. Bush, in: Stinnes, 1989:21. Zurück
22) Mueller, 1989/90:99. Zurück
25) Als Instrumente sind v.a. die Vereinten Nationen und die weltwirtschaftlichen Gremien (z.B. G7) zu nennen. Zurück
26) Krauthammer, 1990:18. Zurück
27) Mearsheimer, 1990:8. Zurück
Lothar Gutjahr ist Mitarbeiter am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH).