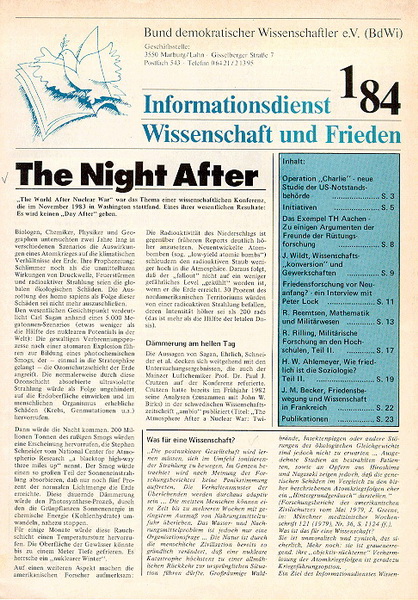Friedensforschung vor Neuanfang?
Interview mit Peter Lock
von Peter Lock und Redaktion
Über die Situation der Friedens- und Konfliktforschung nach der Auflösung der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung (DGFK) und über die Perspektiven sprachen wir mit Peter Lock.
Unter dem Schlagwort von der „politisch einseitigen“ Friedens- und Konfliktforschung (im folgenden FuK abgekürzt) wurde die DGFK auf Betreiben konservativer Kräfte, vor allem in der CDU/CSU aufgelöst. Ist dieses hoffnungsvolle Kind der Entspannungsära damit bereits tot?
Der Prozeß, mit dem die FuK durch die Schließung der DGFK voll getroffen wird, hat eine längere Vorgeschichte. Die Konservativen in der Bundesrepublik haben seit der Geburtsstunde dieser Disziplin unter dem damaligen Bundespräsidenten Heinemann Kritik an der Heraushebung dieser Problemstellung geübt. Spätestens 1975 wurde der politische Druck verstärkt: Von der FuK wurden politiknahe, umsetzbare Ergebnisse gefordert. Die Förderungsgremien wurden verschiedentlich umgebaut, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Hatte die Friedensforschung denn ein gestörtes Verhältnis zur „politischen Praxis“?
Die DGFK hat immer wieder versucht, in den Dialog mit den sog. Praktikern zu kommen. Dieser Dialog war aber faktisch nichts anderes als eine Belehrung der politischen Praxis gegenüber der Forschung. Das Bundesaußenministerium, in einigen Fällen sogar das Verteidigungsministerium - haben gegenüber Friedensforschern doziert, auf deren angeblich falsche Meinung hingewiesen und sie auf offizielle Politikparadigmen festlegen wollen. Also auch auf den Nato Doppelbeschluß. Die FuK hat sich diesen Forderungen relativ weitgehend angepaßt.
Waren die Schwächen der FuK also eher inhaltlich-konzeptioneller Natur?
Erstens ist zu bedenken: Die Friedensforschung wurde vorzugsweise von jüngeren Wissenschaftlern betrieben, die in einer transitorischen Phase ihrer beruflichen Qualifikation mit dieser Thematik befaßt waren. Dies korrespondierte mit der Stellenstruktur der FuK: Seit ihrem Bestehen war sie durch Ein- bis Zwei-Jahresprojekte geprägt. Deren Zusammenfassung unter dem Dach der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HSFFK) und dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) an der Universität Hamburg hat den falschen Eindruck aufkommen lassen, als sei bereits ein leistungsfähiger Forschungszweig entstanden. Daß diese, auf kurzfristige Mittelvergabe orientierte Struktur Anpassungsprozesse bei den Forschern begünstigte, liegt auf der Hand.
Zweitens muß man sich veranschaulichen, daß es eine eigenständige Disziplin „Friedens- und Konfliktforschung“ in der Wissenschaftssystematik eigentlich nur als Ideologiekritik an der bestehenden wissenschaftlichen Arbeitsteilung geben kann. Ihre Initiierung war eine offene Kritik an der Unfähigkeit der bestehenden Universitätsstruktur, sich adäquat mit Problemen der internationalen Beziehungen und Konfliktlösungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Dieses Versagen gerade der sozialwissenschaftlichen Disziplinen konnte die FuK - und kann sie nicht kompensieren. Sie war sich in weiten Teilen dieses Problems nicht mal bewußt.
Drittens hat „politikfähig“ zu werden für relevante Teile der FuK bedeutet, sich an den Auseinandersetzungen der politischen und militärischen Expertenhierarchie zu orientieren.
Von daher erklärt sich die Kluft zur Friedensbewegung. Diese hat Fragen aufgeworfen, die weit über den Horizont der institutionalisierten Friedensforschung hinausreichten.
Das hört sich fast so an. als habe die FuK ihr jetziges „Schicksal“ verdient. Bedeutet die geplante Umstrukturierung, sprich die Vergabe der Fördermittel über die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) denn keinen Einschnitt?
Diese Umstrukturierung symbolisiert zunächst einmal den vollendeten Racheakt der etablierten Universitätsforschung. Ihr war es von Anfang an ein Dorn im Auge, daß aufgrund einer politischen Setzung von Gustav Heinemann eine Forschungsinfrastruktur geschaffen wurde, die nicht vollständig der Ideologie der Interessenfreiheit - von der Professoren meinen, daß sie in der DFG herrsche - entsprach. Der Einfluß der DFG auf die Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung ist in den letzten Jahren immer mehr erweitert worden, und zuletzt war die Mittelvergabe dein DFG-Standard angepaßt. Dies drückte sich auch darin aus, dank die Förderungskommission mehrheitlich aus Personen bestand, die von der DFG oder den verschiedenen Ministerien benannt worden waren. Wir sind gewissermaßen am Ende dieses Prozesses angekommen. Nichtsdestotrotz bedeutet die jetzt herbeigeführte Situation, daß ein extrem konservativer Umschwung in der FuK zu befürchten ist.
Haben die Betreiber der „politischen Wende“ denn ein forschungspolitisches Konzept für diesen Bereich. Oder sehen Sie sich angesichts der zunehmenden „Akzeptanzkrise“ ihrer Sicherheitspolitik nur unter dem Druck, ihre praktische Politik besser verkaufen zu müssen?
Ich glaube, man sitzt hier eher der Illusion auf, daß man an den Status quo ante anknüpfen könne und daß politische Praxis auf Regierungsebene und sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen der Sicherheitspolitik, der internationalen Beziehungen usw. ohne Bruch zusammenkommen könnten. Daß Außenseiter wie Biedenkopf, der ja das Paradigma der Abschreckung jüngst für überprüfungswürdig erklärte, etwas weitergehende forschungspolitische Überlegungen vertreten, ist nicht auszuschließen. Insgesamt gilt: Auch wenn die wissenschaftlichen Repräsentanten der Regierungslinie natürlich stärker an den DFG-Mitteln partizipieren sollten der herrschaftskritische Impuls der ursprünglichen Friedensforschung, der durch die Friedensbewegung ungemein belebt worden ist, ist nicht mehr zu tilgen.
Hat die Sozialdemokratie noch ein eigenes Konzept für die FuK?
Die ländergestützten Institutionen, wie die Hessische Stiftung oder das Hamburger Institut arbeiten weiter. Das Land Hamburg hat sogar angekündigt, das hiesige Institut mit zusätzlichen Stellen zu versehen. Offensichtlich begreift die SPD die Verteidigung dieser regionalen Einrichtungen als Teil ihrer Identitätswahrung. Dies hat aber auch damit zu tun, daß der Sozialdemokratie durch den Regierungsverlust im Bund wichtige Politikberatungsinstanzen verlorengegangen sind. Dieser Beratungsbedarf muß aber abgedeckt werden.
Haben wir es de zufolge mit einer ausschließlich parteipolitischen Ausrichtung der FuK zu tun?
Im Moment scheint es im sozialdemokratischen Umfeld so zu sein, daß die neue Rolle als Opposition unendliche Freiräume des Neuformulierens von Paradigmen läßt. Das wird sich mit der zeitlichen Nähe zur nächsten Wahl und der Notwendigkeit, Positionen zu beziehen, meiner Meinung nach ändern. Es bleibt zu hoffen, daß die wissenschaftliche Substanz darunter nicht leiden wird.
Hat denn die Friedensbewegung noch etwas von der Friedensforschung zu erwarten. Auf welchen Feldern könnte die „professionals“ beratend tätig werden?
Der Nutzen der FuK wird weiterhin nur marginal sein. Sicherlich hat die Friedensforschung, in der Gestalt von Einzelpersönlichkeiten allerdings, dazu beigetragen, der Friedensbewegung methodisch den Weg zu öffnen: Sie hat know how vermittelt, wie man sich mit dem vormals tabuisierten Rüstungssektor und militärischen Doktrinen auseinandersetzen kann. Inzwischen hat die Friedensbewegung selbst soviel an Erfahrung gesammelt, an Expertise angehäuft, daß mir in dieser Hinsicht nicht bange ist. Und dieses Potential läßt sich im Gegensatz zur FuK nicht durch eine politische Entscheidung rückgängig machen.
Möglicherweise kann ein Beitrag einzelner Friedensforscher auch darin liegen, durch Kritik an taktischen Fehlern in der Argumentation der Friedensbewegung die Diskussion qualifizieren zu helfen.
Was ist in diesem Zusammenhang von den Vorschlägen mancher Friedensforscher wie J. Galtung zu halten; von den Überlegungen zur Änderung des Nato-Konzepts, zur Umrüstung der Bundesrepublik auf Defensivwaffen?
Man sollte darin zwei Seiten erkennen. Auf diesem Feld können sich Friedensbewegung und -forschung näherkommen. Denn hier kann sich etwas entwickeln, was in angelsächsischen Ländern „strategic community“, also eine strategische Debatte genannt wird. Hierzulande immer stigmatisiert und innerhalb der Abschreckungsideologie immer an die Nuklearmacht USA delegiert, eröffnet die Diskussion um defensive Strategien für uns Deutsche neue Möglichkeiten, uns einzuschalten. Diese Debatte um neue Modelle nationaler oder auch europäischer Sicherheit ist daher nützlich. Ich fürchte andererseits, daß sie sich verselbständigen könnte. Relativ technokratische bzw. voluntaristische Modelle, die nur falsche Hoffnungen wecken und daher letztlich Engagement lähmen können, helfen nicht weiter.
Die Friedensbewegung hat eine sehr wichtige Ausprägung unter den Wissenschaftlern erfahren. Ich denke hierbei an die berufs- bzw. fachspezifischen Initiativen und an den interdisziplinären Dialog über Friedens- und Abrüstungsfragen, der an den meisten Hochschulen inzwischen in Gang gekommen ist. Dieser „Aufbruch“ unter der Universitätsintelligenz steht in keinem Bezug zur institutionellen FuK. Kann man diese beiden Bereiche zusammenbringen?
Ich glaube nicht, daß man das zusammenbringen kann. Einzelne Personen der FuK können helfen und beratend tätig werden, den nötigen Forschungsprozeß erleichtern. Die Hauptarbeit muß arbeitsteilig und interdisziplinär von den Wissenschaftlerinitiativen geleistet werden. Gerade deren Entwicklung verkörpert für mich ansatzweise die Aufhebung des weiter oben erwähnten Widerspruchs: Friedensforschung kann im Grunde nicht als aparte, selbstisolierte Teildisziplin existieren. Die Orientierung der universitären Fachrichtungen wie Medizin, Physik etc. auf die Auseinandersetzung um die Fragen des menschlichen Überlebens und auf Beiträge zur friedlichen Konfliktlösung zwischen den Völkern ist entscheidend. Nur wenn für ein forschungspolitischer Bedarf formuliert und an den Hochschulen eingefordert wird, kann sich eine Dynamik ergeben, die zu einer wirklich substantiierten Friedens- und Konfliktforschung führen wird. Der Anfang dazu ist gemacht.
Wir danken für dieses Gespräch.
Peter Lock ist Assistent am Institut für Politische Wissenschaften an der Universität Hamburg, hat sich seit längerem an Projekten der Friedensforschung beteiligt und zu diesem Thema mehrere Arbeiten publiziert.