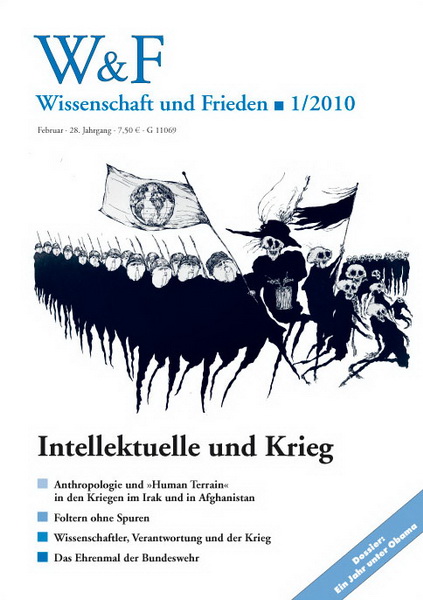Gedanken zur Entwicklung eines Forschungsprogramms
von Elizabeth Dauphinee
Mein Doktorand und ich sitzen in meinem Büro und trinken schwarzen Tee, während die Morgensonne durch die Jalousie dringt. So haben wir bereits mehrere Tage verbracht. Wir diskutieren einen Vortrag, an dem wir für eine Konferenz im April an der Universität von Illinois arbeiten, zu der wir eingeladen wurden.
Unser Ziel ist es, die aktuelle Beziehung zwischen dem türkischen Staat und seiner alevitischen Bevölkerung zu untersuchen und die historischen und politischen Bedingungen zu verstehen, die zu staatlich unterstützter Gewalt gegen die Aleviten geführt haben. Bislang haben wir versucht, mehr über die diskursiven Mechanismen in Erfahrung zu bringen, durch die der Staat versucht, die ihn konstituierenden Bevölkerungsgruppen fassen zu können.1 Wir theoretisieren diesen Zusammenhang mit Hilfe eines biopolitischen Ansatzes, weil dies das Thema der Konferenz in Illinois ist und weil ich als Expertin zum Thema Biopolitik gelte. Allerdings bin ich keine Türkeiexpertin und ich weiß so gut wie nichts über die Aleviten und das Alevitentum. Ich hätte mich auch nicht mit der Türkei beschäftigt, wenn ich nicht die Betreuung eines Doktoranden aus Istanbul mit Interesse an Fragen von Nationalismus und Identität übertragen bekommen hätte. In diesem Sinne war es also Zufall.
Schon im Normalfall sehe ich mich gerne als kaum meines akademischen Postens würdig, aber je mehr ich über die Aleviten lese, desto verwirrter werde ich. Die Aleviten, soweit ich das verstanden habe, verweigern sich den Kategorien, die gewöhnlich zur Klassifizierung »nationaler Minderheiten« verwandt werden. Sie sind weder eine ethnische noch sprachliche Gruppe, da viele von ihnen TürkInnen sind. Genau genommen sind sie auch keine religiöse Minderheit, weil viele Aleviten sich als Muslime verstehen - und auch von anderen so gesehen werden. Obwohl viele von ihnen historisch zur politischen Linken gehören2, können sie auch nicht als politische Minderheit angesehen werden.
Mein Doktorand besorgt mir Aufsätze und Bücher zur Lektüre und je mehr ich lese, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ein Problem hinsichtlich der staatlichen Fähigkeit existiert, mit dieser Bevölkerungsgruppe zu interagieren, weil diese nicht in die Kategorien passt, die normalerweise mit der Identität nationaler Minderheiten assoziiert werden. Das ist kein besonders neuer Gedanke, aber ich bin überheblich genug anzunehmen, dass, wenn ich nach Monaten des Lesens und Diskutierens beim Tee Trinken die Aleviten nicht verstehen kann, die Türkei es auch nicht vermag.
Unsere wichtigste Kritik am türkischen Staat richtet sich also auf seine wiederholten Versuche, die Aleviten und das Alevitentum fassbar zu machen. Aber auch wenn ich die Versuche des türkischen Staats kritisiere, die Aleviten zu kategorisieren, so bin ich mir bewusst, dass ich ebenso versuche, die Aleviten für mich selbst fassbar zu machen, damit ich die Forschung durchführen und so schreiben kann, wie es im Kontext meiner Disziplin sinnvoll ist. Und daher bleibt Gewalt auch dann Gewalt, wenn sie in diesem Zusammenhang relativ ist.3
Die Standortgebundenheit der Forschenden
In der Disziplin der Internationalen Beziehungen gibt es ein zunehmendes Bewusstsein darüber, dass die Art und Weise, wie WissenschaftlerInnen sich entscheiden über ihren Gegenstand zu schreiben, von großer Bedeutung dafür ist, wie dieses Thema rezipiert und entfaltet wird. Das hat nicht nur mit Bedenken hinsichtlich politischer Entscheidungen zu tun, sondern auch mit dem Stellenwert der Sozialwissenschaften bei der Produktion dessen, was in der Universität und darüber hinaus als Wissen gilt.4 Mit anderen Worten:
Wie wir uns selbst in unsere Forschung einschreiben, wirkt sich auf das Ergebnis der Forschung aus, und die Beziehung zwischen den Sozialwissenschaften und den Welten, die sie beanspruchen zu deuten, ist niemals neutral - niemals ohne politisches oder ethisches Bekenntnis. Schon R.B.J. Walker hat vor 15 Jahren darauf verwiesen, dass jeder Ansatz der Untersuchung internationaler Politik eine ethische Orientierung hat - unabhängig davon, ob dies explizit in der Literatur ausgewiesen ist.5 Eine solche explizite Sichtbarmachung ist jedoch von entscheidender Bedeutung für die kontinuierliche Entwicklung reflexiver Forschung über Konflikte und Kriege.
Nach dem Tee wendet sich mein Doktorand der Interpretation einer Dokumentation über die Zerstörung der türkischen Provinz Dersim während der Rebellion von Dersim (1937-38) zu.6 Er möchte mir helfen zu verstehen, wie die KurdInnen und AlevitInnen in Dersim als Problem für den nach Homogenität trachtenden türkischen Nationalstaat identifiziert wurden. Studierende betreten und verlassen die Halle, während wir vor meinem Computer sitzen. Mein Doktorand übersetzt die Dokumentation in Echtzeit. Ich bewundere ihn dafür, denn es ist keine leichte Aufgabe und Englisch ist seine dritte oder vierte Sprache. Gelegentlich bittet er mich, die Aufnahme anzuhalten, damit er den Kontext und die Geschichte der Rebellion, wie sie die Dokumentation darstellt, genauer erläutern kann. Er macht das sorgfältig und methodisch. Auf meinem Bildschirm erinnern sich alte Männer mit feuchten Augen an die Massaker, deren Zeugen sie als kleine Jungen geworden waren. Historiker und Professoren angesehener Universitäten in Ankara und Istanbul diskutieren die Entwicklung des türkischen Nationalismus in den 1920er und 1930er Jahren und den verheerenden Einfluss der Politik der Staatsbildung auf die kurdischen und alevitischen Bevölkerungen. Mein Doktorand übersetzt: Dokumente, die die langjährigen Regierungspläne zur Pazifizierung Dersims bezeugen, werden zum Vorschein gebracht. Von der Politik der zwangsweisen Deportation und Assimilation, bis hin zur Hinrichtung und Inhaftierung kurdischer Intellektueller und dem Verbot der kurdischen Sprache - alles wird mit sorgfältiger Präzision ausführlich beschrieben. Mein Doktorand übersetzt bemerkenswert flüssig. Vierzig Minuten verstreichen. Die Dokumentation wendet sich der Geschichte von Seyit Riza zu, einem prominenten geistigen und politischen kurdisch-alevitischen Führer in Dersim. Ein düsteres Schwarz-Weiß-Porträt von Riza wird gezeigt, der der Dokumentation zufolge den Kontakt zum britischen Außenminister Anthony Eden suchte, um die Notlage der KurdInnen und AlevitInnen in Dersim in Europa bekannt zu machen. Seyit Riza wurde im September 1937 von der türkischen Armee festgenommen. Zeugen sagten aus, das er lediglich darum bat, früher als sein Sohn gehängt zu werden, aber sie hängten seinen Sohn in seiner Sichtweite auf. Plötzlich hält mein Doktorand mit der Übersetzung inne. Die Dokumentation fährt in türkischer Sprache fort. Die Momente verrinnen. Ich sehe auf und sehe ihn an. Seine Augen sind voller Tränen. Er schluckt und kämpft mit sich selbst. Ich habe das Gefühl, etwas tun zu müssen. Ich will aufstehen und meine Arme um ihn legen, aber ich bin paralysiert. Die Universität, das habe ich gelernt, ist kein Ort für so etwas. Noch lange danach habe ich darüber nachgedacht, dass ich in meiner kurzen Karriere die Konventionen sozialwissenschaftlichen Schreibens angegriffen habe, und doch nicht fähig bin, die Regeln, die meine beruflichen Beziehungen ordnen, zu verletzen, wenn es darauf ankommt.
Leidenschaft und Beziehungen
Virginia Dominguez vertritt die Position, dass „es wichtig ist, dass wir der Frage der An- bzw. Abwesenheit von Leidenschaft und Zuneigung in unserer Wissenschaft Bedeutung zumessen - und zwar in allen Phasen der Produktion unserer wissenschaftlichen Arbeit. Wenn es die nicht gibt, müssen wir uns nach den Gründen fragen und überlegen, was wir tun können. Wenn sie da sind, sind wir gegenüber unseren LeserInnen in der Schuld, diese zu zeigen, damit sie deren Bedeutung für unsere Forschungen ermessen können.“ 7 Das heißt nicht, dass das Vorhandensein von Leidenschaft in unserem Forschen dieses gegen Kritik immunisieren würde; es ist auch nicht so, dass es gewaltlos wäre gegenüber dem, was es zu verstehen behauptet. Aber es geht darum zu sagen, wie und warum wir dazu angeregt wurden das zu schreiben, was wir schreiben - darum, uns dem Urteil anderer nicht nur hinsichtlich des Inhalts unserer Wissenschaft zu stellen, sondern auch mit Blick auf die politischen, ethischen und persönlichen Bindungen, die unser Denken beleben. Zugleich gibt es nichts inhärent Reflexives bezüglich unserer Versuche, uns selbst in unsere Arbeiten einzuschreiben, es sei denn, wir stellen genau jene Interessen in Frage, die die Relationalitäten betreffen.8 Unsere Forschung und unser Schreiben werden immer und zwingend durch Interaktionen mit anderen und unsere Bemühungen um andere sowie durch deren Anregungen bestimmt. Unser Denken ist immer bedingt durch andere, mit denen wir die intellektuelle und die persönliche Sphäre teilen; das ist notwendig so. Es kann kein Versuch gelingen, in der Forschung und im Schreiben vollständige Autonomie zu praktizieren. Allerdings kann nicht einmal meine Offenbarung, dass meine Forschung und mein Schreiben von den Beziehungen zu anderen abhängen, diese Verhältnisse oder ihren Einfluss auf mich jemals erschöpfend darstellen.9 Judith Butler räsoniert, dass die Notwendigkeit, die Art und Weise in Frage zu stellen, mit der wir selbst zu unseren »Wahrheiten« kommen, von dem „Wunsch andere anzuerkennen oder von jemand anderem anerkannt zu werden“ 10 herrührt. Aber selbst diese Enthüllung verrät genau so wenig eine »Wahrheit« wie menschliche Nacktheit. In diesem Sinne besteht die einzige »Wahrheit«, die formuliert werden kann, darin, dass unsere Ansichten - und damit unsere Versuche sowohl uns selbst als auch unseren Untersuchungsgegenstand sichtbar zu machen - immer nur partiell und situativ sind. So merkt Wanda Vrasti an: „Die soziale Welt ist kein Labor, über das man berichten kann, ohne Teil von ihm zu werden.“ 11
WissenschaftlerInnen - und insbesondere jene, die zu Fragen von Konflikt und Krieg arbeiten - können nicht beanspruchen, eine abstrakte und objektive Position gegenüber ihrem Forschungsgegenstand einzunehmen. Wir beteiligen uns. Manchmal machen wir das unbeabsichtigt, also sogar ohne es zu wollen. Und indem wir das machen, sind wir verpflichtet uns Rechenschaft abzulegen. Die Gründe, aus denen wir mit dem Forschen und Publizieren beginnen (zum Beispiel weil wir eingeladen wurden, einen Vortrag an der University of Illinois zu halten), sind gewöhnlich nicht die, nach denen wir unsere Arbeit weiterentwickeln (zum Beispiel ist mein Doktorand am Alevitentum interessiert), und sie sind auch nicht die Gründe, wie wir mit der Arbeit fortfahren (zum Beispiel beeinflusste mein Doktorand meine Überlegungen, ohne dass ich das beabsichtigt hatte).
Reflektion der Motive
Clifford Geertz hat im Jahr 1988 in einem Beitrag geschrieben, dass in der Ethnologie „explizite Darstellungen der Gegenwart des Autors - wie andere Peinlichkeiten - in Vorworte, Anmerkungen oder Anhänge verbannt werden.“ 12 In den Forschungen zur internationalen Politik ist das noch besonders stark. Obwohl zunehmend anerkannt wird, dass es keine neutrale Forschung gibt, bekennen wir uns weder zu unserer Leidenschaft zu bzw. unsere Verwicklung in unseren Untersuchungsgegenstand noch zu denjenigen, die uns helfen, unsere Überlegungen weiter zu entwickeln und uns zu orientieren. Wir sprechen nicht über unsere Motive. Gewöhnlich werden wir nicht dazu ermutigt, sie anzuzweifeln. Dabei sind doch wichtige Teile unserer Motivation immer durch Persönliches bestimmt. Ob wir diese persönlichen Aspekte anerkennen oder nicht, sie beeinflussen notwendig und signifikant Tenor, Form und Inhalt unseres Schreibens. Das Persönliche treibt unsere Forschungen auf eine Art an, um deren Verständnis wir noch kämpfen müssen und die wir noch selten zugeben. Hier geht es um die Beziehung zwischen Leidenschaft und Wissenschaft, zwischen Zuwendung und Schreiben.13 Was regt unsere Passion für unsere Forschung an? Ebenso wichtig: Was wird aus uns, wenn wir uns nicht auf unsere Arbeit einlassen und sie lieben jenseits der beruflichen Auszeichnungen, die uns erwarten? Das ist weniger eine Frage der »Liebe zur eigenen Arbeit«, als vielmehr danach, wie Leidenschaft uns so motiviert und verändert, dass unsere Arbeit, die wir in unseren Disziplinen und beruflichen Kontexten leisten, ausgerechnet dadurch bestimmt wird, dass wir täglich leidenschaftlich die Leidenschaft verleugnen.
Hier folge ich Roxanne Doty, die schreibt, ohne das Persönliche „mögen wir mit unserem Fachwissen als AutorInnen den LeserInnen Illusionen von Wahrheit vermitteln, aber oft sind wir die scheußlichen Wesen, die hinter der Berufskleidung verschwinden, die Dummköpfe im fluoreszierenden Schein unserer Paradigmen und Theorien, die gefräßig unsere Gedanken konsumieren, aus unseren Worten die Seele hinausdrängen und unsere Stimme von allen Spuren der Humanität reinigen.“ 14 Um es klar zu sagen: Doty geht es nicht darum, die »Seele« oder »Humanität« auf eine besondere Art zu re-präsentieren, sondern darauf hinzuweisen, dass wir ihre Bedeutung für unser Berufsleben »ent-präsentieren« und verleugnen, weil wir das Persönliche vom Beruflichen - und mit wenigen Ausnahmen: das Berufliche vom Politischen - abgetrennt haben.
Forschung zu Gewalt und Krieg ist allgegenwärtig. Sie ist auch eine der ethisch gefährlichsten Felder der Forschung und des Publizierens, weil die Gewalt des Forschenden im Verlaufe der Forschung niemals so sichtbar oder verwerflich ist wie die Gewalt, die den Untersuchungsgegenstand bildet - wie etwa die türkische Pazifizierung und Assimilation der Bevölkerung von Dersim in den Jahren 1937-1938. David Campbell hat dies in seinem Buch »National Deconstruction« deutlich gemacht. Für ihn haben die wissenschaftlichen Interventionen zum »Problem« Bosnien dazu beigetragen, ein spezifisches Wissen darüber zu erschaffen, was in Bosnien geschehen ist, nämlich eine Lesart, der zufolge Krieg und Gewalt als das natürliche Ergebnis spezifischer Formen von Identität erscheinen.15 Nichts davon war aber natürlich oder zwingend, sondern statt dessen ein Ergebnis der Art und Weise, wie Identitäten verstanden und legitimiert werden. Das ist nicht nur problematisch hinsichtlich der Legitimierung von Gewalt in der »realen« Welt, sondern auch hinsichtlich der Art, in der wir forschen und für welche Zwecke wir das tun. Wenn wir nicht offen bezüglich unserer Anliegen und Interessen in diesen und folgenden Momenten sind, dann verbergen wir die Aspekte, die zu einem besseren Verständnis unserer Forschung und seines Nutzens beitragen, vor unseren LeserInnen.
Was ist das Wesen unserer Beziehungen zu den Gegenständen unserer Forschung? Wie entwickeln wir Fragen zu Krieg und Gewalt und wie wirken sie auf uns zurück? Wie beeinflusst diese Wechselwirkung die Welten, die unsere Forschung aufzudecken beansprucht? Haben wir eine ethische Verpflichtung mehr zu tun als einfach nur über die Welt zu berichten, die wir glauben (lediglich) zu beobachten? Haben wir eine ethische Verpflichtung, Krieg und andere Formen unterdrückender Gewalt abzulehnen? Ich meine, die Antwort ist Ja.16
Und ich bin überzeugt, dass es mindestens genauso wichtig ist, über die Motive nachzudenken, die in einem ersten Zugriff auf den Gegenstand selbst den Rahmen für die Forschung abgeben. Es ist also nicht einfach nur die Frage, ob Wissenschaft genau oder valide ist, sondern ebenso warum und wie die Forschung auf eine bestimmte Weise angelegt wurde. Das ist - und sollte es auch ausdrücklich bleiben - Teil unserer üblichen Bewertungen jeder sozialwissenschaftlichen Forschung. Es ist auch die Frage danach, wie wir uns entscheiden, auf die Beiträge anderer, denen wir begegnen, zu reagieren; ob wir uns entscheiden, ihre Bekenntnisse anzuerkennen, abzutun oder zu loben und auf welche Art dies geschieht.
Anmerkungen
1) Vgl. beispielsweise Michel Foucault (1997): Society Must Be Defended: Lectures at the College de France. New York: Picador; Michael Dillon & Julian Reid (2009): The Liberal Way of War: Killing to Make Life Live. New York: Routledge; Elizabeth Dauphinee & Cristina Masters (2006): The Logics of Biopower and the War on Terror: Living, Dying, Surviving. New York: Palgrave.
2) Vgl. beispielsweise Ozlem Goner (2005): The Transformation of the Alevi Collective Identity, Cultural Dynamics 17:2, S.107-134; Tahire Erman & Emrah Goker (2000): Alevi Politics in Contemporary Turkey, Middle Eastern Studies 36:4, S.99-118; David Shankland (2003): The Alevis in Turkey: The Emergence of a Secular Islamic Tradition. New York: Routledge.
3) John Caputo (1997) schreibt, dass „es keine echte Gewaltlosigkeit gibt, sondern nur Abstufungen und Haushaltungen der Gewalt, von denen einige ergiebiger sind als andere“, in: Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida. New York: Fordham University Press, S.47.
4) Vgl. beispielsweise J. Marshall Beier (2005): International Relations in Uncommon Places: Indigeneity, Cosmology, and the Limits of International Theory. New York: Palgrave Macmillan; Elizabeth Dauphinee (2007): The Ethics of Researching War: Looking for Bosnia. Manchester: Manchester University Press.
5) RBJ Walker (1993): Inside/Outside: Political Theory as International Relations. Cambridge University Press.
6) Alle hier genannten Angaben zur Pazifizierung von Dersim entstammen: 38: Dersim Katliami Belgeseli, Producer/Director: Çayan Demirel (2006).
7) Virginia R. Dominguez (2000): For A Politics of Love and Rescue, Cultural Anthropology Vol. 15, No. 3, S.361-393 (388).
8) Wanda Vrasti verweist mit Blick auf die Ethnographie auf einen ähnlichen Aspekt, vgl.: The Strange Case of Ethnography and International Relations, Millennium: Journal of International Studies, 37:2, 286.
9) Judith Butler (2005): Giving an Account of Oneself. New York: Fordham University Press. Hier geht es um viel mehr als um die Beziehung, die mit dem System des Zitierens und Referenzierens verbunden ist. Es geht um die Frage, wie unser Denken durch unsere persönlichen Interaktionen mit anderen beeinflusst wird.
10) Butler, op. cit., 24.
11) Vgl. Fußnote 8, S.287.
12) Clifford Geertz (1988): Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford University Press, S.16.
13) Es ist darauf hinzuweisen, dass Liebe nicht die einzige Antriebskraft ist. Wissenschaft ist auch durch Geringschätzung, Spott oder sogar Hass motiviert. Häufig finden sich diese Leidenschaften in ein- und demselben Text.
14) Roxanne Lynn Doty (2004): Maladies of Our Souls: Identity and Voice in the Writing of Academic International Relations, Cambridge Review of International Affairs Vol. 17, No. 2, S.377-392 (378).
15) David Campbell (1998): National Deconstruction: Violence, Identity, and Justice in Bosnia. Minneapolis: University of Minnesota Press.
16) Vgl. Elizabeth Dauphinee (2008): War Crimes and the Ruin of Law, Millennium: Journal of International Studies 37:1, S.49-67.
Dr. Elizabeth Dauphinee lehrt am Department of Political Science an der York University. In ihren Forschungen befasst sie sich vor allem mit Fragen der Ethik in der Internationalen Politik. Ausgehend von der Ethik Emmanuel Levinas' fragt sie nach dem Stellenwert von Liebe, Vergebung und Reue im Zusammenhang mit Konflikten und Postkonflikt-Situationen.