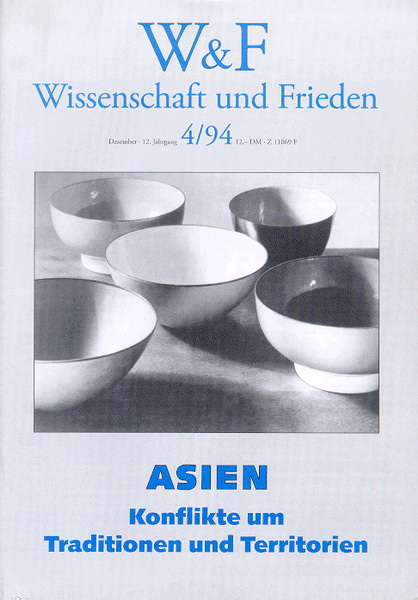Gleichberechtigung und Minderheitenrechte
Widersprüche der liberalen Demokratie in Indien
von Gurpreet Mahajan
Die Philosophie einer liberalen Demokratie, insbesondere die Betonung der Autonomie des einzelnen, inspirierte die erste Welle der Frauenbewegung. Die individualistische Ethik erlaubte es Frauen, soziale Konventionen in Frage zu stellen und gleiche Bürgerrechte zu verlangen. Die Demokratie bot den politischen Raum zur Formulierung dieser Forderungen, die Philosophie des Liberalismus lieferte das begriffliche Instrumentarium für die Forderung nach dem Recht auf eigene Entscheidung und die freie Gestaltung des Lebens entsprechend den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Interessen. Daher bediente sich die Frauenbewegung in ihren frühen Jahren der Ideen der liberalen Demokratie, um bestehende Vorurteile zu hinterfragen und rechtliche Hindernisse zu überwinden, die der Anerkennung der Frauen als freie Individuen und gleichberechtigte Bürgerinnen der Gesellschaft im Wege stehen.
Frauen an der Macht zu beteiligen setzt die Abschaffung des Patriarchats voraus, und eine solche Veränderung in den sozialen Strukturen ist im institutionellen Rahmen einer liberalen Demokratie oder durch den Kampf um Rechte nicht zu herbeizuführen. Die liberale Demokratie kann zwar für eine formale Gleichheit sorgen, doch wird der Gewinn daraus den Frauen innerhalb eines patriarchalischen Systems unter Umständen nicht zugute kommen.
Die liberalen demokratischen Strukturen beinhalten drei Schwierigkeiten:
1) Innerhalb dieser Strukturen müssen Frauen ihre Forderungen an einen Staat richten, der neben seiner Verankerung in patriarchalischen Werten, auch seiner gesamten Orientierung und Politik nach wesentlich »männlich« ist (MacKinnon 1983).
2) Das Recht auf die eigene Entscheidung, unter dessen Perspektive in diesen Strukturen die Beteiligung der Frauen an der Macht zumeist gesehen wird, reicht nicht aus, um die Interessen der Frauen tatsächlich zu gewährleisten. Dieses Recht kann etwa dafür genutzt werden, die selektive Abtreibung weiblicher Foeten zu fördern.
3) Die liberale Betonung von formaler Gleichheit und abstraktem Individualismus ignoriert die »Ungleichheiten« zwischen Männern und Frauen. Sie geht von »Gleichartigkeit« aus und hat die Auswechselbarkeit von Individuen im Blick (Wolgast 1980). Nach Ansicht einiger Feministinnen erwachsen aus weiblicher Erfahrung, allen voran der der Geburt, spezifische Bedürfnisse, die geschützt werden müssen. Darüber hinaus legen sie besonderes Gewicht auf Fürsorglichkeit und die Erziehung der Kinder, Qualitäten, die sich dem für das frühe liberale Denken essentiellen Modell eines besitzstrebenden Individualismus widersetzen und es in Frage stellen. Mit anderen Worten eröffnet sich eine Perspektive, die von ihren Grundsätzen her mit der Umwelt in Einklang, humanisierend und demokratisch ist. Manche Frauen sind der Ansicht, diese Perspektive sollte dazu dienen, die liberale demokratische Ethik abzufedern, andere jedoch behaupten, das den liberalen Strukturen verschriebene Modell von Entwicklung, freiem Markt und Wettbewerb sei grundsätzlich unvereinbar mit der feministischen Perspektive (Mies & Shiva 1994).
So steht die Frauenbewegung schon lange in einem etwas prekären Verhältnis zur liberalen Demokratie. Während viele engagierte Frauen weiterhin die Bedeutung der Demokratie anerkennen, bleiben sie skeptisch gegenüber der Möglichkeit, Frauen mit Hilfe liberaler individualistischer Ethik, oder vielmehr innerhalb des Spielraums, den die institutionellen Strukturen einer liberalen Demokratie bieten, zu Macht zu verhelfen (Smart 1989). Doch obwohl diese Ernüchterung bei vielen Frauen aus Ländern der Dritten Welt, wie Indien, zum Ausdruck kommt, akzeptieren die meisten Frauengruppen und -organisationen, daß ein Appell an den Staat und das Rechtssystem im gegenwärtigen Kontext notwendig und unumgänglich ist. Veränderungen in der gesellschaftlichen Stellung der Frauen und der Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter sind nicht durchführbar ohne die Unterstützung durch den Staat, und ohne neue Gesetze zu erlassen, die die Zwangslage der Frauen berücksichtigen.
Indische Frauenperspektive
Unter dieser Perspektive arbeiten Frauengruppen in Indien weiterhin innerhalb der existierenden Strukturen der liberalen demokratischen Verfassung und bemühen sich, spezifische Zugeständnisse für Frauen zu sichern.
In der jüngeren Vergangenheit haben sie einige greifbare Erfolge verzeichnen können. Änderungen in der Gesetzgebung zur Vergewaltigung etwa, Schutz der Rechte von geschiedenen Frauen und eine spezielle Frauenquote für Institutionen auf lokaler Ebene1. Allerdings ist es ihnen nicht gelungen, entscheidende Veränderungen im Personenrecht der verschiedenen Minderheiten zu erreichen. Auch wenn Änderungen im hinduistischen bürgerlichen Recht, z.B. das Verbot der Bigamie und das Erbrecht für Frauen, die Aufmerksamkeit stärker auf die Gebräuche und Praktiken der Minderheiten gelenkt haben, bleiben weitere Reformen des hinduistischen bürgerlichen Rechts notwendig. Alles in allem bleibt das Nichtzustandekommen eines allgemeinbindenden bürgerlichen Rechts, das der rechtlichen Praxis der religiösen und ethnischen Gemeinschaften in Fragen der Ehe, Familie und Erbschaft übergeordnet wäre, ein wichtiges Problem für die indische Frauenbewegung und ein Anlaß zu ernsthafter Sorge2.
Vor dem Hintergrund dieser Frage untersucht der vorliegende Aufsatz, warum die liberalen Ideale der Autonomie und der Gleichheit in einer funktionierenden Demokratie wie Indien nicht haben verwirklicht werden können, und er behauptet, daß sie weder zentral für das Funktionieren einer Demokratie, noch in jeder Demokratie verwirklicht sind. Er stellt des weiteren fest, daß im Falle Indiens, in dem die Hauptsorge weniger der individuellen Autonomie, als der Gleichberechtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gilt, die institutionellen Strukturen einer liberalen Demokratie zu Verhältnissen führen, die die Identität der verschiedenen Gemeinschaften und die Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe stärken. Dies zeigt sich in der Unterordnung der Ansprüche der Frauen unter die der jeweiligen Gemeinschaft. Es erweist sich, daß aus den Prozessen, die mit der Bildung einer repräsentativen Regierung verbunden sind, Zwänge entstehen, unter denen die Verpflichtung für die Autonomie des Individuums zweitrangig wird. Diese Untersuchung geht unausgesprochen davon aus, daß in Gesellschaften, in denen das Patriarchat tief verwurzelt ist und durch die Praktiken und Gebräuche religiöser Gemeinschaften gestützt wird, das Bemühen um Gleichberechtigung zwischen den Gruppen sich nicht von selbst auf die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern überträgt. Diese würde vielleicht ein auf Mitbestimmung gegründetes Modell von Demokratie voraussetzen, das durch seine Betonung von Selbstbestimmung und Verantwortung den Frauen zu einem Bewußtsein verhelfen könnte, das der Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter Priorität einräumt.
Folgen eines Urteils des Obersten Gerichtshofes
Der Widerspruch zwischen religiösen Ansprüchen und Anforderungen von Frauen wurde sehr deutlich an dem Urteil des Obersten Gerichtshofes und seiner darauffolgenden Diskussion in Indien. Die 65jährige Shah Bano, eine geschiedene moslemische Frau, hatte sich wegen Unterhaltsforderungen an ihren Ex-Ehemann an den Obersten Gerichtshof Indiens gewandt. Obwohl Angehörige der islamischen Gemeinschaft in Angelegenheiten wie Ehe, Scheidung, Unterhalt und Erbschaft dem islamischen Personenrecht unterworfen sind, das keinen Unterhalt für die geschiedene Ehefrau oder ihre Kinder vorsieht, gab der Oberste Gerichtshof ihrer Berufung statt und bezog sich dabei auf den »Indischen Criminal Procedure Code« (IPCC) (Absatz 125), der die Versorgung mittelloser Frauen vorsieht. Infolgedessen stand ihr nach dem Urteil des Gerichts ein bescheidener Unterhalt von ihrem Ex-Ehemann zu.
Das Urteil, das zudem Aussagen über das islamische Personenrecht beinhaltete, wurde von Frauenorganisationen und anderen Liberalen als erstes Anzeichen für einen Sieg der säkularen Kräfte begrüßt. Die islamische Bevölkerung, vor allem die Politiker und die männlichen orthodoxen Geistlichen, verdammten es als einen Versuch, das islamische Personenrecht anzutasten. Es wurden Versuche unternommen, zu zeigen, daß die Vorgehensweise der islamischen Gemeinschaft nicht diskriminierend sei und daß es Bestimmungen gebe, unter denen die Interessen der Frauen gewahrt werden könnten. Zwar behauptete niemand, daß die Interessen Shah Banos innerhalb der vorgegebenen Strukturen gewahrt worden seien, doch waren sie überzeugt, es gäbe, zumindest theoretisch, Bestimmungen innerhalb des »Shariyat« (dem Gesetz des Koran), die für solche Sonderfälle herangezogen werden könnten.
Zusammengefaßt heißt das, die Mehrzahl von ihnen kritisierte den Obersten Gerichtshof für seine Rechtssprechung in dieser Frage; während die liberaleren Mitglieder die in dem Urteil enthaltene Anklage des islamischen Personenrechts ungerechtfertigt und unnötig fanden, argumentierten andere, daß diese »Einmischung« die große Masse der islamischen Bevölkerung (die bis jetzt noch nicht orthodox ist) in die Arme orthodoxer Geistlicher treiben würde, da deren Argumente, die islamische Gemeinschaft und ihre Identität seien bedroht, auf diese Weise an Glaubwürdigkeit gewännen.
Liberaldemokratische Institutionen in Indien
Bevor wir uns den spezifischen Erfahrungen mit der Funktionsweise liberaler demokratischer Institutionen in Indien zuwenden, sollte daran erinnert werden, daß ein feministisches Bewußtsein nicht das natürliche oder spontane Bewußtsein von Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß indische Frauen sich schon aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Besonderheit im Widerstand gegen die jeweiligen Formen männlicher Herrschaft und Unterdrückung organisieren und sie zu verändern versuchen.
Ebenso wichtig ist es, daran zu erinnern, daß diese Frauen gleichzeitig Mitglieder weiterer Gemeinschaften und Gruppen sind und daher Trägerinnen einer mehrfachen Identität; das heißt, sie gehören zusätzlich jeweils einer religiösen Gemeinschaft und einer spezifischen sprachlichen und ethnischen Gruppe an; außerdem kommen sie aus einer bestimmten Schicht der Gesellschaft und sind Teil der ländlichen oder der städtischen Bevölkerung.
Ihre Identität macht sich also nicht an einem einzelnen Punkt fest, vielmehr besetzt jede dieser Frauen eine Reihe verschiedener Positionen. Das Engagement für eine politische Sache, wie etwa die der Frauenbewegung, läßt zwar eine dieser Positionen in den Vordergrund treten, doch ist diese weder auf Dauer noch allein bestimmend für die jeweilige Identität der Frau.
Tatsächlich ergibt sich die Art der Auseinandersetzungen, die in einer Gesellschaft entstehen, aus dem Konflikt unterschiedlicher Identitäten und den historisch-kulturellen Umständen, die eine dieser Identitäten gegenüber allen anderen begünstigen.
Kaste und Religion
Die Besonderheit der indischen Situation besteht darin, daß, im Vergleich zu anderen, die auf Kaste und Religion basierenden Identitäten die dominierenden sind und daß das Verhalten des Staates im Laufe der Zeit zu einer weiteren Stärkung der religiösen Identität geführt hat. Während einerseits Versuche unternommen wurden, im Kastenwesen strukturell vorhandene Ungleichheiten zu beseitigen, haben sich die führenden Politiker andererseits kontinuierlich bemüht, den Schutz der religiösen Idenität der verschiedenen Gemeinschaften sicherzustellen. Insbesondere versuchten sie, die Angehörigen der religiösen Minderheiten zu beruhigen, indem sie ihnen zusicherten, es werde keinerlei Einmischung in ihre internen Regelungen und Praktiken geben. Dies bedeutete unter anderem, daß das Personenrecht der verschiedenen religiösen Minderheiten (z.B Moslems, Christen, Parsen) unangetastet bleiben würde.
In der Tat gab es schwerwiegende historische Gründe, dies so deutlich zu betonen. Die Unabhängigkeit, die erst in der Folge heftiger Kämpfe zwischen den verschiedenen Gruppen erreicht wurde, machte Zusicherungen gegenüber den Minderheiten notwendig. Überdies betrachteten die Begründer der indischen Verfassung die Ungleichheit zwischen Bevölkerungsgruppen, wie sie durch gewisse Aspekte des Kastensystems verursacht wurde, als ein Übel, das es zu bekämpfen galt. Die Einrichtung demokratischer Institutionen, die auf dem allgemeinen Wahlrecht und dem Prinzip der formalen Gleichheit gründeten, ermöglichten es, die grundsätzliche Gleichheit aller zu erklären, trotz der jeweiligen Zugehörigkeit der einzelnen zu verschiedenen Gruppen. Eine dieser Hervorhebung der Gleichheit entsprechende Gewichtung der Idee individueller Autonomie gab es nicht, und Gruppen und religiöse Gemeinschaften wurden als legitime Akteure der politischen Arena betrachtet. Bemerkenswert ist, daß in den westlichen Demokratien das Interesse an der Autonomie des Individuums für einzelne aus den unterschiedlichsten Bereichen zum Auslöser wurde, dieses Grundrecht für sich einzufordern, während das Interesse an der Gleichheit zwischen Gruppen nicht dasselbe Potential zu haben scheint. Dieser Umstand hat der Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter im Wege gestanden.
Das Paradox im indischen Kontext besteht darin, daß die Prozesse, die mit einer liberalen demokratischen Regierungsweise verbunden sind, diese Unterordnung der Ansprüche der Frauen begünstigt haben.
Eine liberale Demokratie erzeugt, nach ihrer eigenen Logik, eine Mehrheit und eine Minderheit. Keine der beiden freilich ist vorgegeben oder unveränderlich, d.h. in einer Bevölkerung werden Mehrheit und Minderheit durch die Wahl neu bestimmt und zumindest theoretisch besteht die Möglichkeit, daß die bestehende Minderheit in der nächsten Runde zur Mehrheit wird. Eine solche Möglichkeit ist allerdings nur in einer Situation realisierbar, in der die bestehenden Konstellationen zwischen den Gruppen variieren. Anders ausgedrückt: Betrachten sich die einzelnen als Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft und handeln vorrangig in dieser Eigenschaft, so ergibt sich eine zahlenmäßig vorgegebene Mehrheit und Minderheit. Durch die relativ große Bedeutung, die in Indien der religiösen Identität zukommt, haben wir eine Situation, in der sich der handelnde einzelne als Mitglied einer religiösen Mehrheit oder spezifischen Minderheit begreift. Darüber hinaus erkennen sie als Angehörige einer Minderheit, daß sie ihre Interessen am ehesten durch kollektive Entscheidungen wahren und ausbauen können. Der Logik der Zahlen folgend gehen daher die Minderheiten, stärker als die Mehrheit, davon aus, daß kollektives Handeln ihren Interessen nützt. Da überdies kollektives Handeln ihre Bedeutung in Wahlkämpfen erhöht, treffen die politischen Parteien nur ungern Entscheidungen, die für die Führer der religiösen Gemeinschaften (gewöhnlich orthodoxe, männliche Geistliche) vielleicht nicht akzeptabel wären. Dieser Standpunkt vieler politisch Verantwortlicher hat zur Folge, daß die Interessen der Frauen als Staatsbürgerinnen dem speziellen Interesse der jeweiligen religiösen Gemeinschaft untergeordnet werden.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Wahlniederlage der Kongreßpartei in Assam, Bijnor, Kishankanj, Bolpur, Baroda etc. 1985-86 kurz nach dem Fall Shah Bano ließ die Führung der Partei annehmen, die islamische Bevölkerung entferne sich von der Partei. Um daher ihre Unterstützung zurückzugewinnen, verabschiedete die Partei das »Muslim Women's Bill« gegen den Widerstand zahlreicher auch moslemischer Frauengruppen. Das Gesetz bedeutete ein Zugeständnis an die orthodoxen Mitglieder der moslemischen Gemeinschaft, denn es versagte moslemischen Frauen die Möglichkeit, sich unter Berufung auf das IPCC (Absatz 125) an den Obersten Gerichtshof zu wenden. Außerdem legte es fest, daß nach der Zeit des »idaat«, d.h. der Scheidung, von nun an die Familie der Frau und nicht mehr der Ex-Ehemann für den Unterhalt verantwortlich ist. Die Kongreßpartei ließ sich aus Sorge um Wahlverluste zu diesem Verhalten bewegen, doch opferte sie diesem politischen Interesse die Interessen der Frauen. Dies ist keineswegs ein Einzelfall; immer wieder stehen Parteien und Politiker Situationen gegenüber, in denen die Zwänge der Wahlpolitik, die integraler Bestandteil liberaler demokratischer Strukturen sind, zu einer Begünstigung von Gemeinschaftsinteressen und -identitäten geführt haben.
Auch muß festgehalten werden, daß die Identifizierung der individuellen Interessen mit denen der religiösen Gemeinschaft und die damit verbundene Wahrnehmung von Mehrheit und Minderheit zu einer Lage geführt haben, in der sich diese Gemeinschaftsidentitäten weiter verstärken. In der Folge des »Shah Bano-Urteils« verabschiedete die regierende Kongreßpartei das oben erwähnte »Muslim Women's Bill«. Danach, im selben Jahr, wurden, um der hinduistischen Bevölkerung entgegenzukommen, die Tore des Babri Masjid geöffnet und so die Anbetung des Bildnisses des Ram ermöglicht (Hasan 1994).
Auch in diesem Fall griff der Staat in einer Weise ein, die die Selbstwahrnehmung der einzelnen als Angehörige einer religiösen Gemeinschaft akzeptierte und noch verstärkte. Paradoxerweise war es gerade die liberale demokratische Struktur, die die Verdrängung der individuellen Identität durch die der Gemeinschaft zuließ.
Drei Punkte müssen in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden.
1) Entgegen einer verbreiteten Annahme und der liberalen Erwartung nehmen Menschen am politischen Prozeß häufig als Angehörige verschiedener Gruppen teil. In einem Zusammenhang, in dem die Identifizierung mit einer dieser Gruppen die mit allen anderen zahlenmäßig dominiert, erscheint diese erstarrte Position den verschiedenen am politischen Prozeß Beteiligten als die »gegebene« Realität. Es entsteht der Eindruck einer natürlichen Gruppe, über die die einzelnen angesprochen und ihre Forderungen verhandelt werden können. Diese Wahrnehmung wiederum ist der Grund für die weitere Festigung bestehender Gemeinschaftsidentitäten.
2) Als Erben des liberalen Vermächtnisses mögen wir davon ausgehen, daß das Individuum die Grundeinheit der Gesellschaft sei und daß sich die politische Wirklichkeit nach dieser Annahme zu richten habe. Doch in den Institutionen und Verfahrensweisen einer liberalen Demokratie selbst ist nichts enthalten, durch das aus dieser Annahme eine Realität würde. In vielen Fällen bleibt sie eine philosophische Hypothese, die sich gegebenenfalls in einem allgemeinen bürgerlichen Recht oder in der Vorstellung von den primären menschlichen Gütern, Ansprüchen und Bedürfnissen niederschlägt. Mit anderen Worten, sie ergibt sich nicht als Konsequenz aus der institutionellen und verfahrensrechtlichen Struktur.
3) Die Realität, der wir ins Auge sehen müssen, ist, daß in Indien weder die Mechanismen des Marktes noch die Erfahrung der Demokratie die Identitäten der religiösen Gemeinschaften zu untergraben vermochten.
Auf der einen Seite haben die demokratischen Verfahrensweisen die Wahrnehmung von Minderheiten und die Identitäten der verschiedenen Gemeinschaften gestärkt, auf der anderen Seite haben sie zu der Unterordnung der Interessen von Frauen als einer Gruppe beigetragen.
Die Tatsache, daß es in Indien nicht gelungen ist, die Unterstützung weiter Teile der weiblichen Bevölkerung zu mobilisieren, ist im Kontext zweier einschränkender Bedingungen zu sehen:
1) Immer wieder ausbrechende Gewalt zwischen den verschiedenen Gruppen und das Verhalten der politischen Parteien festigen die religiöse Identität und verleihen ihr stärkeres Gewicht. Im Vergleich damit erscheinen andere Identitäten als nebensächlich. Da die Forderungen der Frauenbewegung überdies in direktem Gegensatz zu denen stehen, über die sich die religiösen Gemeinschaften definieren, werden die ersteren stets den letzteren untergeordnet. Im Unterschied dazu sind Gruppeninteressen, die nicht mit religiösen Interessen kollidieren – z.B. solche der Bauern – oft ausgesprochen erfolgreich in ihrer Durchsetzung. Die Stärke der reichen Bauern ergibt sich aus der Tatsache, daß sie gemeinsame, auf ihrer Klassenzugehörigkeit basierende Interessen haben. Da Frauen auf der Ebene der Klassen und der Kasten getrennt sind, fehlt es ihrem Kampf an Homogenität und an Kraft.
2) Unter den gegebenen Bedingungen der Unterordnung waren Frauen nur selten in den vordersten Reihen der ideologischen, insbesondere der religiösen ideologischen Produktion zu finden. Daher erscheint in der von Männern beherrschten Arena der religiösen ideologischen Produktion die Gleichberechtigung der Geschlechter niemals auf der Tagesordnung (Dietrich 1992).
Während der Konflikt zwischen der religiös bestimmten Identität und den Forderungen der Frauen eine indische Besonderheit darstellt, sind weder die Existenz durch Gemeinschaften definierter Identitäten noch die Forderungen nach Rechten für diese Gemeinschaften auf Indien beschränkt. Daher können diese Probleme nicht einfach als Abweichungen von der liberalen Norm abgetan werden. Auch in westlichen liberalen Demokratien haben verschiedene kulturelle und religiöse Gemeinschaften Ansprüche auf ihre Rechte angemeldet, die nicht ignoriert werden können.
Im übrigen stehen diese Ansprüche trotz allem, auch dann, wenn die Forderung nach kulturellen Rechten mit der liberalen Vorstellung individueller Rechte kollidiert, durchaus im Einklang mit der inneren Logik liberaler Demokratie. Während die erste Generation der Rechte – z.B. das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf Eigentum – direkt den einzelnen betrafen, betrachteten die sozialen Rechte den einzelnen als einer bestimmten Gruppe zugehörig. Es entstanden Kategorien wie Alte, Behinderte, Schwarze, Frauen, ethnische Gruppen, Immigranten etc. Die liberale Verpflichtung zu sozialer Gerechtigkeit schuf den Raum für die Anerkennung der Gruppe als einem legitimen Subjekt gesellschaftlichen und politischen Handelns. Darüber hinaus waren einige dieser Gruppen über ihre kulturellen und sozialen Attribute identifizierbar. Der demokratische Wohlfahrtsstaat nahm die unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen Gruppen in ihrer jeweiligen Identität wahr, um über ihre gemeinsamen Erfahrungen und mögliche Quellen von Ungleichheit informiert zu sein; er hoffte außerdem, daß eine aktive Unterstützung und andere Formen der Hilfe es ihnen ermöglichen würde, als gleichberechtigte Bürger am politischen Prozeß teilzunehmen. Paradoxerweise war es gerade die Anerkennung der nach ethnischen, sprachlichen oder regionalen Kriterien definierten Gruppe, die diesen Gruppen die Möglichkeit zur Formulierung weiterer Forderungen eröffnete. Mit anderen Worten, durch den demokratischen Wohlfahrtsstaat als solche identifizierte und anerkannte Gruppen stellten am Ende Forderungen, die einige der Grundvoraussetzungen liberaler Ethik in Frage stellten. Auf der philosophischen Ebene wurden mit einmal Attribute, die bislang als hergeleitet und zweitrangig gegolten hatten, als die wesentlichen Eigenschaften des »Seins« betrachtet, als der große Zusammenhang, in dem jeder sein Leben lebt und seine Entscheidungen trifft. Die eigene Kultur wurde zu einem kollektiven Gut, aus dem legitime Forderungen erwuchsen.
Keine Wahlmöglichkeit
Es ist offensichtlich, daß für Indien der Konflikt zwischen den Ansprüchen der religiösen Gruppen und denen der Gleichberechtigung nicht innerhalb des liberalen Diskurses lösbar ist. Ein Beispiel: In Indien wird manchmal argumentiert, der Konflikt könne gelöst werden, indem der/dem einzelnen das Recht zugestanden wird, aus der jeweiligen religiösen Gemeinschaft auszusteigen; das heißt, einzelne, die sich nicht an die Normen der Gemeinschaft gebunden fühlen, sollen die Möglichkeit haben, sich dem bürgerlichen Recht zu unterstellen. Der Erlaß des »Special Marriage Act« war ein Schritt in diese Richtung (Parashar 1992).
Obwohl dieser Vorschlag eine Lösung zu bieten scheint, in der sowohl die individuelle Autonomie als auch die Werte der Gemeinschaft anerkannt werden, ergeben sich in Wirklichkeit zwei Schwierigkeiten. Zum ersten ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Entscheidungen der beiden Ehepartner in Fragen der Ehe und der Erbschaft sehr unterschiedlich ausfallen würden. Zum Beispiel könnte sich bei einem moslemischen Paar der Mann für das Recht der Religionsgemeinschaft entscheiden, während die Frau vielleicht das bürgerliche Recht vorzieht.
Selbst wenn wir davon ausgehen, daß stets derjenige Partner recht bekommt, der sich an den Obersten Gerichtshof wendet oder der sich für das bürgerliche Gesetz entscheidet, das Recht des Staatsbürgers also sich gegen die Rechte der Religionsgemeinschaft behauptet, handelt es sich vielleicht dennoch nicht um eine durchführbare Lösung. Was etwa den Fall Shah Bano betrifft, stellte sich heraus, daß sie, obwohl das Urteil des Obersten Gerichts zu ihren Gunsten ausfiel und ihr einen Unterhalt zusicherte, den Nutzen aus diesem Urteil nicht ziehen konnte oder wollte. Sie wurde von der Gemeinschaft überredet, das Urteil abzulehnen, und die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung in Verbindung mit der Überzeugung, sie setze die Autonomie der islamischen Gemeinschaft aufs Spiel, überwog.
Zum zweiten ist der Vorschlag, Frauen sollten aus der Obhut der religiösen Gemeinschaften heraustreten, um unter dem »Special Marriage Act« zu heiraten, ebenfalls einigermaßen unrealistisch. In einer Gesellschaft, in der Frauen nur selten von ihrem Recht auf die freie Wahl des Ehepartners Gebrauch machen, werden sie sich wohl kaum dem Druck der Familie, sich den Sitten und Gebräuchen der Gemeinschaft entsprechend zu verhalten, widersetzen. Die Tatsache, daß die meisten von ihnen von einer solchen Wahlmöglichkeit gar nichts wissen, ist ein zusätzliches Problem.
Worum es hier geht, ist, daß zwar die liberale Ethik allgemeine Normen bereitstellt, mit deren Hilfe sich dieses Dilemma lösen ließe, doch vermag sie keine Lösung anzubieten, die im Rahmen einer von religiösen Gruppeninteressen bestimmten Gesellschaft durchführbar wäre. Nahezu alle Vorschläge verlangen eigenständiges individuelles Handeln, das sich innerhalb der formalen Verfahrensstrukturen einer liberalen Demokratie allerdings kaum in die Wirklichkeit umsetzen läßt.
Vielleicht müßte die Frauenbewegung ihre Aufmerksamkeit statt auf das repräsentative stärker auf ein durch Mitbestimmung geprägtes Modell von Demokratie richten, das den Frauen das politische Bewußtsein und das Selbstvertrauen geben könnte, den Kampf gegen das System der Ungleichheit aufzunehmen.
Unvereinbarkeit zwischen Anforderungen von Frauen und religiösen Gemeinschaften
Ein Ergebnis unserer Erörterungen ist, daß sich die Ansprüche und Forderungen religiöser Gemeinschaften nur schwer mit anderen Gruppeninteressen vereinbaren lassen. In Ländern wie Indien stehen sie den Forderungen der Frauen nach einer gleichberechtigten Staatsbürgerschaft entgegen. Die liberale Demokratie, mit ihrer begrenzten repräsentativen Regierungsform und den dazugehörigen Verfahrensweisen und Institutionen, vermag diese Konflikte nicht zugunsten der Gleichberechtigung zu lösen. Auch ist sie unfähig, Änderungen herbeizuführen, durch die dem liberalen Anliegen der Autonomie des einzelnen der Vorrang vor allen anderen eingeräumt würde. Tatsächlich lassen sich die erwähnten Institutionen in einer Gesellschaft, die um verschiedene religiöse Gemeinschaften zentriert ist, sogar zur weiteren Festigung der Identität dieser Gemeinschaften und zur Verstärkung ihrer Forderungen nutzen.
In Indien geht es nicht darum, ob die Mehrheit sich durchsetzen wird, oder ob die Stimme der Minderheit sich durchsetzen sollte. Obgleich die Mehrheit wie auch die kulturellen Minderheiten ihren Gefühlen in dieser Weise Ausdruck geben, ignorieren in Wirklichkeit beide die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter. Beschwört die eine das Gespenst der »Hinduisierung« herauf, so sanktioniert die andere die Unterordnung der Frauen.
All diese Paradoxien deuten auf die Unangemessenheit der Begriffe im gegenwärtigen liberalen Diskurs und beweisen die Notwendigkeit einer differenzierteren und historisch genaueren Lesart in der Frage der Rechte kultureller und religiöser Gemeinschaften. Sie lenken aber unsere Aufmerksamkeit auch auf die Vielfalt an Möglichkeiten, in der selbst liberale demokratische Institutionen in einer Gesellschaft genutzt werden können, manchmal sogar um eben die Rechte und Ansprüche zu untergraben, die von je her mit der Philosophie des Liberalismus verbunden waren.
Literatur
Dietrich, Gabriele: Reflections on the Women's Movement in India. Horizon India Books, Delhi, 1992.
Hasan, Zoya: Communalism, State Policy and the Question of Women's Rights in Contemporary India. Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol.25, N.42, 1994.
Hobsbawm, E.J,: Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
Kymlicka, Will: Liberalism, Community and Culture. Clarendon Press, Oxford, 1989.
Mies, M. & V. Shiva: Ecofeminism. Kali, Delhi, 1994.
MacKinnon, C.A.: Feminism, Marxism, Method and the State: Towards Feminist Jurisprudence. Signs, Vol.8, No.4, 1983.
Parashar, Archana: Women and Family Law Reform in India: Uniform Civil Code and Gender Equality. Sage Publications, Delhi, 1992.
Sathe, S.P.: Towards Gender Equality. SNDT University, Bombay, 1993.
Smart, Carol: Feminism and the Power of Law. Routledge, London & New York, 1989.
Wolgast, E.H.: Equality and the Rights of Women. Cornell University Press, Ithaca & New York, 1980.
Anmerkungen
1) Zum Beispiel wird durch die Änderungen unter Absatz 376 A,B,C und D der Geschlechtsverkehr mit einer juristisch geschiedenen Frau, ohne ihr Einverständnis, zu einer Straftat; und im Falle der Vergewaltigung liegt die Last des Beweises (daß das Opfer zugestimmt hat) nun bei dem Angeklagten (Sathe 1993) Zurück
2) Das Problem liegt darin, daß in einer patriarchalischen Gesellschaft viele dieser rechtlichen Praktiken zugunsten des Mannes gewichtet sind. So kann sich nach islamischem Personenrecht der Mann von seiner Frau durch das dreifache Aussprechen des taalag während einer Sitzung scheiden lassen; nur während der Zeit der Trennung bekommen die Frauen Unterhalt von ihrem Mann. Das christliche Scheidungsgesetz macht es einer Frau fast unmöglich, sich scheiden zu lassen. Anders als der Mann muß sie zwei Verstöße gegen das Eherecht nachweisen, z.B. Ehebruch, Vergewaltigung, Bigamie. Überdies besitzt ihr Mann, falls sie lediglich eine rechtliche Trennung erwirken konnte, Anspruch auf ihren Besitz und auf die Vormundschaft der Kinder; er kann sogar die Wiederherstellung der ehelichen Rechte verlangen. Zurück
Gurpreet Mahajan arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Centre for Political Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110067, India. Sie stellte diesen Text auf der Weltkonferenz der »International Political Science Association« im August diesen Jahres in Berlin vor.
Übersetzung: Barbara Kronsfoth