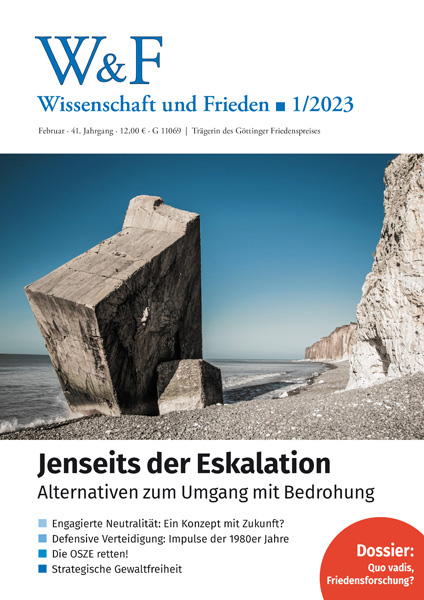Konkurrierende Bedrohungsdebatten in Krisenzeiten
Eine sozialpsychologische Perspektive
von Tobias Rothmund
Hinter uns liegt ein Jahr, in dem der Krisenmodus zum Dauerzustand erklärt wurde. Krieg in der Ukraine, Energieknappheit, Digitalisierung, Pandemiefolgen und nicht zuletzt der galoppierende Klimawandel. Krisen und Transformationsprozesse gehen mit mehr oder weniger konkreten Bedrohungslagen einher. Diese werden in Nachrichtensendungen, Talkshows und sozialen Medien debattiert – singulär, wechselseitig überlagernd und vergleichend. Aber was genau macht das mit uns als Gesellschaft, wenn multiple Bedrohungen und deren Bedeutung dauerhaft zum Gegenstand öffentlicher Debatten werden? Wie reagieren Menschen allgemein auf wahrgenommene Bedrohungen und was bedeutet das für die aktuelle Krisenkommunikation?
Die sozialpsychologische Forschung zu Bedrohung und Bedrohungserleben hat mindestens drei Ursprungslinien: eine evolutionsbiologische, eine kognitionswissenschaftliche und eine gruppenpsychologische. Die evolutionsbiologische Forschungslinie basiert auf der Annahme, dass Sensitivität gegenüber bedrohlichen Umweltreizen biologisch verankert ist, da sie einen Anpassungsvorteil für das Überleben unserer Vorfahren bedeutet hat. Eine solche Sensitivität wird häufig auch als »Negativitätsbias« bezeichnet (Rozin und Royzman 2001), d.h. Menschen reagieren auf negative Informationen stärker als auf positive. Die allgemeine Existenz einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber negativen bzw. bedrohlichen sozialen Informationen ist jedoch umstritten. Bar-Haim und Kolleg*innen (2007) finden im Rahmen einer Meta-Analyse einen Wahrnehmungsbias zugunsten bedrohlicher Informationen nur bei Menschen mit ängstlicher Persönlichkeitsstruktur. Norris (2021) hingegen berichtet eine Vielzahl neuropsychologischer Studien, die auf einen allgemeinen Wahrnehmungsbias zugunsten bedrohlicher Umweltreize hindeuten.
Eine kognitionswissenschaftliche Ursprungslinie der psychologischen Bedrohungsforschung reicht zu den Arbeiten von Leon Festinger und Kolleg*innen in den 1950er Jahren zurück. Die sogenannten Konsistenztheorien gehen im Kern davon aus, dass Menschen einen Zustand der inneren Konflikt- und Widerspruchsfreiheit anstreben. Persönliche Überzeugungen, Wertvorstellungen, Wahrnehmungen oder auch Verhaltensweisen sollten also im Einklang miteinander stehen. Innere Widersprüche lösen im Sinne der Dissonanztheorie (Festinger 1957) negative Gefühle und Unsicherheit aus. Das Erleben dieser kognitiven Inkonsistenzen wird als bedrohlich wahrgenommen und motiviert Menschen in der Folge dazu, Anpassungen im Denken oder Handeln vorzunehmen, um ein Gefühl der Sicherheit, Kontrolle oder Bedeutung wiederzuerlangen.
Ein dritter Ursprung der psychologischen Forschung zum Bedrohungserleben kann in der Intergruppenforschung gesehen werden. Hier wird zwischen realistischer und symbolischer Bedrohung unterschieden (Stephan und Stephan 2000). Realistische Bedrohung wird im Kontext von Ressourcenkonflikten zwischen sozialen Gruppen oder Gesellschaften erlebt. In diesem Fall resultiert die Bedrohung einer Gruppe daraus, dass das Wohlergehen mehrerer Gruppen negativ interdependent ist: Was eine Gruppe hat, fehlt also einer anderen Gruppe. Solche Konflikte können sich auf materielle Ressourcen (bspw. fossile Energiequellen) oder auf immaterielle Ressourcen (bspw. Macht) beziehen. Symbolische Bedrohung zwischen sozialen Gruppen resultiert hingegen aus diskrepanten Wert- und Moralvorstellungen. Die Bedrohung hat somit keinen materiellen Charakter. Sie drückt eher eine Art normative Verunsicherung aus. Sowohl realistische Bedrohungen als auch symbolische Bedrohungen begünstigen negative Vorurteile (Riek et al. 2006), bis hin zu Hass und Gewalt zwischen gesellschaftlichen Gruppen (Martinez et al. 2022).
Ein psychologisches Modell des Bedrohungserlebens
Eine Gruppe von Wissenschaftler*innen um Eva Jonas (2014) hat die drei dargestellten Forschungslinien in ein allgemeines Modell des Bedrohungserlebens integriert. Bedrohungserleben wird dabei als Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen (a) existentiellen, epistemischen oder sozialen Bedürfnissen oder Zielen und (b) beobachteten oder antizipierten persönlichen oder sozialen Zuständen verstanden. Diese Diskrepanzwahrnehmung wird als unangenehm erlebt, bedroht die persönliche oder soziale Identität von Menschen und motiviert entsprechende Reaktionen. Die Autor*innen unterscheiden zwischen kurzfristigen Abwehrreaktionen und nachfolgenden Bewältigungsreaktionen.
- Kurzfristige Abwehrreaktionen umfassen beispielsweise ein erhöhtes physiologisches Aktivierungsniveau und erhöhte Wachsamkeit bzw. Aufmerksamkeit. Dabei wird das BIS (»Behavioral Inhibition System«), eine Art biologisches Verteidigungsprogramm, aktiviert. Abwehrreaktionen können sich jedoch auch in Vermeidungsverhalten ausdrücken, indem es zu einer Abwendung von der als bedrohlich wahrgenommenen Situation oder Informationslage kommt.
- Anschließende Bewältigungsreaktionen zielen darauf ab, das Bedrohungserleben nachhaltig zu reduzieren. Man kann zwischen konstruktiven und palliativen Formen der Bewältigung unterschieden. Konstruktive Bewältigungsreaktionen zielen auf die Verringerung des Bedrohungserlebens durch eine Veränderung der Diskrepanzwahrnehmung ab. Dies kann dadurch erfolgen, dass eine Veränderung der als unbefriedigend wahrgenommenen Zustände bewirkt wird. Hierfür kann beispielsweise politisches Engagement durch Protestverhalten oder die Mitwirkung an politischen Aktivitäten dienen. Alternativ kann auch die Anpassung bzw. Relativierung von Bedürfnislagen zu einer Reduktion des Bedrohungserlebens führen. Eine Ablösung von bestimmten Zielen wäre eine solche Reaktion. Palliative Bewältigungsformen zielen nicht direkt auf die konkrete Diskrepanzwahrnehmung ab, sondern eher darauf, das Bedrohungserleben durch alternative Formen der Selbstaufwertung zu kompensieren. Eine solche Selbstaufwertung kann beispielsweise durch die Identifikation mit einer Gruppe oder durch die Orientierung an transzendentalen Zielen erfolgen. Diese palliativen Bewältigungsformen zielen auf eine Reduktion des Bedrohungserlebens ab, ohne dabei konkret auf die zugrundeliegende Problemlage einzuwirken.
Krisenkommunikation unterliegt Dramatisierungsattraktion
Öffentliche Diskurse über multiple Krisen werden maßgeblich von Akteur*innen in Medien und Politik geprägt. Unsere Medienlandschaft kann dabei als »High-Choice«-Informationsumgebung beschrieben werden, in der eine Vielzahl an Informationsangeboten um die Aufmerksamkeit und Zuwendung durch Rezipient*innen konkurrieren (van Aelst et al. 2017). Sowohl politische Akteure als auch Journalist*innen und Medienschaffende unterliegen unter diesen Rahmenbedingungen leicht einer Dramatisierungsattraktion, d.h. die Hervorhebung und Dramatisierung von Bedrohungsszenarien erscheint für die massenmediale Kommunikation attraktiv. Diese Dramatisierungsattraktion hat verschiedene Ursachen, die durch die Logik des politischen und des medialen Systems begünstigt werden.
Für Journalist*innen und Medienschaffende scheint die Emotionalisierung und Dramatisierung von Bedrohungslagen im Kontext einer medialen Aufmerksamkeitsökonomie unumgänglich (Ciampaglia et al. 2015). Wie bereits dargestellt, ist Bedrohungserleben eng an die Aufmerksamkeitssteuerung von Menschen gekoppelt. Auch wenn die Existenz eines allgemeinen Wahrnehmungsbias zugunsten bedrohlicher Informationen empirisch umstritten bleibt, so erhöht das subjektive Bedrohungserleben von Rezipient*innen in vielen Fällen die Aufmerksamkeit gegenüber relevanten Informationen (zum Überblick siehe Jonas et al. 2014). Das Bedrohungserleben verstärkt also die Auswahl und Nutzung bedrohungsbezogener Medien- und Informationsinhalte, was sich in der Medienlogik (gerade heutiger Plattformkapitalisierungen) direkt monetarisieren lässt. Ein anschauliches Beispiel für den Link zwischen Bedrohungserleben und Mediennutzung stellt das Phänomen des »Doom-Scrolling« dar, eine exzessive Form der Mediennutzung als Reaktion auf akutes Bedrohungserleben. Solche Doom-Scrolling Praktiken sind beispielsweise aus der ersten Phase der Covid-19-Pandemie oder den ersten Wochen des russischen Kriegs gegen die Ukraine bekannt: Ausgehend von einem bedrohungsinduzierten Informationsbedürfnis legten viele Menschen ihre Smartphones zeitweise kaum mehr aus der Hand, obwohl die verfügbaren Informationen das Bedrohungserleben immer weiter verstärkten und sich somit eine Art Teufelskreis aus Bedrohungserleben und Informationsbedürfnis bildete.
Aber auch für Parteien und Politiker*innen ist es in besonderem Maße attraktiv, Bedrohungslagen zu dramatisieren. So sind spezifische Bedrohungsszenarien bzw. deren Abwendung für Parteien identitätsstiftend (bspw. Umweltzerstörung für Bündnis90/Die Grünen, soziale Ungleichheit für Die Linke, »Überfremdung« für die AfD). Die Betonung der entsprechenden Bedrohungspotentiale stärkt nicht nur den Zusammenhalt der Parteibasis, sondern wird auch als Instrument der politischen Mobilisierung genutzt, um eigene Themen auf die mediale Agenda zu setzen.
Vor dem Hintergrund dieser Bedrohungsattraktion in der Logik politischer und medialer Systeme ist es nicht verwunderlich, dass Bedrohungslagen häufig eine zentrale Rolle in der medialen Krisenkommunikation einnehmen. Im Kontext paralleler Krisen resultieren daraus leicht konkurrierende Bedrohungsdebatten, in denen politische Themen anhand des Bedrohungspotentials unterschiedlicher Entscheidungsoptionen vergleichend diskutiert werden. Ein Beispiel für eine solche Bedrohungsdebatte ist die öffentliche Diskussion über die Nutzung von »Fracking« zur Gewinnung von Erdgas in Deutschland, die vor dem Hintergrund multipler Bedrohungslagen (Energiemangel vs. Umweltzerstörung) geführt wird. Es geht also primär um die Frage, welche Bedrohung stärker wiegt und daher das politische Handeln eher leiten sollte. Aus sozialpsychologischer Perspektive sind solche Bedrohungsdebatten jedoch riskant.
Bedrohungsdebatten verschärfen gesellschaftliche Polarisierung
Eine Vielzahl psychologischer Studien hat den Einfluss des Bedrohungserlebens auf die Bewertung konflikthafter politischer Fragestellungen untersucht. Dabei konnten zwei sehr unterschiedliche Phänomene identifiziert werden. Bedrohungserleben kann je nach Kontext den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken oder auch die Polarisierung innerhalb einer Gesellschaft begünstigen.
Werden Bedrohungslagen gesamtgesellschaftlich einigermaßen konsensuell als solche bewertet, führt dies dazu, dass innergesellschaftliche Konflikte reduziert werden. Dieses Phänomen wird häufig auch als Schulterschluss-Effekt (»rallying-around-the-flag«) bezeichnet und zeigt sich nicht nur bei politischen Parteien (Chowanietz 2010), sondern auch in der allgemeinen Öffentlichkeit (Feinstein 2016). Die Gesellschaft rückt also im Angesicht der externen Bedrohung zusammen. So berichten Menschen als Reaktion auf gesamtgesellschaftliche Bedrohungslagen wie Terror oder Pandemie eine stärker nationale Identifikation (Kuenhanss et al. 2021) oder auch ein stärkeres Vertrauen in die jeweilige Regierung (Kritzinger et al. 2021).
Der umgekehrte Effekt findet sich jedoch dann, wenn Bedrohungslagen innerhalb einer Gesellschaft kontrovers bewertet werden. Nehmen wir die bereits angesprochene Debatte um Fracking. Ein Teil der Gesellschaft bewertet die Bedrohung durch Energiemangel und den damit verbundenen Wohlstandsverslust besonders hoch. Ein anderer Teil der Gesellschaft bewertet die Gefahr der Verschmutzung von Wasser und die damit verbundene Bedrohung durch Umweltzerstörung besonders hoch. Häufig lassen sich solche Bewertungsunterschiede auf Unterschiede in der Gewichtung von Ziel- und Wertorientierungen zurückführen. Im Kontext konkurrierender politischer Bedrohungsdebatten werden diese Unterschiede und Konflikte herausgearbeitet und gegeneinander gestellt. In diesem Fall ist eine Art sekundäre symbolische Intergruppenbedrohung wahrscheinlich (siehe Hoffarth und Hodson 2016 am Beispiel Klimawandel): Gesellschaftliche Gruppen nehmen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Wert- und Moralvorstellungen wechselseitig als Bedrohung wahr. Eine solche symbolische Intergruppenbedrohung bereitet den Nährboden für eine Polarisierung der Gesellschaft (siehe auch Amira et al. 2021).
Bedrohungsdebatten begünstigen Vermeidungsreaktionen
Die psychologische Bedrohungsforschung lehrt uns, dass individuelle Bewältigungsstrategien im Umgang mit Bedrohung nicht notwendigerweise konstruktiv sind. Sie zielen primär darauf ab, das Bedrohungserleben zu verringern und somit das subjektive Wohlergehen und die wahrgenommene individuelle Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Eine bedrohungsfokussierte Krisenkommunikation riskiert daher individuelle und soziale Reaktionen, die stärker auf die Vermeidung oder Abmilderung des subjektiven Bedrohungserlebens abzielen als auf die konstruktive Lösung existierender gesellschaftlicher Probleme und Herausforderungen. Im Kontext der Covid-19-Pandemie konnte beispielsweise ein bewusstes Vermeiden bedrohlicher Nachrichteninhalte beobachtet werden. Dieses Phänomen dient erwiesenermaßen der Wiederherstellung des subjektiven Wohlbefindens (Yte-Arnbe und Moe 2021). Gerade im Kontext multipler Krisen ist zu erwarten, dass sich viele Menschen mit der Auswahl konstruktiver Bewältigungsstrategien überfordert fühlen. Je geringer aber die individuellen und kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen (d.h. die Erwartungen, Bedrohungslagen aktiv abwenden zu können), desto attraktiver werden palliative Formen der Bewältigung. Hierzu zählen beispielsweise die stärkere Einbettung in private soziale Strukturen, die Orientierung an religiösen oder spirituellen Überzeugungssystemen, aber auch die Entwicklung einer Sündenbocklogik gegenüber einer spezifischen Gruppe, welcher die Verantwortung für die Bedrohungslage zugeschrieben wird (bspw. im Sinne einer Verschwörungstheorie). Diese palliativen Bewältigungsstrategien dienen der persönlichen oder kollektiven Selbstaufwertung und können das Bedrohungserleben lindern, ohne dabei konkret auf die Bedrohungssituation einzuwirken.
Und nun? Vorschläge für eine konstruktive Wendung
Welche Schlussfolgerungen können aus dieser psychologischen Analyse der aktuellen Krisenkommunikation gezogen werden? Zunächst kann festgehalten werden, dass in medialen Debatten über gesellschaftspolitische Themen die kommunikative Fokussierung auf Bedrohungspotentiale für unterschiedliche Akteursgruppen attraktiv ist. Diese Dramatisierungsattraktion macht es schwierig, entsprechende Diskurse grundsätzlich zu versachlichen oder auf Veränderungen kommunikativer Strategien hinzuwirken. Gleichzeitig muss ebenfalls angenommen werden, dass eine allgemeine Tendenz zur Dramatisierung und Zuspitzung entsprechender Bedrohungsdebatten für die Gesellschaft negative Entwicklungen zur Folge hätte. Neben dem Risiko einer Polarisierung in unversöhnliche gesellschaftliche Extremgruppen ist auch ein erlebter Verlust an individueller und kollektiver Wirkmächtigkeit im Umgang mit Bedrohungslagen zu befürchten. In der Folge werden individuelle Vermeidungsreaktionen (bspw. »news-avoidance«) oder palliative Strategien des Umgangs mit dem Bedrohungserleben wahrscheinlicher und kollektive Anstrengungen einer konstruktiven Problembewältigung dadurch erschwert. Wir haben es also mit einem sozialen Dilemma zu tun, bei dem die Interessen individueller und organisationaler kommunikativer Akteure im Konflikt mit den Interessen der Gemeinschaft stehen.
Ich möchte zwei Ansatzpunkte für eine konstruktive Wendung dieses Dilemmas vorschlagen. Beide Vorschläge resultieren mehr oder weniger direkt aus der vorgenommenen sozialpsychologischen Analyse und zielen darauf ab, individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen im Umgang mit Bedrohungslagen zu stärken. Wie kann dies gelingen? Ein erster Ansatzpunkt besteht darin, Bedrohungslagen so zu verstehen und entsprechend zu kommunizieren, dass ein Schulterschluss-Effekt erzielt wird. Es geht also darum, dass Bedrohungslagen in einen positiven Zielzustand übersetzt werden, hinter dem sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung versammeln kann. Dies setzt voraus, dass einzelne Bedrohungslagen nicht durch die Abgrenzung und Konkurrenz zu anderen Bedrohungslagen definiert werden, sondern diese konstruktiv integrieren. So integriert beispielsweise das Ziel langfristig sicherer Lebensbedingungen in Europa sowohl den Schutz vor Umweltkatastrophen als auch vor Krieg und Rezession. Ein echter Schulterschluss-Effekt kann dabei nicht per Dekret („Wir schaffen das!“) erwirkt werden, sondern setzt eine geteilte Zielperspektive voraus.
Ein zweite Möglichkeit der konstruktiven Wendung von Bedrohungsdebatten besteht darin, individuelle und kollektive Möglichkeiten einer effektiven und konstruktiven Bewältigung kommunikativ stärker in den Fokus zu rücken und dadurch Selbstwirksamkeitserwartungen zu stärken. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass wirksame Formen des Handelns identifiziert und kommuniziert werden. Komplexe gesellschaftliche Bedrohungslagen wie Krieg oder Klimawandel sind zwar durch individuelles Handeln schwer zu verändern. Einzelpersonen oder auch soziale Gruppen können durch ihr Handeln aber eine Symbol- und Modellwirkung erzielen. Diese Effekte werden aktuell noch nicht ausreichend gewürdigt und kommunikativ genutzt. Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen können auch dadurch gestärkt werden, dass vergangene Erfolge in der Bewältigung von Problemlagen sichtbar gemacht werden. Solche Erfolgsgeschichten werden in gesellschaftlichen Bedrohungsdebatten häufig nicht angemessen abgebildet und tragen dadurch bislang wenig zur Stärkung von Selbstwirksamkeitserwartungen bei.
Literatur
Bar-Haim, Y.; et al. (2007): Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: a meta-analytic study. Psychological Bulletin 133(1), S. 1-24.
Chowanietz, C. (2011): Rallying around the flag or railing against the government? Political parties’ reactions to terrorist acts. Party Politics 17(5), S. 673-698.
Ciampaglia, G. L.; Flammini, A.; Menczer, F. (2015): The production of information in the attention economy. Scientific Reports 5(1), S. 1-6.
Feinstein, Y. (2020): Applying sociological theories of emotions to the study of mass politics: The rally-round-the-flag phenomenon in the United States as a test case. The Sociological Quarterly 61(3), S. 422-447.
Festinger, L. (1957): A theory of cognitive dissonance. Evanston, IL: Row & Peterson.
Hoffarth, M. R.; Hodson, G. (2016): Green on the outside, red on the inside: Perceived environmentalist threat as a factor explaining political polarization of climate change. Journal of Environmental Psychology 45, S. 40-49.
Jonas, E. et al. (2014): Threat and defense: From anxiety to approach. Advances in experimental social psychology 49, S. 219-286.
Kritzinger, S. et al. (2021): ‘Rally round the flag’: the COVID-19 crisis and trust in the national government. West European Politics 44(5-6), S. 1205-1231.
Kuehnhanss, C. R.; Holm, J.; Mahieu, B. (2021): Rally’round which flag? Terrorism’s effect on (intra)national identity. Public Choice 188(1), S. 53-74.
Martínez, C. A.; van Prooijen, J. W.; Van Lange, P. A. (2022): A threat-based hate model: How symbolic and realistic threats underlie hate and aggression. Journal of Experimental Social Psychology 103, 104393.
Myrick, R. (2021): Do external threats unite or divide? Security crises, rivalries, and polarization in American foreign policy. International Organization 75(4), S. 921-958.
Norris, C. J. (2021): The negativity bias, revisited: Evidence from neuroscience measures and an individual differences approach. Social Neuroscience 16(1), S. 68-82.
Riek, B. M.; Mania, E. W.; Gaertner, S. L. (2006): Intergroup threat and outgroup attitudes: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review 10(4), S. 336-353.
Rozin, P.; Royzman, E. B. (2001): Negativity bias, negativity dominance, and contagion. Personality and Social Psychology Review 5(4), S. 296-320.
Stephan, C. W.; Stephan, W. G. (2000): The measurement of racial and ethnic identity. International Journal of Intercultural Relations 24(5), S. 541-552.
Van Aelst, P., et al. (2017): Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? Annals of the International Communication Association 41(1), S. 3-27.
Ytre-Arne, B.; Moe, H. (2021): Doomscrolling, monitoring and avoiding: news use in COVID-19 pandemic Lockdown. Journalism Studies 22(13), S. 1739-1755.
Tobias Rothmund ist Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie an der Friedrich-Schiller Universität Jena. Er forscht zu psychologischen Perspektiven auf politische Kommunikation im Kontext digitaler Medien.