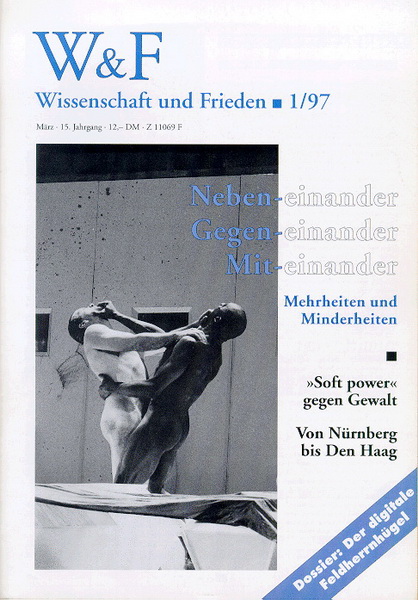Machtteilungskonzepte – Mittel zur friedlichen Konfliktbearbeitung
von Christiane Dick und Norbert Ropers
Die friedliche Zukunft der heutigen Staatenwelt mit ihren circa 190 »Nationalstaaten« wird vor allem davon abhängen, ob es gelingt, sie mit der Vielfalt tausender ethnischer, sprachlicher und religiöser Gruppen dauerhaft zu versöhnen.1 Dies ist sowohl eine Herausforderung für die staatsbildenden Gruppen, die sich in der Regel in einer Mehrheitsposition befinden, als auch für die diversen Minderheiten innerhalb der bestehenden Staaten. Das klassische Instrumentarium der innerstaatlichen Mehrheitsdemokratie ist dieser Aufgabe der Befriedung von Mehrheiten-Minderheiten-Konflikten bislang kaum gerecht geworden. Aber auch die entgegengesetzte Forderung einer Schaffung möglichst vieler ethnisch homogener (Klein-)Staaten würde angesichts der konfliktreichen Übergangszeit wohl nicht sonderlich friedensstiftend sein – ganz abgesehen von der Frage der Realisierbarkeit. Christiane Rix und Norbert Ropers untersuchen die Möglichkeiten zur friedlichen Bearbeitung von Mehrheiten-Minderheiten-Konflikten mit Hilfe von Machtteilungskonzepten am Beispiel der rumänisch-ungarischen Beziehungen vor und nach dem Regierungswechsel in Bukarest 1996.
Das Spannungsverhältnis zwischen der bestehenden Staatenwelt und ihrer Legitimierung durch die Prinzipien der territorialen Integrität wie nationalen Souveränität einerseits und der »Gruppenwelt« mit ihren Forderungen nach politischer Selbstbestimmung andererseits ist eine nahezu zwangsläufige Folge der weltweiten Durchsetzung des Organisationsmodells »Nationalstaat«. Dieses Modell vereint in sich nämlich zwei unterschiedliche Traditionen: diejenigen der »Kulturnation« wie der »Staatsnation«. Als brisant erweist sich dabei vor allem die Idee der Kulturnation, wonach allein eine homogene ethnisch definierte Bevölkerungsgruppe die Grundlage der Nationalstaats-Bildung sein kann. Andere Gruppen werden in dieser Vorstellung allenfalls in der Rolle von mit-wohnenden Nationalitäten geduldet. Ihnen kommt jedoch keine staatsbildende Funktion zu. Die Konsequenz ist eine Art Zwei-Klassen-Weltgesellschaft bestehend aus jenen ethnonationalen Gruppen, die es im Verlauf der Geschichte zu einem »eigenen« Staat gebracht haben, und jenen, die zu einem Minderheiten-Status in einem oder mehreren Staaten verurteilt sind.
Nicht zuletzt als Reaktion auf dieses Problem ist nach dem Zweiten Weltkrieg das Konzept der »Staatsnation« zur zentralen Leitfigur im internationalen System geworden. Der konzeptionelle Ausgangspunkt für die Nationenbildung ist hier eine staatliche Zentralgewalt, deren Ausgestaltung die Bevölkerung, gleich welcher ethnischen Zugehörigkeit, in einem gegebenen Territorium zu einem gemeinsamen Kollektivbewußtsein vereint bzw. vereinen soll. In diesem Kontext ist idealtypisch kein Platz für die Pluralität politisch relevanter ethnischer Gemeinschaftsbildungen. Alle Gruppen unterliegen vielmehr einem massiven Assimilationsdruck im Hinblick auf das dominierende Nationalstaatsverständnis.
Die Erwartung, daß auf diese Weise durch »nation-building« eine Relativierung ethnischer Zugehörigkeiten eintreten würde, hatte sich jedoch schon bei den europäischen Staatsbürgernationen und auch bei der »first new nation«, den USA, als voreilig herausgestellt. Auch ihnen gelang die Einschmelzung verschiedener Zugehörigkeiten nur begrenzt. Um vieles schwieriger stellte und stellt sich diese Aufgabe in den Staaten des Südens und des neuen Ostens dar, die mit ungleich größeren Belastungen ökonomischer und gesellschaftlicher Modernisierung konfrontiert sind. Gerade diese Modernisierungsprozesse sind es gegenwärtig, die die politische Mobilisierung auf der Basis ethnischer Merkmale eher stärken als schwächen.
Zwei Ansätze zur Machtteilung: Gruppenautonomie und integrative Dezentralisierung
Vor diesem Hintergrund wird zumindest auf der konzeptionellen Ebene zunehmend die Auffassung vertreten, daß eine nachhaltige Befriedung vieler Mehrheiten-Minderheiten-Konflikte nur möglich ist, wenn die Organisation und Verteilung politischer Macht in multiethnischen Staaten neu gestaltet wird. Zwei idealtypische Ansatzpunkte haben dabei in jüngster Zeit besondere Aufmerksamkeit gefunden: das Konzept der »Machtteilung durch Gruppenautonomie« und das der »Machtteilung durch integrative Dezentralisierung«, bei dem die Dezentralisierung der politischen Machtausübung mit der Stärkung transethnischer Strukturen verbunden wird.2
Die »Machtteilung durch Gruppenautonomie« zielt darauf ab, den Minderheiten ein weitgehendes Selbstbestimmungsrecht zu gewähren und sie möglichst proportional an den politischen Strukturen des Gesamtstaates zu beteiligen. Dazu können im einzelnen territoriale und nicht-territoriale Formen der Gruppenautonomie gehören, ferner die gemeinsame Ausübung exekutiver Macht durch Gruppen-Koalitionen, Veto-Rechte für Minderheiten und Proportionalitätsregeln für die Besetzung öffentlicher Ämter, die Vergabe von Geldern u.ä. Die Stärke dieses Ansatzes ist, daß den Minderheiten eine dauerhafte Sicherung ihrer Identitätbedürfnisse gewährt wird. Der Nachteil ist, daß auf diese Weise ethnische Teilungen verstärkt und verstetigt werden und es wenig politische Anreize zur Schaffung transethnischer Strukturen gibt.
Die »Machtteilung durch integrative Dezentralisierung« stellt in den Mittelpunkt die Verlagerung des Gewichts politischer Entscheidungen vom Zentralstaat zur regionalen und lokalen Ebene, in der Regel in Form eines föderalistischen Staatsaufbaus und einer Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Bei dieser Verlagerung wird zugleich Wert gelegt auf die Schaffung multiethnischer Einheiten auch auf den unteren Ebenen sowie von institutionellen Anreizen zum Ausbau transethnischer politischer Koalitionen. Dazu zählen etwa »cross-voting«-Wahlverfahren, bei denen ethnisch getrennte Wahlbevölkerungen ein begrenztes Mitspracherecht über die Zusammensetzung der politischen Vertretung anderer ethnischer Gruppen erhalten. Mit diesem Ansatz wird die Gefahr einer vertieften Spaltung der Gesellschaft, die im Fall der Gruppenautonomie droht, vermieden. Kritiker bezweifeln jedoch, ob dieser Ansatz praktisch realisierbar ist und hinreichende Garantien für einen dauerhaften Minderheitenschutz bietet.
In der Realität der meisten Mehrheiten-Minderheiten-Beziehungen sind Regelungen nach dem Muster des einen oder anderen Ansatzes erst nach einer langen und mühsamen Zeit der Auseinandersetzung über die Forderungen der Minderheiten zu erreichen. Um diesen Prozeß erfolgreich zu gestalten, reicht es keinesfalls aus, die Legitimitätsansprüche der Mehrheitsdemokratie und des Minderheitenschutzes einander abstrakt entgegenzustellen. Wesentlich ist vielmehr, zwischen den und innerhalb der beteiligten Parteien einen Lern- und Problemlösungsprozeß zu organisieren, der den historischen Beziehungserfahrungen miteinander Rechnung trägt und beide Seiten befähigt, eine auch für die andere Seite akzeptable Form der Machtteilung gemeinsam aufzubauen.
Das Beispiel der rumänisch-ungarischen Beziehungen seit 1989/90
Im folgenden soll der Beginn eines solches Prozesses am Beispiel der rumänisch-ungarischen Beziehungen seit dem Sturz des Ceaucescu-Regimes 1989/90 dargestellt werden. Das besondere an diesem Konflikt ist zunächst, daß es sich nicht nur um ein Verhältnis zwischen (rumänischer) Mehrheit und (ungarischer) Minderheit innerhalb eines Staates handelt, sondern zugleich auch um die Beziehungen zwischen zwei Nachbarstaaten.3 Die Existenz des »kinstates« Ungarn stärkt einerseits die Position der Minderheit; andererseits schürt aber gerade diese Tatsache auch Bedrohtheitsvorstellungen auf Seiten der Mehrheit, der Nachbarstaat arbeite auf eine erneute Revision der Grenzen hin oder strebe zumindest ein Mitspracherecht in den inneren Angelegenheiten der ungarischen Diaspora in Siebenbürgen an. Eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung muß deshalb beide Ebenen der rumänisch-ungarischen Beziehungen berücksichtigen.
Für beide Seiten repräsentiert Siebenbürgen (rumän. Transilvania, ungar. Erdély) ein historisches Trauma: Die Rumänen nehmen die Geschichte dieses Landesteils vor allem unter dem Aspekt der jahrhundertelangen imperialen Unterdrückung durch die ungarischen Feudalherren und die Habsburger Doppelmonarchie wahr, die erst mit dem Vertrag von Trianon 1920 und der Vereinigung mit dem restlichen Rumänien ein Ende fand. Umgekehrt sind es gerade dieser Vertrag bzw. die aus ungarischer Sicht seitdem nicht eingehaltenen Zusagen eines besonderen Schutzes der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen, die bis heute die Beziehungen belasten. Bis heute unbewältigt ist auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als der nördliche Teil Siebenbürgens von 1940 bis 44 erneut Ungarn zugeschlagen wurde und von Ungarn, Deutschen wie Rumänen eine Unzahl von Kriegs- und Vertreibungsverbrechen begangen wurden.
Der Umsturz vom Dezember 1989 führte unmittelbar zu einer eigenständigen Interessenvertretung der 1,6 bis 2 Millionen umfassenden ungarischen Minderheit in Rumänien (RMDSZ). Diesem Verband, der sich wenig später auch als Partei konstituierte,4 gelang es bei allen bisherigen Wahlen, die weit überwiegende Zahl der ungarischen Wahlberechtigten für sich zu gewinnen – ein deutlicher Indikator für die ethnische Spaltung des politischen Systems. Im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung Rumäniens von knapp 23 Millionen stellen die Ungarn nach offiziellen Angaben 7,1<0> <>%. Bezogen auf Siebenbürgen beträgt ihr Bevölkerungsanteil über 20<0> <>%, in zwei Landesbezirken (Harghita und Kovasna) stellen sie die Bevölkerungsmehrheit.
Bis zu den Präsidenten- und Parlamentswahlen im November 1996 wurde der Konflikt auf der politischen Ebene überwiegend ausgetragen zwischen dem RMDSZ einerseits und der dem früheren Präsidenten Iliescu nahestehenden regierenden Partei der Sozialen Demokratie (PDSR) sowie einigen kleineren rechtsextremen und nationalistischen Parteien andererseits, für die die „ungarische Gefahr“ einen der zentralen Programmpunkte darstellt. Zur Opposition gehörten bis zum November die aus der Übergangsregierung unter Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Roman hervorgegangene Sozialdemokratische Union (USD) sowie ein Spektrum kleinerer Parteien von Christdemokraten über Liberale bis hin zu Sozialdemokraten, die sich in einer Demokratischen Konvention (CDR) zusammengeschlossen hatten. Sie vertraten in Fragen der Minderheitenpolitik eine gemäßigte Position.
Nationaler Zentralstaat versus Multinationale Föderation
Der Kernkonflikt in der Phase von 1990 bis 96 läßt sich am treffendsten durch die Gegenüberstellung der verfassungspolitischen Grundpositionen beider Seiten beschreiben. In Anlehnung an das 1918/19 entstandene großrumänische Reich nach französischem Vorbild wird Rumänien in der Verfassung von 19915 als einheitlicher Nationalstaat definiert (Art. 1), in dem lediglich der rumänischen Nation(alität) ein staatsbildender Charakter zugebilligt wird (Art. 4) und in dem nur Rumänisch als offizielle Sprache anerkannt ist (Art. 13). In Art. 6 werden zwar auch die „nationalen Minderheiten“ anerkannt und der „Ausdruck, die Erhaltung und Entwicklung ihrer Identität“ unter den Schutz des Staates gestellt. Zugleich wird jedoch ausdrücklich betont, daß keine Maßnahmen zu ihren Gunsten ergriffen werden dürfen, die andere rumänische Staatsbürger in ihren Rechten und Ansprüchen auf Gleichbehandlung diskriminieren.
Die ungarische Interessenvertretung RMDSZ hat demgegenüber ihre Grundvorstellungen einer »Machtteilung durch Gruppenautonomie« in einem Minderheitengesetzentwurf von 1993 niedergelegt.6 Danach werden die nationalen Minderheiten als „staatsbildende Gemeinschaften“ zusammen mit der rumänischen Mehrheitsnation betrachtet (Art. 2). Zugleich wird gefordert, daß die nationalen Minderheiten als „autonome Gemeinschaften“ und „politische Subjekte“ anerkannt werden, denen aufgrund „interner Selbstbestimmung“ das Recht auf „personale Autonomie“ und lokale Selbstverwaltung sowie auf regionale Autonomie zusteht (Art. 2, 6). Die Etablierung von Gruppenrechten auf nicht-territorialer Basis (»personale Autonomie«) soll sich vor allem auf Fragen des Schul- und Hochschulsystems, der Kultur- und Medienpolitik beziehen. Die territoriale Selbstbestimmung wird im Vergleich dazu für alle Fragen der Kommunal- bzw. Regionalverwaltung in jenen Gebieten gefordert, in denen die (ungarische) Minderheit die örtliche Mehrheit stellt. In den übrigen Gebieten soll sie ein begrenztes Vetorecht in allen „identitätsrelevanten“ Fragen erhalten (Art. 8).
Die ungarische Seite sieht sich durch die rumänische Verfassung als Staatsbürger zweiter Klasse diskriminiert. Sie macht geltend, daß es nach Jahrzehnten der Unterdrückung endlich an der Zeit sei, ihr zumindest einige jener kollektiven Rechte zuzugestehen, die sie als ständische Nation in Siebenbürgen über Jahrhunderte hinweg innegehabt hat. Sie stellt dieses Anliegen als einen integralen Teil eines umfassenden Programms zur Förderung von demokratischen, rechtsstaatlichen und marktwirtschaftlichen Verhältnissen in Rumänien dar. Legitimiert fühlt sie sich überdies durch die „Empfehlung 1201“ der Parlamentarischen Versammlung des Europarates von 1993, in der nationalen Minderheiten ebenfalls Gruppenrechte zugestanden werden, insbesondere, im Fall örtlicher Mehrheitsverhältnisse, ein Gruppenrecht auf Selbstverwaltung.7 Um ihren Forderungen internationale Resonanz zu geben, verfaßte die RMDSZ-Vertretung anläßlich der Verhandlungen Rumäniens um Aufnahme in den Europarat ein Memorandum, in dem sie die Gewährung derartiger Gruppenrechte als Voraussetzung für die »Europatauglichkeit« des Landes darstellte.
Die damalige rumänische Regierung und ein Teil der Oppositionsparteien betrachteten die konstitutionellen Kernforderungen der ungarischen Seite von 1993 als nicht verfassungskonform und ihre Präsentation gegenüber den europäischen Institutionen als höchst illoyal. Die nationalistischen Parteien bezeichneten sie sogar als verfassungsfeindlich und als hinreichenden Grund, um den RMDSZ-Verband zu verbieten. Das offizielle Rumänien konnte außerdem darauf verweisen, daß es auf gesamteuropäischer Ebene bislang keinesfalls einen Konsens über die Gewährung kollektiver Minderheitenrechte gibt.
Die ungarische Seite befand sich bei diesem Konflikt zwar in der Minderheitenposition, sie verstand es jedoch auf geschickte Weise, nicht nur die ungarische Regierung für ihre Belange zu mobilisieren, sondern auch die multilateralen europäischen Institutionen und deren Bemühungen um die Verstärkung des Minderheitenschutzes für sich zu nutzen. Unabhängig von der Minderheitenvertretung nutzte auch die Regierung in Budapest dieses Thema für die eigene innen- und außenpolitische Profilierung. Am folgenschwersten war dabei Anfang der neunziger Jahre die Äußerung József Antalls, er betrachte sich als Ministerpräsident von „15 Millionen Ungarn“ (angesichts einer Bevölkerungszahl von rund 10 Millionen in der Republik Ungarn). Diese Äußerung schürte naheliegenderweise das Mißtrauen in Rumänien gegenüber allen Initiativen des Nachbarlandes zugunsten seiner Minderheit.
Der größte Teil der Minderheitenschutz-Bestimmungen der KSZE/OSZE und des Europarates hat zwar nur Empfehlungscharakter, außerdem glänzen viele westeuropäische Staaten auf diesem Gebiet nicht gerade als Vorbilder, gleichwohl gibt es einen starken Trend in den euro-atlantischen Strukturen zum Ausbau des Minderheitenschutzes als wichtigem Hebel zur Prävention gewaltsamer Konflikte und zur Befriedung der östlichen Transformationsgesellschaften. Einen institutionellen Ausdruck fand diese Politik im „Stabilitätspakt“ der OSZE-Mitgliedsstaaten vom März 1995. Dieses vom damaligen französischen Premierminister Balladur initiierte Vertragswerk legt den östlichen Beitrittskandidaten zu den euro-atlantischen Strukturen nahe, ihre internen Streitigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Grenzen und die Behandlung von Minderheiten durch Grundlagenverträge zu regeln. In der Folgezeit erwiesen sich insbesondere die Vertragsverhandlungen zwischen Rumänien und Ungarn als die schwierigsten.
Der ungarisch-rumänische Grundlagenvertrag vom September 1996
Zur Unterzeichung des Vertrages kam es schließlich am 16. September 1996.8 Zu den kritischen Punkten gehörten vor allem die Garantie der Minderheitenrechte und entsprechende Kontrollmechanismen, insbesondere die Möglichkeiten ihrer (rechtlichen) Einklagbarkeit, die bereits anderthalb Jahre zuvor zu einer Verhärtung der Fronten im Zusammenhang mit dem im März 1995 ratifizierten Grundlagenvertrag zwischen Ungarn und der Slowakei geführt hatten. Von anderen umstrittenen Detailfragen des Vertrages abgesehen, bot dieser Komplex allein ausreichend Konfliktstoff und führte zu heftigen, auch innerstaatlichen Kontroversen. Insbesondere in Ungarn ließen diese bis zuletzt die erforderliche Ratifizierung durch das Parlament als nicht gesichert erscheinen. Die Debatte führte zu einem Schulterschluß der ansonsten heillos zerstrittenen ungarischen parlamentarischen Opposition, die sich in einer gemeinsam mit diversen national orientierten Vereinigungen veröffentlichten Stellungnahme hinter die Kritik und die Forderungen der ungarischen Opposition in Rumänien stellte. In Rumänien zerbrach an dieser Diskussion zwei Monate vor den Wahlen die damals amtierende Regierungskoalition, da die nationalistische Partei der Nationalen Einheit (PUNR) die Ungarnpolitik des stärkeren Partners, der Partei der Sozialen Demokratie (PDSR), als „Verrat nationaler Interessen“ entschieden ablehnte.
Der RMDSZ-Verband bemängelte vor allem, daß der Vertrag gerade die zentralen politischen Autonomie-Forderungen der ungarischen Minderheit außer acht lasse. So werde die Empfehlung 1201 der Parlamentatischen Versammlung des Europarates im Text zwar als rechtsverbindlich aufgeführt, zugleich jedoch durch eine auf rumänische Initiative nachträglich eingefügte berühmt-berüchtigte Fußnote wieder entwertet.9 Außerdem sei die Frage der Rückgabe der Kirchengüter ausgeklammert worden, um einem abermaligen Scheitern der Unterzeichnung in letzter Minute vorzubeugen.
Der Grundlagenvertrag beinhaltet die Anerkennung der Unverletzbarkeit der Grenzen und der territorialen Integrität beider Staaten und erfüllt damit die vom Westen formulierten Voraussetzungen für eine Aufnahme in die EU wie die NATO – ein Ziel, das sowohl in Ungarn als auch in Rumänien an oberster Stelle der politischen Tagesordnung rangiert. Dieser Aspekt hat letztlich wohl auf beiden Seiten den Ausschlag gegeben, dem Kompromißdokument zuzustimmen. Aus der Sicht der ungarischen Regierung wird außerdem ins Feld geführt, daß die Forderungen der Minderheit auf Wahrung ihrer nationalen Identität nicht primär durch vertragliche Verpflichtungen Rumäniens zur Einführung der Gruppenautonomie realisiert werden kann. Die real gegebenen politischen Bedingungen in Rumänien hätten in den vergangenen sechs Jahren gezeigt, daß ohne einen umfassenden politischen Strukturwandel hin zu einer demokratischen Konfliktkultur sowie einer umfassenden Zivilgesellschaft der Status der ungarischen Minderheit nicht dauerhaft verbessert werden könne. Vor dem Hintergrund des permanenten Vorwurfs der Illoyalität und des (unterstellten) Irredentismus nicht nur von populistischen und nationalistischen Kräften in Rumänien, hätte man deshalb mit dem formellen Bestehen auf Gruppenautonomie für die Ungarn nur wenig bewirken können.
Am 10. Dezember 1996 wurde der Vertrag nach hitzigen Debatten im ungarischen Parlament ratifiziert. Dabei artikulierten Oppositionsvertreter erneut Bedenken, die auf rumänischer Seite dem Verdacht der Grenzrevision neue Nahrung gaben. So wurde etwa vorgetragen, daß der Grundlagenvertrag hinter die Bestimmungen der KSZE-Schlußakte von 1975 zurückfalle; denn deren Prinzipienkatalog schließe eine mit friedlichen Mitteln angestrebte Grenzrevision nicht kategorisch aus. Insgesamt besteht mit dem Grundlagenvertrag jedoch wohl die Chance, ein neues Kapitel in den ungarisch-rumänischen Beziehungen aufzuschlagen.
Der Machtwechsel in Rumänien: Das Ergebnis der Wahlen im November 1996
Noch bedeutsamer als der Vertrag dürfte allerdings ein anderer politischer Einschnitt gewesen sein: der Macht- und Regierungswechsel in Rumänien vom November 1996. In der neuen Regierungskoalition ist neben der liberal-konservativen Demokratischen Konvention (CDR) und der Sozialdemokratischen Union (USD) mit dem RMDSZ erstmals seit 1990 auch die ungarische Minderheit vertreten. Des weiteren hat das Kabinett nicht nur ein ehrgeiziges Reformprogramm zur Konsolidierung der maroden rumänischen Wirtschaft und zur Lösung der dringlichsten sozialen Probleme aufgestellt. Unmittelbar nach der Regierungsbildung intensivierte sie den Kontakt mit der ungarischen Regierung, und bereits Anfang Dezember 1996 nutzten Horn und der neue rumänische Staatspräsident Constantinescu während des OSZE-Gipfels in Lissabon die Gelegenheit zu ersten Gesprächen. Dabei wurde von beiden Seiten die Bereitschaft zu weiteren Treffen auf höchster Ebene erklärt. Ein vielversprechendes Signal angesichts der Tatsache, daß es in den vergangenen sieben Jahren zu keinem offiziellen Besuch der Staats- oder Ministerpräsidenten in Bukarest oder Budapest gekommen war.
Die Kursänderung der neuen rumänischen Führung im Hinblick auf die ungarische Minderheit und den ungarischen Nachbarstaat ist freilich nicht zu verstehen ohne die Hoffnung, mit ungarischer Unterstützung doch noch in der für die kommenden Jahre erwarteten ersten Aufnahmerunde in die EU und NATO berücksichtigt zu werden. Nicht nur in Ungarn ist man sich darüber im klaren, daß der Weg Bukarests in die euro-atlantischen Strukturen über Budapest führt. Die Chancen für einen von der rumänischen Regierung angestrebten gleichzeitigen Beitritt beider Staaten sind zwar gering, nichtsdestotrotz läßt die rumänische Diplomatie kaum eine Gelegenheit aus, um die verantwortlichen Gremien hiervon zu überzeugen.
Die Tatsache, daß der RMDSZ seit Dezember als dritter Koalitionspartner die Regierungsgeschäfte mitbestimmt, ist unter zwei Gesichtspunkten interessant. Rein rechnerisch waren die CDR und USD, die sich sehr rasch auf eine gemeinsame Regierungsbildung verständigten, nicht auf die 6,8<0> <>% bzw. 6,6<0> <>% der Stimmen (verteilt auf Senat und Abgeordnetenhaus) der RMDSZ angewiesen. Allerdings hatte die fast geschlossene Unterstützung der ungarischen Wähler für die Opposition wesentlich zum Sturz der ehemaligen Regierung beigetragen. Angesichts des zu bewältigenden Reformprogramms lockte zudem die Aussicht, mit dessen Hilfe ein stärkeres Gegengewicht gegenüber der in ihrer neuen Rolle gewiß nicht zimperlich agierenden Opposition bilden zu können.
Es gab allerdings auch Widerstand aus den Reihen der CDR. Deren führende Kraft, die Christlich-Demokratische Partei, zeigte sich anfangs nur leidlich begeistert von der Vorstellung, die Regierungsverantwortung mit dem Ungarnverband zu teilen, der Anfang 1995 aufgrund inhaltlicher Differenzen aus der Demokratischen Konvention ausgeschieden war. Aber auch innerhalb des RMDSZ gab es Vorbehalte gegenüber der Option, den nicht nur Nachteile mit sich bringenden Oppositionsstatus aufzugeben. Vertreter des »radikalen« Flügels warnten vor allzu teuren Kompromissen auf Kosten des »Ungarntums« in Rumänien. Dabei handelte es sich auch um eine Frage des Image: auf internationalem Parkett in Zukunft nicht mehr als Vertreter einer unterdrückten Minderheit auftreten zu können, war eine Sache. Viel schwerer wog demgegenüber die Befürchtung, sich im Rahmen der Regierungsverantwortung gegebenenfalls zum »Kollaborateur« oder Helfershelfer zu machen. Am Ende siegte sowohl in der CDR und USD als auch im RMDSZ die Überzeugung, daß eine Koalitionsbeteiligung des Ungarnverbands einen bedeutenden Fortschritt bezüglich einer historischen Aussöhnung des rumänischen Mehrheitsvolkes mit der ungarischen Minderheit in Aussicht stelle.
Am 6. Dezember 1996 unterzeichneten die neuen Koalitionspartner ein Solidaritätsabkommen im Hinblick auf die gemeinsam gesetzten Ziele. Ausdrücklich erwähnt wird dabei neben den sozialen, wirtschaftlichen und administrativen Reformplänen auch das Bestreben, Grundlagen für eine nationale Aussöhnung zu schaffen und die Entwicklung eines Modells zur Verbesserung des interethnischen Zusammenlebens voranzutreiben.
Wichtig für die künftige Gestaltung der rumänisch-ungarischen Beziehungen sind auch die Besetzung des Außenministerpostens mit Adrian Severin (Mitglied der Demokratischen Partei) und die Berufung von zwei Vertretern des RMDSZ in das Kabinett: Akos Birtalan als Tourismus-Minister und Tokay György als Minister ohne Geschäftsbereich, aber mit Zuständigkeit für Minderheitenfragen. Adrian Severins frühes Engagement für die europäische Integration des Landes hat ihm unter seinen ungarischen Kollegen viel Anerkennung eingetragen. Von ihm erhofft man sich auch in Budapest ein stärkeres Entgegenkommen bei der Umsetzung des Grundlagenvertrages. Auch unterhalb der Ministerebene ist es mit der neuen Regierung zu einer verstärkten Beteiligung von RMDSZ-Vertretern gekommen, insbesondere in den politischen Stäben wichtiger Behörden und Gremien sowie bei der Ernennung von Präfekten und ihren Stellvertretern in den regionalen Verwaltungsbezirken.
Die politische Programmatik der neuen rumänischen Regierung steht unter dem Motto einer umfassenden Reform des Wirtschafts- und Sozialsystems sowie einer Dezentralisierung des Verwaltungsystems – angesichts der Spannweite der Koalition von liberalen und sozialdemokratischen Parteien bis zu ausgesprochen konservativen Kräften keine leichte Aufgabe. Erschwert wird sie dadurch, daß das Land in mehrfacher Hinsicht von brisanten Spaltungen gekennzeichnet ist. So stehen der Regierungskoalition bis auf weiteres die bislang wenig reformgeneigten Kräfte in der Bürokratie und den immer noch dominierenden Staatsunternehmen entgegen, kräftig unterstützt von der neuen Opposition, die die »nationale Karte« schon bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen massiv in Anspruch nahm. Die Kluft zwischen Modernisierungsgewinnern und -verlierern dürfte sich weiter vertiefen. Nicht auszuschließen ist auch, daß die Differenzierung des Landes in einen westlichen, überwiegend reformfreundlichen Teil (mit einem Schwergewicht in Siebenbürgen), der mehrheitlich für die neue Regierungskoalition stimmte, und einen östlichen, reformskeptischen Teil sich fortsetzt.
Unter diesen Rahmenbedingungen hat der Ungarnverband seine programmatischen Forderungen nach Gruppenautonomie zurückgestellt und sich im Rahmen der Reformpolitik auf jene Ziele konzentriert, die für den Ausdruck und die Erhaltung der kulturellen Identität vorrangig erscheinen:
- die Reform des Schul- und Hochschulrechts zugunsten eigenständiger ungarischer Bildungsinstitutionen sowie einer Stärkung des muttersprachlichen (ungarischen) Unterrichts;
- die Nutzung des ungarischen Sprache im öffentlichen Leben bis hin zur Zweisprachigkeit in Gemeinden und Regionen bei einem Mindestanteil der ungarischen Bevölkerung;
- die Rückgabe bzw. Entschädigung des enteigneten Kirchenbesitzes.
Machtgewinn durch Macht- teilung: Die Transformation von Mehrheiten-Minderheiten- Konflikten
Was aus dem Experiment der neuen rumänisch-ungarischen Regierungskoalition wird, ist derzeit noch völlig offen. Bedeutsam ist jedoch in jedem Fall, daß es nach sechs Jahren der Konfrontation zwischen den politischen Vertretungen der Mehrheit und der (wichtigsten) Minderheit überhaupt zu einer Verständigung über ein gemeinsames Reformkonzept gekommen ist. Dieses Konzept beruht darauf, daß beide Seiten die Kontroverse »nationaler Zentralstaat« versus »multinationale Föderation« vorerst zu den Akten legen und sich auf jene Maßnahmen konzentrieren, bei denen praktische Verständigungen leichter möglich sind. Dazu gehören unter anderem die Dezentralisierung der politischen Strukturen und die Schaffung eines stärker differenzierten Schul- und Hochschulsystems. Zweifellos bleiben auch dabei genügend brisante Punkte übrig, etwa die Forderung nach einer eigenständigen ungarischsprachigen Universität sowie die Bilingualität im öffentlichen Leben. Im Kontext einer Dezentralisierungspolitik, die auch starke integrative Element enthält, erscheinen sie jedoch leichter verhandelbar, als wenn sie die ersten Schritte auf dem Weg zu einer umfassenden Gruppenautonomie repräsentieren.
Die Voraussetzungen für diesen Wandel sind zweifellos vielfältig. Zu bedenken sind die trotz aller Konfliktrhetorik auf beiden Seiten jahrhundertelang angesammelten Erfahrungen des Umgangs miteinander, der Ausgleich der Minderheitenposition durch den »kinstate«, die konfliktdämpfenden Einwirkungen der euro-atlantischen Strukturen, nicht zuletzt wohl auch das abschreckende Szenario der Konflikteskalation im benachbarten (Ex-)Jugoslawien. Eine genaue Betrachtung der politischen Entwicklung innerhalb Rumäniens vor und nach 1989/90 legt freilich noch eine weitere, wichtige Schlußfolgerung nahe: Sowohl für die Minderheit als auch für die Mehrheit war die erste Phase vor allem geprägt durch den Versuch, eine neue kollektive Identität nach der Ceaucescu-Ära zu entwickeln, einer Ära, die nicht nur durch massive Repression und einen bizarren byzantinistischen Personenkult geprägt war, sondern auch durch einen ausgeprägten und von oben verordneten Nationalismus.10
Eine kritische Auseinandersetzung mit den repressiven und byzantinistischen Anteilen dieser Vergangenheit hat bislang nur in sehr begrenztem Umfang stattgefunden. Auch die Umstände des Umsturzes vom Dezember 1989 sind bislang so ungeklärt, daß sich auch aus ihnen keine identitätsstiftenden Bezugspunkte für das neue, demokratische Rumänien ableiten ließen. Unter diesen Umständen erschienen die Nation und der Nationalismus als die am wenigsten belasteten Anknüpfungspunkte für die Schaffung einer neuen kollektiven Identität. Für die ungarische Minderheit war die kollektive Distanzierung von der Ceaucescu-Ära demgegenüber sehr viel leichter. Sie konnten sich als Opfer sowohl des sozialistischen wie des nationalistischen Regimes unter Ceaucescu verstehen und mit der Betonung ihrer Eigenständigkeit ein neues Selbstwertgefühl entwickeln.
Mit anderen Worten: Während der Übergangszeit diente der Mehrheiten-Minderheiten-Konflikt in Rumänien auch dazu, vor dem Hintergrund der jüngeren Vergangenheit Perspektiven für eine zukunftsfähige politische Identität zu entwickeln. Die Erfahrungen während dieser sechs Jahre zeigen nun, daß unter den gegebenen Rahmenbedingungen keine Seite in der Lage ist, ihr Identitätskonzept der anderen Seite aufzuzwingen. Wenn sie an einer konstruktiven Veränderung interessiert sind, ist es sehr viel sinnvoller, wenn beide Seiten ihr jeweiliges Identitätskonzept so weiterentwickeln, daß es auch für die andere Seite attraktiv wird. Ob der gegenwärtige Aufbruch in diese Richtung weist, ist noch offen. Prinzipiell würde ein solcher Ansatz jedenfalls aus rumänischer Sicht mit der Frage verbunden sein: Wie sollte das künftige politische System unseres Landes beschaffen sein, damit die ungarische Minderheit sich mit ihm identifiziert und innerhalb dieses Systems möglichst aktiv am Aufbau eines prosperierenden Landes mitwirkt? Und aus ungarischer Sicht ist zu fragen: Wie können wir unsere Machtteilungs-Vorstellungen so weiterentwickeln, daß sie nicht als erster Dominostein einer späteren Separation erscheinen, sondern als eine auch für die rumänische Seite attraktive Bereicherung des gemeinsamen Staates?
Ausgangspunkt dieses Artikels war die These, daß Machtteilungs-Konzepte einen wichtigen Ansatz darstellen, wie Mehrheiten-Minderheiten-Konflikte konstruktiv bearbeitet werden können. Im Lichte der jüngeren rumänisch-ungarischen Beziehungen läßt sich diese These weiter präzisieren: Machtteilung sollte nicht als ein »Nullsummen-Spiel« des abstrakten Ausgleichens scheinbar statischer und prinzipiell entgegengesetzter Interessen und Prinzipien der politischen Willensbildung betrachtet werden. Längerfristig tragfähige Lösungen sind eher zu erwarten, wenn beide Seiten die Machtteilung auch als einen Machtgewinn für sich betrachten können. Dies ist in aller Regel nur dann zu erreichen, wenn auf beiden Seiten die Bereitschaft und Fähigkeit gewachsen ist, dies als eine Aufgabe zu betrachten, die nur gemeinsam bewältigt werden kann.
Anmerkungen
1) Im folgenden Text wird der Einfachheit halber von „ethnischen“ Gruppen gesprochen, auch wenn es sich im Einzelfall um sprachliche oder religiöse Gruppen handelt. Zurück
2) Einen Überblick über zwei ähnlich unterschiedene, allerdings nicht identische Ansätze gibt Timothy D. Sisk: Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts. Washington 1996. Sisk bezeichnet sie als „consociational“ und als „integrative“ conflict regulating practices. In der Literatur wird der Begriff des „power sharings“ oft auch nur für den ersten Ansatz benutzt. Zurück
3) Die nicht-ungarischen Minderheiten in Rumänien sollen hier nicht berücksichtigt werden. Sie sind auch entweder quantitativ weniger bedeutsam oder werfen strukturell grundsätzlich andere Probleme auf, wie im Fall der Roma. Zurück
4) Die Abkürzungen der Parteien folgen bei ungarischen Organisationen der ungarischen Sprachregelung, bei rumänischen der rumänischen Sprachregelung. Zurück
5) ROMPRES (Hg.): Constituent Assembly: The Constitution of Romania. Bucharest 1991. Zurück
6) Democratic Alliance of Hungarians in Romania (Hg.): Documents 1. o.O. 1994. Zurück
7) Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1201 on an Additional Protocol on the Rights of National Minorities to the European Convention on Human Rights. Strasbourg 1993. Zurück
8) International Law Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary (Hg.): Treaty between the Republic of Hungary and Romania on Understanding, Cooperation and Good Neighbourhood. Budapest 1996. Zurück
9) „The Contracting Parties agree that Recommendation 1201 does not refer to collective rights, nor does it impose upon them the obligation to grant to the concerned persons any right to a special status of territorial autonomy based on ethnic criteria.“ Zurück
10) Vgl. Katherine Verdery: National Ideology Under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceausescus Romania. Berkeley u.a. 1991. Zurück
Christiane Dick ist Studentin der Balkonologie und der südosteuropäischen Geschichte. Dr. Norbert Ropers ist Leiter des Berghof Forschungszentrums für konstruktive Konfliktbearbeitung.