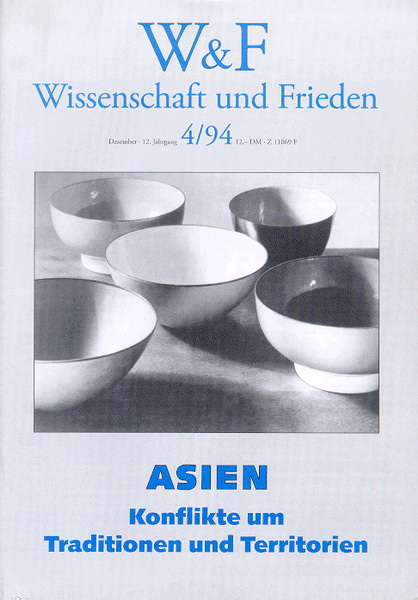Nachholender Globalismus
Bundesregierung und Opposition im Streit um die außenpolitische Standortsicherung
von Lothar Gutjahr
Ein knapper Sieg sei ihm lieber als eine klare Niederlage, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Wahlnacht. Am Ende reichte es der CDU knapp für eine weitere Legislaturperiode. Sie regiert nun mit etwa zweieinhalb Prozent weniger als vier Jahre zuvor; das schlechteste Ergebnis seit 1949, auch wenn sich der Kanzler in der Öffentlichkeit als strahlender Sieger darstellt.
Gerhard Schröder brachte das Resultat denn auch auf den Punkt: Er konstatierte eine „lächerliche Mehrheit“. Die Kanzlermajorität wurde zum einen durch die wider Erwarten erfolgreichen Liberalen gerettet – auch sie Sieger des Abends nach eigenem Bekunden. Zum anderen hätte die Regierungskoalition ohne die Überhangmandate im Bundestag nur mit zwei Stimmen vorn gelegen. Von der Stabilität, die sie im Ausland versprochen hatte, wäre dann nicht viel übrig geblieben. Welche außenpolitischen Ziele werden CDU/CSU und FDP auf der Grundlage ihres knappen Sieges verfolgen?
Das Ende der Wende?
Die Arbeit der CDU/CSU-Fraktion werde nun disziplinierter meinte ihr Vorsitzender; d.h. die Abweichler rechtsaußen werden noch stärker an die Leine des Bundeskanzleramtes gelegt. Mit den Ergebnissen des 1982 angekündigten Wendeprojekts kann jener Teil des konservativen Spektrums trotz aller Kritik an ihrem Kanzler sowieso insgesamt zufrieden sein. Seinerzeit war der Oggersheimer Enkel mit dem Vorsatz angetreten, die Adenauersche Außenpolitik fortzusetzen: Seit der Gründung der Bundesrepublik war die konservative Außenpolitik von dem Ziel bestimmt, das westdeutsche Provisorium zu einem gleichberechtigten Bestandteil im Konzert der Westmächte zu machen, um so eine territoriale Revision zu bewerkstelligen. Nur die Instrumente zur Erreichung der Ambitionen wechselten je nach der internationalen Konstellation.
1990 wurde die Deutsche Frage beantwortet, d.h. die Anormalität der nationalen Teilung ist überwunden. Was bleibt, ist ein Selbstverständnis, das weit weniger auf Blut-und-Boden-Patriotismus baut, als es die öffentliche Rhetorik der Union zuweilen suggeriert. Jenseits seines parteipolitischen Interesses, das nationalkonservative Spektrum für die Mehrheits- und Regierungsfähigkeit zu integrieren, zielt die Logik der Kohlschen Politik auf die Sicherung des Wirtschafts- und Wohlstandsstandortes Deutschland. Der zugrundeliegende Chauvinismus ist eigentlich nicht national sondern ökonomisch, auch wenn er mit der identitätsstiftenden Wirkung eines Nationalismus à la Schäuble kokettiert.
Ein Bruchpunkt gegenüber älteren Konservatismen liegt denn auch eher 1986/87. Damals erkannte die Führung der Union – mit sanftem Druck des liberalen Außenministers – das ein ostpolitischer Wende-Revisionismus unter dem Stichwort „Schlesien bleibt unser“ bei den Alliierten und Partnern nicht durchzusetzen sein würde. Seither reagiert die CDU/CSU auf die Zäsuren im internationalen System mit einer modifizierten Fortschreibung ihres machtpolitischen Standortkonzepts.
Die Interessendefinition als Wirtschafts- und Wohlstandsstandort wird wohl auch künftig der Angelpunkt deutscher Innen- wie Außenpolitik bleiben. Das Wort von der deutschen Normalität ist jüngeren Datums. Inhaltlich ist es eine Umformulierung dessen, was Franz Josef Strauß in den achtziger Jahren forderte: die Bundesrepublik müsse endlich aus dem Schatten Hitlers heraustreten. Nationale Normalität bedeutet zum einen Abschied von der Erblast des deutschen Faschismus (die „Gnade der späten Geburt“) sowie zum anderen die Übersteigerung der Wirtschaftswundermentalität. Ein wirtschaftlicher Riese braucht auch die Instrumente politischer Mitsprachemöglichkeiten – herkömmliche Fixpunkte konservativer Außenpolitik, wie die Verteidigung staatlicher Souveränität werden nicht mehr legalistisch sondern rein ökonomisch-machtpolitisch gefaßt. Was hinten rauskommt zählt.
Die nächsten vier Jahre Kohl werden die Fortschreibung des »nachholenden Globalismus« bringen, der in der Tradition Adenauers nicht auf ein Endziel abstellt, sondern pragmatisch die Ausweitung machtpolitischer Optionen betreibt. Zunächst wird es also wohl nicht um ein weltweites militärisches Engagement gehen, wie einige KritikerInnen bereits befürchten. Unter Umständen wird es in den kommenden Jahren gar keinen weiteren Somalia-ähnlichen Einsatz der Bundeswehr geben. Solche Unternehmungen haben ihren innenpolitischen Zweck als PR-Kampagne erfüllt. In der kommenden Phase der Ausweitung machtpolitischer Handlungsfähigkeit »in und für Europa« ist es für die Regierung Kohl wesentlicher, die eigenen Optionen strukturell zu verbessern.
In diesem Zusammenhang war die Auseinandersetzung über die Rolle der Bundeswehr von strategischer Bedeutung. Im Zwist um die grundgesetzliche Zulässigkeit von Auslandseinsätzen der Bundeswehr wurde eigentlich der politische Streit um die zivile Orientierung des ehemaligen Handelsstaates ausgetragen. Die Entscheidung des Bundesverfasungsgerichts vom Sommer 1994 hat den Kampf um die Legalität beendet. Der nächste Baustein konservativer Strategen ist die politisch-faktische Normalisierung. Deutschlands akzeptierte Rolle in internationalen Organisationen, wie dem UN-Sicherheitsrat, der Atlantischen Allianz oder der gemeinsamen europäischen Außenpolitik (GASP) soll ausgebaut werden. Dennoch wird die Bundesrepublik noch auf längere Sicht kein normaler Staat sein und vielleicht nie werden: das historisch begründete Mißtrauen der Partner/Nachbarn, die andauernde Konzentration auf den Aufbau-Ost und die keineswegs eindeutige Unterstützung der WählerInnen für den Kurs des Kanzlers werden dies be- oder verhindern.
Beinahe vierzig Jahre nach der (west) deutschen Wiederbewaffnung entscheidet sich in der Debatte über den künftigen Auftrag und die Struktur der Bundeswehr, ihre Größe, Bewaffnung und innere Führung sowie ihre Vernetzung mit den Streitkräften anderer euro-atlantischer Länder der Charakter der Republik. Die öffentliche Auseinandersetzung wird wahrscheinlich weniger spektakulär verlaufen als seinerzeit zwischen Adenauer und Schumacher. Auch gibt es brisantere Kontroversen im Sozial- und Wirtschaftsbereich. Aber materiell wird die Heeresreform zum Fundament der künftigen Rolle Deutschlands in der Welt. Setzen sich die Konservativen, getrieben von Naumanns Hardthöhe durch, wird die Bundesrepublik strukturell dazu in der Lage sein, militärische Macht über größere Entfernungen zu projezieren. Zwar erlangt sie auf absehbare Zeit kaum eine einseitige Interventionsfähigkeit. Ihr fehlen die Beschaffungsressourcen für einen schnellen Umbau, die Truppentransporter sowie die technische Infrastruktur für ein modernes Schlachtfeldmanagement. Im Rahmen multinationaler Verbände der WEU und/oder NATO, politisch koordiniert durch KSZE und/oder UNO, wäre Deutschland dennoch mehr als nur ein normaler Bestandteil der dominierenden Industriestaatenlobby. Ohne die alarmistische Wende-Rhetorik der frühen Jahre schaffen CDU, CSU und FDP machtpolitische Instrumente, deren Erhaltung sich im Hinblick auf den weltweiten Konkurrenzkampf lohnt. Eine konservative Revolution im High-tech-Zeitalter.
Die zweite, unter strategischen Gesichtspunkten relevante Debatte der kommenden vier Jahre zeichnete sich bereits vor dem Wahltag im Oktober ab. Mit ihren Thesen zu einem Kerneuropa setzten Schäuble und Lamers erste Signale. Beide sind keine unbedarften Hinterbänkler, wohl aber ausgewiesene National- bzw. Eurokonservative mit Gespür für machtpolitische Chancen. Ihre Vorstellungen liegen im Trend der konservativen Europadiskussion, die seit Mitte der achtziger Jahre das Schwinden amerikanischer Hegemonie verarbeitet. Seit Dreggers Thesen zur „Selbstbehauptung Europas“ 1987 wird der ehemals vorherrschende Atlantizismus durch eine Europäisierung der Politik ersetzt. Die EG/EU soll mittelfristig zu einer handlungsfähigen Einheit werden, die ihre Interessen v.a. gegenüber den nordamerikanischen und südostasiatischen Wirtschaftskonkurrenten behauptet. Hierzu bedarf es einer Bündelung der ökonomischen und technologischen Innovationspotentiale sowie einer politischen Regulierung, zu der die europäischen Einzelstaaten kaum noch in der Lage sind. VertreterInnen einer EU-Freihandelszone, wie der britische Premier Major haben dieser Strategie kaum etwas entgegenzusetzen, als ihren Selbstausschluß bzw. ihre Veto-Macht, jedenfalls solange Paris und Bonn am gleichen Strang und auf derselben Seite ziehen.
Ob und wann die vom politischen Partner so titulierten „wehleidigen Zweitstimmenschnorrer“ wiedereinmal auf die CDU/ CSU-Linie einschwenken, bleibt abzuwarten. Ein solches Verhalten ist wahrscheinlich, da die FDP die Formulierung deutscher Außenpolitik bereits in den letzten Jahren der Genscher-Ära an die Hardhöhe abgetreten hatte. Akuten Handlungsbedarf gibt es sowieso erst in Vorbereitung auf die Regierungskonferenz 1996. Dann werden Kohl, Waigel und Kinkel Stellung beziehen müssen zu den Fragen der Osterweiterung, Integrationsvertiefung und Demokratisierung. Die Knackpunkte bleiben das Verhältnis zu Rußland, die Gestaltung der gemeinsamen europäischen Außenpolitik (GASP), die Rolle der WEU und die Entscheidungsrechte des Europäischen Parlaments.
Politikwandel oder nur Kanzlerwechsel?
In seiner Münchner Rede bekannte der Kanzlerkandidat, daß es zwischen ihm und dem Amtsinhaber keine außenpolitischen Differenzen gebe. Vielleicht hatte dies mehr mit seiner Wahltaktik als mit seinen Überzeugungen zu tun. Denn von dieser Ausnahme abgesehen hielt sich Rudolf Scharping an die Wiesbadener Beschlüsse seiner Partei: Die Bundeswehr solle sich auch künftig nur an Blauhelmmissionen beteiligen dürfen, nicht aber an Kampfeinsätzen. Weil die innerparteilichen Auseinandersetzung seit dem Golfkrieg allzu heftig gewesen waren, blieb die SPD-Außenpolitik während des gesamten Wahlkampfes profillos.
Diese Konturenlosigkeit hatte ihren Ausgangspunkt eigentlich bereits 1989, als die Orientierungsmarken der Brandtschen Ostpolitik, der Gemeinsamen Sicherheit und der ost-westlichen Streitkultur nicht länger gültig waren. Ohne einen Gegenpol im Osten, der zugleich politischer Gegner und Überlebens-Partner war, fehlte den SozialdemokratInnen das realistische Gestaltungskonzept. Beim Berliner Parteitag überschattete die Aura des Ehrenvorsitzenden diesen programmatischen Mangel. Aber die bald eingesetzten Kommissionen konnten das konzeptionelle Defizit nicht verhehlen: Die Gemeinsame Sicherheit in Europa war zu einer Worthülse geworden, weil ihre VertreterInnen in der neuen Staatenkonstellation keine zwingenden Interessen mehr zum Verzicht auf Krieg feststellen konnten. Ohne den Druck einer vertikalen Atomeskalation wurde Krieg wieder zu einem Mittel der Politik.
Die diversen Konstruktionspläne der SPD einer neuen europäischen Friedensordnung jenseits der Blockkonfrontation stützen sich noch zu wenig auf machtpolitische Analysen. Für ihre Forderungen, die aufflammenden ethno-sozialen Konflikte zu zivilisieren, konnten OppositionsvertreterInnen keine relevanten politischen Instrumente und kaum internationale Partner für Bonn nennen. Die Überwindung der ökonomischen Teilung zwischen Ost und West, Nord und Süd, die Reform der UNO, die gleichzeitige Auflösung von NATO und Warschauer Vertrag, die Stärkung der KSZE-Strukturen oder die Überwindung der Nationalstaaten in Europa blieben Forderungen ohne Durchsetzungsperspektive.
Die Unschlüssigkeit des ehemals dominierenden Frankfurter Kreises nutzten andere Teile der SPD dazu, die Tagespolitik der Regierung zu unterstützen. Langfristig setzten sie auf eine Große Koalition. Dieser (außenpolitische) Strategieansatz vertrug sich zwar kaum mit einem Verzicht auf jede Form der Machtpolitik (wie er im Berliner Progamm 1989 verankert wurde), wohl aber mit einer Normalisierung der Bundesrepublik. Diese Gemeinsamkeit der demokratischen Volksparteien wurde zurecht als politischer Sieg der CDU/CSU gewertet, weil es die SPD-Führung nicht vermochte, dem konservativen Diskurs über Standortsicherung und Normalität eigenständige Signale entgegen- oder zumindest an die Seite zu stellen. Im Kampf um die Besetzung von Begriffen und damit in der Auseinandersetzung um die politische Hegemonie hat die SPD eine Niederlage einstecken müssen, weil sie es versäumte, die eigenen Vorstellungen mit konkreten tagespolitischen Forderungen zu verknüpfen.
Mit der Verabschiedung des revidierten Grundgesetzes und nach dem Karlsruher Urteil über die Auslandseinsätze der Bundeswehr ist der Einigungsdruck auf einem wichtigen Terrain der Auseinandersetzung zwischen Konservativen und SozialdemokratInnen verschwunden. Zwar muß jeder Einsatz künftig durch das Parlament bewilligt werden, aber die einfache Mehrheit genügt hierzu. Die Opposition muß sich nun nach anderen Hebeln zur Einflußnahme auf die Regierungspolitik umsehen.
Für die SPD eröffnet sich hierdurch die Chance, eigene Überlegungen in politisch operative Konzepte umzusetzen. Sie muß sich mit ihren Vorstellungen über die neue Aufgabe und Struktur der Bundeswehr einlassen; die anstehenden Debatten zur Wehrpflicht, zur Ausrüstung oder auch zur inneren Führung der Hardthöhe verlieren den Charakter bloßer Expertenstreits. Bis 1996 steht zudem eine Entscheidung an, wie die SPD den weiteren Gang der europäischen Integration sieht; die Stichworte sind die Gleichen wie für die Bundesregierung, nämlich Osterweiterung, Verhältnis zu Rußland, Integrationsvertiefung und Rolle des Europäischen Parlaments. Die SPD täte gut daran, entsprechende Diskussionen in den Parteigremien, mit ExpertInnen und in der breiten Öffentlichkeit zu beginnen.
In den beiden Feldern Sicherheits- und Europapolitik geht es in den kommenden Jahren um politisch-praktische Prioritätensetzungen – nicht um den Entwurf eines alternativen internationalen Systems. Es könnte die Stunde der ReformerInnen sein, wenn sich Scharpings Team entscheidet, einen klaren Oppositionskurs zu steuern. Vielleicht sollten sie von den Erfahrungen der britischen Labour Party lernen, denen die Ablösung der Konservativen 1992 mißlang. Damals boten diese sich unter der Führung von Neil Kinnock als die besseren Verwalter des Status quo an. Aber ihre Bekehrung zum Atlantizismus und zur Nuklearstreitmacht wurde von der Mehrheit der WählerInnen als unglaubwürdig empfunden.
Wie die SPD, empfanden sich auch Bündnis90/Die Grünen am 16. Oktober als Gewinner. Ein Machtwechsel fand am Rhein zwar (noch) nicht statt, aber sie schafften den Wiedereinzug ins Parlament. Die Vorzeichen zwischen ihren ost- und westdeutschen Teilen sind allerdings in macher Hinsicht verkehrt: 1990 waren es die ehemaligen DDR-BürgerrechtlerInnen, die den bundesweiten grünen Mandatsverlust verhinderten; 1994 haben sich die Westgrünen erholt, aber Bündnis 90 fehlt ein Zugang zu den sozialen Themen, zu örtlich verankerten Mitgliedern und v.a. zu ihren potentiellen WählerInnen.
In der Außenpolitik wird es wohl kaum um eine »Bundesrepublik ohne Armee« (BOA) oder um eine Auflösung der NATO gehen. Vielmehr ist die bündnisgrüne Fraktion unter Joschka Fischer gefordert einen spezifischen Beitrag zur Bündelung von Reformvorstellungen zu leisten. Die Zeiten, in denen es ihre Funktion war, neue Themen auf die politische Agenda zu bringen, sind wohl passé. Wenn Kohl 1998 – oder bereits vorher – abgelöst werden soll, müssen die Oppositionsparteien jetzt damit beginnen, ihre Reformpolitik praktisch glaubwürdig zu machen. Flirts mit schwarz-grünen Konstellationen sind hierbei weniger nützlich als die Rekonstruktion der bündnisgrünen Basis in Ostdeutschland und eine konstruktive Oppositionspolitik in Bonn. Außenpolitisch gäbe es auch keine inhaltliche Basis für eine Annäherung an Kanzler Kohl.
Angesichts der PDS-Konkurrenz könnte einigen die Option einer Fundamentalopposition attraktiv erscheinen. Aber mittelfristig stehen Bündnisgrüne und SPD vor der gleichen Aufgabe: Integration der PostkommunistInnen in das politische Koordinatensystem der Bundesrepublik und demokratische Konkurrenz statt der bisherigen Vollausgrenzung. Auch ohne eine Gleichsetzung der politischen Ränder könnte die Linke von bayerischen Konservativen lernen: Dort wurde die rechtextreme Konkurrenz vor allem deshalb aufgesogen, weil sich für ihre nationalistischen Forderungen innerhalb der Union eine Durchsetzungsperspektive bot. Also: Wenn sich die Ostdeutschen mit ihren sozialen Nöten, Wünschen und Hoffnungen in der sozialdemokratischen und/oder bündnisgrünen Politik wiederfinden, wird die PDS überflüssig.
Überhaupt taugt die Debatte über rote Socken jetzt noch weniger als im Wahlkampf. Ohne und gegen die »Besser-Wessis« ist die bereits totgeglaubte Gysi-Partei zu einem ostdeutschen Pendant der CSU geworden. Auch wenn die PDS im Bezug auf ihre Mitglieder- und Besitzstruktur die Nachfolgerin der SED ist, eine solche Etikettierung wird im sechsten Jahr der Einheit unproduktiv. Die Zuordnung schreckt nicht einmal jene, die eine SED-Herrschaft in der DDR persönlich erfahren haben. Statt dessen könnte die PDS zum Sammelbecken eines linken Fundamentalismus auch im Westen werden, je länger sie sich als politischer Paria im Bundestag halten kann. Ansätze hierzu waren in einzelnen Stimmbezirken Bremens, Hamburgs oder Kölns bereits im Oktober zu beobachten.
Aus Sicht des notwendigen Reformprojekts gibt es an der PDS auch ohne eine Betonung der SED-Connection genügend Kritik. In außenpolitischer Hinsicht z.B. hat sich ein Teil ihrer Mitglieder noch nicht von den Schablonen des Kalten Krieges gelöst. Ihr Antimperialismus gleicht eher einer Traditionspflege, denn einer ernsthaften Analyse der »historischen Etappe«. Der größere Teil hat sich aus der Debatte um realistische Alternativen in der deutschen Außenpolitik verabschiedet, was umso erstaunlicher ist, da viele ihrer führenden Mitglieder eigene Regierungserfahrung sammeln konnten. Die PDS hat keine konzeptionelle Durchsetzungsperspektive aufgrund ihres eklatanten Mißverhältnisses zwischen Styling und Substanz, zwischen politischem Anspruch und realer Politikfähigkeit, zwischen dem Symbol Gysi und den Programmaussagen der Restpartei.
Ökonomie steht im Vordergrund
Zusammenfassend muß man nach dem Superwahljahr feststellen, daß die deutsche Außenpolitik von dem ökonomischen Standortkonzept der Konservativen dominiert wird. Die restliberale FDP unterstützt die Akquisition neuer machtpolitischer Instrumente im Sinne eines nachholenden Globalismus. Die Vorstellungen der Reformkräfte sind demgegenüber noch zu unspezifisch und außerdem mit dem Fundamentalismus einer regionalen Milieupartei belastet. Nun kommt es vor allem auf die Richtungsentscheidung der Sozialdemokratie an: Nutzt sie Bundesrat und Bundestag zur aktiven Gestaltung des Politikwandels oder lauert sie auf den Kanzlerwechsel?
Dr. Lothar Gutjahr ist in Hamburg als Wissenschaftlicher Referent in einer Bürogemeinschaft von SPD-Bürgerschaftsabgeordneten tätig. Dr. Lothar Gutjahr, Otto-Ernst-Straße 35, 22605 Hamburg, Tel: (040)8206030 , Fax: (040)37025072