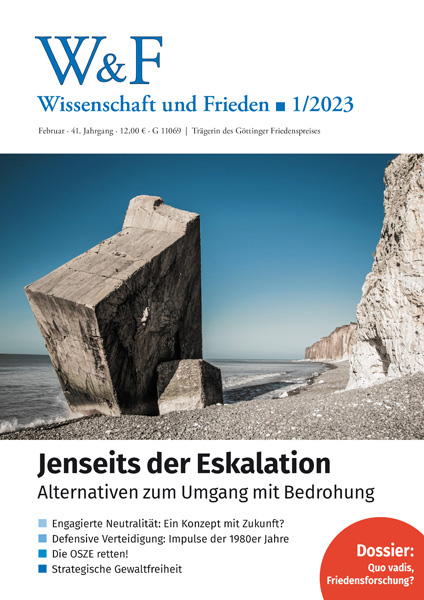„Nächstenliebe, die Mutter aller Kriege“?
Chancen und Grenzen einer Mitleidsethik als Friedensethik
von Konstantin Funk
Für den englischen Moralphilosophen Bernard Williams ist der Beginn ethischen Verstehens ganz unmittelbar an das Mitgefühl geknüpft: Wenn ich nicht mit meinem Gegenüber mitempfinde, so entdecke ich auch keine Gründe, ihm zu helfen, also etwas zu tun oder zu unterlassen. Die moderne Emotionsforschung scheint dem fünfzig Jahre alten Text von Williams Recht zu geben: Emotion und Empathie haben als kognitiv gehaltvolle Wahrnehmungen Erkenntniskraft! Ist das emotionale Miterleben, also Empathie, auch der Startpunkt einer gelingenden Friedensethik?
Der Versuch einer erkenntnistheoretischen Verhältnisbestimmung von Emotion, Gefühl, Affekt auf der einen und Vernunft und Verstand auf der anderen Seite ist so alt wie die Philosophie. Fast immer fiel die Entscheidung zugunsten der Vernunft aus; Gefühle schienen Störfaktoren, die vom Eigentlichen ablenken. Wollte man objektiv urteilen, die Dinge klar und deutlich sehen, so waren subjektive Gefühlswelten nicht gefragt. Immerhin, so eine klassische metaethische Argumentation des ausgehenden 19. Jahrhunderts, spielen sie in den Naturwissenschaften auch keine Rolle im Erkenntnisprozess: CO2 + H2O ergibt H2CO3, egal was ich dabei empfinde. Heute weiß man aber, dass Emotionen klug gewordene Erkenntnisinstrumente sind, weil sie die Wahrnehmungs»form« darstellen, in die unsere lebensweltliche Erfahrungshistorie gegossen wird. Heutzutage wird weniger ein Entweder-Oder diskutiert als vielmehr die jeweiligen Grenzen von Vernunft, von Emotion und Empathie. Immerhin erscheinen letztere mit Blick auf die aktuelle Publikationsfülle zum Thema „nahezu als Allheilmittel gegen Krieg, Leid und Ungerechtigkeit“, wie Fritz Breithaupt schreibt (2019, S. 11). Das aber, so Breithaupt, sei zu einfach, weil wir in aller Regel nur mit unseren Nächsten und Liebsten und weniger mit dem Fremden und Unbekannten mitfühlen und wir gerade deshalb „Schreckliches mit und aus Empathie tun“ (ebd.).
In der Tat: Dass unser Mitgefühl Grenzen hat, ist offensichtlich. Hat es das nicht, folgen auf der anderen Seite empathische Überanstrengung und Überforderung bis hin zur Selbstaufgabe. Die Begegnung zweier großer Philosophinnen Anfang des 21. Jahrhunderts zeugt davon.
„Eine große Hungersnot hatte China heimgesucht, und man hatte mir erzählt, daß sie bei Bekanntgabe dieser Nachricht in Schluchzen ausgebrochen sei: diese Tränen zwangen mir noch mehr Achtung für sie ab als ihre Begabung für Philosophie. Ich beneidete sie um ein Herz, das imstande war, für den ganzen Erdkreis zu schlagen.“ (De Beauvoir 1997, S. 347, meine Hervorh.)
Simone De Beauvoir trifft Simone Weil an der Sorbonne und beschreibt hier eine Erinnerung an die für ihre Aufopferung und Hingabe bekannte Philosophin in jungen Jahren; beide bereiten sich gerade auf die gleichen Prüfungen vor. Weil scheint das beste Beispiel für eine Karriere machende Überlegung in Bernard Williams’ Erstlingswerk »Morality. An Introduction to Ethics« zu sein: Williams schlägt gleich im ersten Kapitel vor, den Startpunkt eines jeden moralischen Verstehens weniger im rationalen Argument als viel mehr im Mitgefühl zu verorten. Hier würden Handlungsgründe entdeckt und barmherzig agiert, hier bemühten wir uns um die Perspektivenübernahme des Gegenübers. Mitgefühl aber haben wir, so behauptet es Williams – ähnlich wie oben auch Breithaupt –, in erster Linie mit den Liebsten in unserem nächsten Umfeld und weniger mit Fremden und Unbekannten. Deshalb sei in Konsequenz dieser allen Menschen gemeinsame empathische Nahhorizont auszuweiten, so dass auch ursprünglich »Außenstehende« ethisch begriffen werden können:
„Wenn wir einem Menschen auch nur ein Minimum von Zuneigung und Mitgefühl mit anderen konzedieren, brauchen wir keine radikal neuen Denk- und Erlebnisweisen zu postulieren, die ihm den Zugang zur Welt der Moral eröffnen könnten; eine bloße Erweiterung von Eigenschaften, die er schon besitzt, genügt“ (Williams 1978, S. 19).
Wenn wir unser Mitgefühl von den Nächsten zum Fremden tatsächlich ausdehnen könnten, so Williams, wäre der erste Schritt ethischen Verstehens, für das Entdecken des zu Tuenden, bereits getan.
Kann das gelingen? Simone Weil verweist in ihrer sie zur Verzweiflung treibenden Begabung, mit dem „ganzen Erdkreis“ (s.o.) mitfühlen zu können, ungeachtet ihrer großen philosophischen wie menschlichen Verdienste auf den Sinn und Zweck von Empathie-Blockaden, die unsere empathische Anteilnahme selektiv filtern. Weil ist nicht nur ein Beispiel für einen herausragenden Geist, sie ist auch Beispiel für eine lebenslange emotional-empathische Überforderung. Die aufopfernde Genese ihrer philosophischen Erkenntnisse wie ihres politischen Engagements und Widerstands, für den sie noch heute zu Recht verehrt wird, lässt sie bis zur Selbstaufgabe nicht ruhen.1
„Ohne Mechanismen oder Techniken der partiellen Empathie-Blockade würden wir in einer Welt des permanenten Perspektiv-Verlusts und eines strukturellen Stockholm-Syndroms leben. Im Extremfall müssten wir ständig unfreiwillig die Perspektiven nicht nur von anderen Menschen, sondern womöglich auch von Tieren oder gar mythischen und fiktionalen Wesen einnehmen und ihr reales oder imaginiertes Erleben teilen. In diesem andauernden geteilten Erleben oder Simulieren der anderen würden wir unseren Selbstbezug verlieren, wie Nietzsche es skizziert.“ (Breithaupt 2019, S. 85)
Genau hieran scheint die junge Philosophin, die mit 34 Jahren an den Folgen von Hunger und an Tuberkulose stirbt, zu leiden. Breithaupt, der in seinem Werk »Die dunklen Seiten der Empathie« mehrere »Gefahren« der aktuellen geisteswissenschaftlichen Empathie-Euphorie herausstellt und die Empathie-Blockade als so notwendig wie parteilich beschreibt, verwendet wenig Platz darauf, genauer auf die zum empathischen Impuls komprimierte Erfahrungsfülle hinzuweisen, die der Emotion und der emotionalen Teilhabe ihren Inhalt und ihre Wirkkraft verleiht. Immerhin ist es das Erlebte, das den Horizont aufspannt, in dem ethisch gehandelt wird, weil mitempfunden werden kann.2 Die von Breithaupt beschriebenen Empathie-Blockaden sind auf der einen Seite sicher notwendig, auf der anderen Seite genauer zu untersuchen. Es gibt sie nicht nur im fühlenden Individuum, sondern auch in vergemeinschafteter Form: Beispiele dafür sind die Duldung von Sklaverei bis ins 19. Jahrhundert, die noch immer nicht erfolgte Gleichstellung der Geschlechter, Rassismus oder die Verachtung Andersdenkender und -lebender innerhalb von Gesellschaften. Das Bewusstsein eines »Wir«, das kulturell rahmt, produziert nicht nur Gemeinschaft, sondern formiert auch »die« anderen, die mit dem »Wir« nicht gemeint sind. Wir haben es also mit einem Spannungsverhältnis zu tun: Während „Moral als kulturelle Praxis […] auch Wir-Gefühle“ verlangt (Breithaupt 2019, S. 206), ist auch auf die kontingente Füllung jenes »Wir« hinzuweisen; es ist keineswegs festgeschrieben, wer damit gemeint sein darf, gemeint sein will, gemeint sein soll.
Parochialer Altruismus – endet unser Mitempfinden an der Ortsgrenze?
Insofern verweist die Schilderung von Simone Weils unbegrenzter Empathie (zumindest wie sie in Simone De Beauvoirs Memoiren dargestellt wird) auf Weil als absolute Ausnahme: In aller Regel gelingt diese Ausweitung des »Wir«, des eigenen Formationsbegriffs, auf den Unbekannten eben nicht, weil sich der Mensch – als zoon politikon – immer schon in einer bestimmten kulturellen Einbettung wiederfindet und fortan orientiert. Das zeitliche und örtliche Situiertsein ist seine zweite Natur. Die Nächsten um uns herum sind uns nun einmal näher als der unterbestimmte Fremde, entsprechend fühlen und handeln wir. Dieses Phänomen nennen der US-amerikanische Ökonom Samuel Bowles und sein Kollege Jung-Kyoo Choi parochialen Altruismus:
„Altruismus ist das Gewähren von Vorteilen für andere auf Kosten der eigenen Person; Parochialismus ist die Bevorzugung ethnischer oder anderer Insider gegenüber Außenstehenden. Beides sind allgemein beobachtete menschliche Verhaltensweisen, die in Experimenten gut dokumentiert sind“ (Bowles 2008, S. 326).
Wir müssen uns also vom fremden Begriff nicht verunsichern lassen. Bowles’ und Chois Studien verweisen auf etwas Alltägliches: Die in unserer Parochie (Pfarrei/Gemeinde) lebenden Nächsten werden im Zweifel immer bevorzugt; alle, die wir nicht zu dieser Gemeinschaft zählen, benachteiligt. Das führt – wie schon Williams richtig festgestellt hatte – zu altruistischem, mitunter empathischem Handeln innerhalb der kleinen Parochie, also innerhalb des emotional-empathisch erschlossenen Nahhorizonts unserer Familie und Freund*innen, aber auch zum Konflikt mit denen, die nicht mehr dazugehören. Das hat sich laut den Forschern evolutionär so durchgesetzt: Treten beide Verhaltensweisen, Altruismus und Parochialismus, getrennt voneinander auf, sind sie für Gruppen nachteilig, „denn sowohl Altruismus als auch Parochialismus verringern die Fitness und den materiellen Wohlstand im Vergleich zu dem, was eine Person gewinnen würde, wenn sie auf diese Verhaltensweisen verzichten würde. Altruistische Handlungen verschaffen anderen per definitionem Vorteile auf Kosten des Altruisten” (Bowles 2008, S. 326). Doch kombiniert man beide Verhaltensweisen, entstehen evolutionär erfolgreiche Synergieeffekte.
Bowles und Choi stellten in ihrer empirischen Forschung mithilfe von Computersimulationen diverse Evolutionsszenarien tausender Generationen unterschiedlich charakterisierter Gruppen nach, aus deren kriegerischen Auseinandersetzungen die parochialen Altruisten immer als Gewinner hervorgingen (vgl. Choi und Bowles 2007, S. 637f.). Das erfolgsversprechende Medium des parochialen Altruismus jedoch war grundsätzlich Krieg mit denen außerhalb jeweiliger Grenzziehungen. Aus diesem Grund überschrieb die Wochenzeitung DIE ZEIT eine gekürzte Version des Papers von Bowles mit »Nächstenliebe, die Mutter aller Kriege« (Bowles 2009). Der Nahhorizont nämlich, dessen Nächstenliebe oder – bei Williams – dessen „mitfühlende Fürsorge“ (Williams 1978, S. 20) den Startpunkt zur „Welt der Moral“ (ebd.) markiert, macht den Menschen gleichzeitig zum brutalen Krieger, weil er nicht nur Nächste zu Nächsten macht, sondern auch Andere zu Anderen und Fremde zu Fremden. Mit ihm erst gewinnen auch Distinktionsmerkmale ihre Kontur.
Samuel Bowles leitet aus den Ergebnissen seiner Arbeit erstaunlicherweise keinen Kulturpessimismus ab, im Gegenteil. Die Entstehungsgeschichte des politischen Europas, das trotz dessen kriegerischer Genese zwischen fünfhundert Stadtstaaten, Diözesen, Fürstentümern und eigenständigen Reichen nun als friedlicher Staatenverbund existiert, verweist für Bowles auf das Friedenspotential altruistischen Verhaltens innerhalb einer maximal ausgedehnten Parochie:
„Der inspirierende Gemeinschaftssinn, der Mut, sich für andere einzusetzen, und die Großzügigkeit, die den Menschen auszeichnen, tragen somit die Geburtsmale einer konfliktreichen Geschichte. Aber unsere Vorfahren führten nicht nur Krieg, sondern schlossen auch Frieden. Sie profitierten von einem Austausch von Gütern, Informationen, Worten, Liedern und Ehepartnern – und nahmen damit die Netzwerke der Risikoteilung, der Freundschaft und des Austauschs vorweg, die unter modernen Sammlern florieren würden.“ (Bowles 2008, S. 327)
Der parochiale Altruismus ist für ihn nicht nur Kriegstreiber, sondern auch „der Geburtshelfer innovativer Institutionen – Einhaltung der Steuervorschriften, Achtung der Eigentumsrechte, Rechtsstaatlichkeit […]“ (Bowles 2008, S. 327). Er ist perspektivisch – wie der Empathie ermöglichende Nahhorizont bei Bernard Williams – die Grundlage für moralische Einsichten innerhalb der altruistischen Wahrnehmung des Anderen als eines Nächsten; bestenfalls irgendwann auch außerhalb der ursprünglichen Parochie und des Nahhorizonts unserer Freund*innen und Familie. Denn die dort gemachten Einsichten, so Bowles ganz ähnlich wie Williams, sind kategorische Einsichten! „Selbst wenn ich also Recht habe, dass eine sehr begrenzte (parochiale) Form des Altruismus Teil des menschlichen Erbes ist, muss [diese enge Grenze] nicht unser Schicksal sein.“ (Bowles 2008, S. 327)
Rollen und Individuum
In meinem Essay im letzten Heft (W&F 4/2022, S. 38ff.: Vom Nächsten zum Fremden) habe ich bereits davon gesprochen, dass in der Parabel des Samariters (Lk 10ff.) klassische vorurteilsbeladene Rollenklischees und damit einhergehende »Parochialismen« auf den Kopf gestellt werden. Empathiegrenzen – und damit Grenzen ethischen Verstehens – werden in der Geschichte neu gesteckt: Der samaritanische Außenseiter wird dem Notleidenden zum Nächsten, die eigentlich Nächsten, Priester und Levit, durch ihre unterlassene Hilfeleistung, durch ihr fehlendes Mitgefühl, zu Fremden. Der Neutestamentler Ruben Zimmermann macht darauf aufmerksam, dass die Räuber durch das Entkleiden ihres Opfers jenem „sinnbildlich den letzten Anhaltspunkt kultureller und sozialer Festlegung“ nehmen (Zimmermann 2007, S. 551). Der Notleidende wird von einer durch eine bestimmte Tracht offenbarten Rolle zum bloßen Menschen (anthrōpos). Das Hilfeleisten des Samariters wird durch diese kompositorische Raffinesse als erstrebenswerte anthropologische Grundeinstellung gegenüber dem Menschen an sich gezeigt. Der Samariter bleibt zwar als Samariter erkennbar – sowohl in der Geschichte selbst als auch für den jüdischen Adressat*innenkreis der Parabel –, erfüllt aber genauso wenig wie Priester und Levit die ihm entgegengebrachten Klischees. Die Erwartungshaltung der adressierten Leser*innenschaft geht ständig fehl; irgendwie steht alles Kopf. Der erzählerische Trick liegt in der ausschließlichen Verwendung von Formationsbegriffen. Die Figuren der Erzählung werden nicht weiter beschrieben, man lernt sie beim Hören und Lesen der Geschichte nicht kennen. Diese erscheinen dadurch bloß als Vertreter von etwas, nicht als jemand, es gibt keinerlei Eigennamen, sondern nur den Priester, den Leviten, den Samariter. Die narrative Form der Parabel zwingt so die Leser*innenschaft, die Leerstellen der Parabel mit ihrem eigenen Vorstellungskanon aufzufüllen. Genau dieser »Füllversuch« – das ist die Intention der Geschichte – schlägt fehl. Die Geschichte ist für unsere Fragestellung interessant, weil unsere moralische Wahrnehmung, die Bowles und Williams untersuchten, tatsächlich so funktioniert. Kennen wir das Gegenüber nicht, sind wir zurückgeworfen auf uns erscheinende Äußerlichkeiten, auf Hinweise auf Kultur, Religion, Herkunft, vielleicht einen Kreuzanhänger oder ein Fußballtrikot, Klamottenstil, Sprache, Hautfarbe und ähnliches. Freilich sind diese Hinweise auf unseren Prägungskontext wichtig; wir sind unabdingbar pars pro toto gesellschaftlich ausgehandelter Maximen, unserer »Parochie« also, gleichzeitig aber als souveräne Individuen mehr als die Summe unserer uns prägenden Teile. Wir sind selbstgesetzgebend, wie Immanuel Kant einmal schreibt, und gehen als Person weder im Kreuzanhänger noch im Fußballtrikot auf. Hier verankert Kant den Würdegedanken. Wenn wir wissen, dass das fremde Gegenüber unendlich vielschichtiger ist, als es mir in meinem beschränkten, auf Zuschreibungen angewiesenen Erfahrungskanon erscheint, ist der von Williams gesuchte Startpunkt moralischer Reflexion gefunden. Die Transformation vom Fremden zum Nächsten, also die »Eingemeindung« in unsere Parochie, in der mitempfunden werden kann, kann gelingen, wenn wir uns unserer zwangsläufig vorurteilsbehafteten Wahrnehmung bewusst sind.
Immerhin, so haben wir nun ausgeführt, definiert sich der Fremde als Fremder gerade dadurch, dass er aufgrund der Unkenntnis der hinter den Zuschreibungen stehenden tatsächlichen Person auf einen oberflächlichen Formationsbegriff reduziert werden muss. Wir sehen nur, was wir wissen – und das ist wenig. Da hilft nur Begegnung, interessiertes Kennenlernen. Aus der beschriebenen Überforderung, allen uns begegnenden Personen entsprechende Aufmerksamkeit widmen zu können, und der genannten Notwendigkeit von Empathie-Blockaden folgt deshalb bestenfalls »epistemische Demut« statt Ressentiments. Die Erkenntnis des Gegenübers als unverfügbare Person verhinderte dessen Verwechslung mit der eigenen vorurteilsbeladenen Rollenprojektion, sei sie auch noch so unabdingbar.
Ich sehe was, was du nicht siehst: Konsequenzen
Folglich liegt im Ausweiten des »Wir« und im Aufzeigen multiperspektivischer Weltzugänge, die sich meinen kategorisch und universalisierbar anfühlenden Wahrheiten entgegenstellen, sicher ein Ansatz friedenspädagogischer wie -ethischer Arbeit. Sie hätte – nun wirklich friedenspädagogisch gesprochen – ihren didaktischen Startpunkt im Einüben von Empathie, also im Aufzeigen narrativer, sprich ästhetischer Methoden der Sichtbarmachung fremder Welt- und Wirklichkeitszugänge und in echter Begegnung. Es müsste deutlich werden, dass das Gegenüber im Sinne des Theologen Johannes Fischers nicht als „individuiertes Generelles“, sondern als „generalisiertes Individuum“ (Fischer 2012, S. 51; Hervorh. i.O.) zu verstehen ist:
„Für das desengagierte Denken ist das Einzelne ein Fall eines Allgemeinen bzw. ein Exemplar einer Klasse. Bei der narrativen Thematisierung von Situationen und Handlungen ist demgegenüber das Einzelne die Aktualisierung eines unbestimmten bzw. generalisierten Individuellen.“ (Fischer 2012, S. 51)
Das ist das Ziel der Parabel, ja einer narrativen Ethik überhaupt: Aus der narrativen Begegnung mit dem Samariter und seinem empathischen Tun am notleidenden anthrōpos sind in der Tat kategorische Grundsätze abzuleiten. Aus dem Handeln am ursprünglich Nächsten (in unserer Parochie), so will ich Bernard Williams metaethische Kritik verstehen, müssten hiernach grundsätzliche Handlungsmaximen abgeleitet werden, nicht andersherum (eine Verwechslung, der die Diszplin »Ethik« nach Williams seit Anbeginn ihres Bestehens regelmäßig aufsitzt!).
Von hieraus könnte eine Friedensethik bestimmt werden, die Fragen moralischer Phänomenologie zum Gegenstand hat, weil offensichtlich nicht bedingungslos gesehen wird, was gesehen werden muss, um in moralischer Praxis (richtig) handeln zu können.3 Die handlungsleitende Voraussetzungsfülle ethischer Wahrnehmung wäre herauszustellen, weil sie neben Zeit, Ort und Biographie auch auf die empathische Aufmerksamkeit hinweist, die eine moralische Rezeption des Gegenübers als unverfügbares Individuum ermöglicht, das weder durch von außen herangetragene Charakterisierungen noch als Teil von etwas hinreichend bestimmt werden kann.
Gleichzeitig zeigt sich Friedensethik als perspektivisch gebundene Reflexion moralischer Praxis, die nicht aus einem archimedischen Blickwinkel des Unbeteiligtseins, sondern aus moralischer Praxis heraus fragt: Was braucht es, um zu sehen, was du siehst und ich nicht sehen kann? Ohne diese dialogische Anstrengung, die versucht an einem Diskurs teilzunehmen, statt das Gesehene und Gehörte in abstrakte ethische Prinzipien einzuordnen, wäre kein mündiges Urteil zu fällen; moralische Kommunikation über (Handlungs-)Gründe unterbrochen. Die vorgeschaltete Frage eines ethischen Streits wäre also der gegenseitige Versuch einer Sichtbarmachung von Handlungsgründen: Sind wir sicher, dass wir über dasselbe streiten?
Dieser Essay ist der zweite Teil eines längeren Beitrags, der im Heft 4/2022 mit einem Text zur Empathie als Startpunkt einer Friedensethik begonnen wurde. Ausführlicher werden die hier eigenständig dargestellten Ideen in: Funk, Konstantin (2022): „Man muß mit menschlichen Gefühlen rechnen.“ Zur Bedeutung von Emotion und Empathie im friedensethischen Nachdenken. In: Harbeck-Pingel, B.; Schwendemann, W. (Hrsg.) (2022): Menschen Recht Frieden. Paderborn: V&R Unipress, S. 47-74.
Anmerkungen
1) Weils Essaysammlung »Krieg und Gewalt« ist angesichts der aktuellen Kriege und neuer und alter »Empathie-Blockaden« mit großem Gewinn neu zu lesen (vgl. Weil 2021).
2) Damit haben wir uns im Essay »Vom Fremden zum Nächsten. Empathische Wahrnehmung als Startpunkt einer Friedensethik« (Funk 2022) intensiver befasst.
3) Ganz so zugespitzt wie Simone De Beauvoir es schreibt, würde ich es allerdings nicht formulieren. Sie schreibt von der Begegnung mit der ganz und gar der moralischen Praxis verpflichteten Simone Weil als Verfechterin der ethischen Theorie: „Auch weiterhin ordnete ich soziale Fragen der Metaphysik und Moral unter: wozu sich um das Glück der Menschheit sorgen, wenn sie keine Daseinsberechtigung hat?“ (De Beauvoir 1997, S. 346). Der Konflikt der beiden wird exemplarisch in der anschließenden Schilderung De Beauvoirs deutlich: „[Weil] erklärte in schneidendem Tone, daß eine einzige Sache heute auf Erden zähle: eine Revolution, die allen Menschen zu essen geben würde. In nicht weniger preemptorischer Weise wendete ich dagegen ein, das Problem bestehe nicht darin, die Menschen glücklich zu machen, sondern für ihre Existenz einen Sinn zu finden. Sie blickte mich fest an. «Man sieht, daß Sie noch niemals Hunger gelitten haben», sagte sie. Damit waren unsere Beziehungen auch schon wieder zu Ende.“ (De Beauvoir 1997, S. 347)
Literatur
Bowles, S. (2008): Being human: Conflict: Altruism’s midwife. Nature, Bd. 456, S. 326-327.
Bowles, S. (2009): Nächstenliebe, die Mutter aller Kriege, aus dem Englischen übersetzt von Josephina Maier. DIE ZEIT (01/2009).
Breithaupt, F. (2019): Die dunklen Seiten der Empathie. 4. Auflage. Berlin: Suhrkamp.
Choi, J.-K.; Bowles, S. (2007): The coevolution of parochial altruism and war. Science, Bd. 318, S. 636-640.
De Beauvoir, S. (1997) [1958]: Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Reinbek bei Hamburg: Rowolt.
Fischer, J. (2012): Verstehen statt Begründen. Warum es in der Ethik um mehr als nur um Handlungen geht. Stuttgart: Kohlhammer.
Funk, K. (2022): Vom Fremden zum Nächsten. Empathische Wahrnehmung als Startpunkt einer Friedensethik. W&F 4/2022, S. 38-40.
Weil, S. (2021): Krieg und Gewalt, Essays und Aufzeichnungen. 3. Auflage. Zürich: Diaphanes.
Williams, B. (1978 [1972]): Der Begriff der Moral. Eine Einführung in die Ethik. Aus dem Englischen übersetzt von Eberhard Bubser. Stuttgart: Reclam.
Zimmermann, R. (2007): Berührende Liebe (Der barmherzige Samariter) – Lk 10, 30-35. In: (Ders.) (Hrsg.): Kompendium der Gleichnisse Jesu, in Zusammenarbeit mit Detlev Dormeyer, Gabi Kern, Annette Merz, Christian Münch und Enno Edzard Popkes. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, S. 538-555.
Konstantin Funk studierte evangelische Theologie, Religionslehre, Musik und Bildungswissenschaften in Mainz und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Friedensinstituts Freiburg an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Dort lehrt er in Sozialethik, Systematischer Theologie und Politischer Philosophie in verschiedenen Studiengängen.