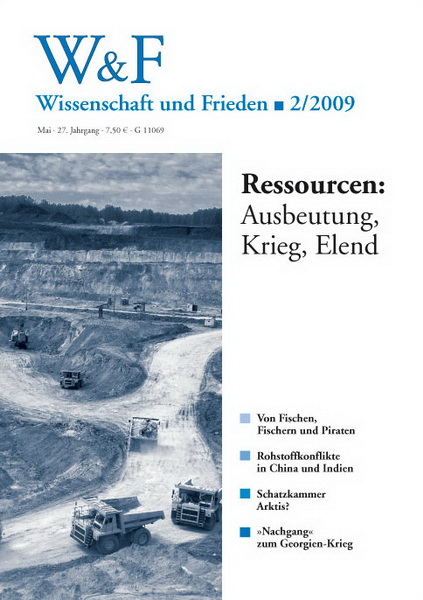Ökologische Friedensentwicklung auf dem Prüfstand
von Alexander Carius und Dennis Tänzler
Umweltbelastungen oder Ressourcenknappheit sind in der Regel nicht alleiniger Auslöser von Konflikten. Dies hat die Forschung zu Umwelt und Sicherheit in den letzten mehr als zwei Jahrzehnten deutlich gemacht. Vielmehr verstärken sich wandelnde Umweltbedingungen bereits akut oder latent bestehende Konfliktlagen. Ob Umweltdegradation in gewaltförmige Auseinandersetzungen mündet, hängt damit von Faktoren wie der sozioökonomischen und demographischen Entwicklung oder der spezifischen Konfliktgeschichte ab.
Bereits bestehende lokale und regionale Konflikte um Ressourcen (z.B. gemeinsam genutztes Wasser oder Agrarland) sind eng mit Armut und der Abnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen gekoppelt. Verschärft sich dieser Problemkontext und übersteigt die Entwicklung Bewältigungskapazitäten von Gesellschaften, kann Umweltdegradation zu gewaltförmigen Konflikten und Aufständen führen. Aus der Perspektive der Umwelt- und Sicherheitsforschung ist die Prognose einer zunehmenden Konfliktwahrscheinlichkeit im Zuge des Klimawandels, wie sie in jüngster Vergangenheit verstärkt diskutiert wird, zunächst grundsätzlich plausibel (Carius et al. 2008; Tänzler 2009). Während die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren in einer Reihe von Staaten absehbar kritisch bleiben, ist mit Blick auf die ökologischen Ausgangsbedingungen vielfach eine drastische Verschlechterung zu erwarten.
Gleichzeitig verdeutlichen die Forschungsergebnisse aber auch, dass die Verknappung von Ressourcen bislang kaum bewaffnete zwischenstaatliche Konflikte in Form von (Ressourcen-) Kriegen hervorgebracht, sondern vornehmlich zu lokalen Konflikten mit vergleichsweise geringer Konfliktintensität geführt hat. Die Multikausalität von Konflikteinflussfaktoren und ihre komplexe Wechselbeziehung haben vielfach zu Kritik an der Prognose von Umweltkonflikten geführt. Eine konfliktauslösende Wirkung von Umweltfaktoren eindeutig nachzuweisen, ist diesen Forschungsergebnissen zufolge schwierig. Zudem müssen diesen Fällen auch systematisch jene Fälle entgegengehalten werden, in denen Ressourcendegradation trotz widriger Umstände nicht zum Ausbruch gewaltförmiger Konflikte oder gar zwischenstaatlicher Kriege geführt hat.
Konfliktlandschaften
Eine Deutungsmöglichkeit für das Ausbleiben von zwischenstaatlichen Kriegen um Ressourcen liegt darin, dass Umweltdegradation und Verknappung meist noch nicht das Niveau erreicht haben, bei dem zur Wahrung der nationalen Interessen gewaltförmige Mittel eingesetzt werden. Dieser Erklärungsansatz erscheint mit Blick auf die regionale Ausbreitung und die Konfliktintensität plausibel und wird auch durch die Ergebnisse eines Gutachtens gestützt, das als externe Expertise für den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) zu den Sicherheitsrisiken des Klimawandels erstellt wurde (Carius et al. 2006). Die Historie von 73 Konflikten mit Ressourcenkomponenten von 1980 bis 2005 wurde anhand eines einheitlichen Analyserasters ausgewertet (vgl. Weltkarte auf Seite 38 Heftes). Dieses Inventar wurde mit der Annahme erstellt, dass die naturräumlichen Ursachen in diesen Fällen auch Folgen des Klimawandels hätten sein können. Die Konfliktlagen umfassten hierbei auch Konflikte unterhalb der Schwelle gewaltsamer, kriegerischer Auseinandersetzungen, beispielsweise in Form von anhaltendem, aber weitgehend gewaltfreiem Protest gegen die Folgen von Ressourcenverknappung. Neben den ökologischen Ursachen von Konflikten wurden verschiedene soziale, politische und wirtschaftliche Größen berücksichtigt, um ein breites Spektrum aus Einflussfaktoren zu erfassen. Eine Einordnung der Konflikte nach den ihnen zu Grunde liegenden Ressourcen erwies sich als schwierig, da in der Regel nicht von »reinen« Wasserkonflikten oder Konflikten aufgrund von Bodendegradation gesprochen werden kann. Vor dem Hintergrund der regional unterschiedlichen Konfliktmuster lassen sich vier Grundtypen von Konflikten identifizieren:
1. Lokal begrenzte Landnutzungs- und Bodendegradationskonflikte mit mittlerer Konfliktintensität, bei denen vor allem der Bevölkerungsdruck, Armut und asymmetrische Machtverteilung Einfluss haben und die insbesondere in Lateinamerika zu verorten sind.
2. Vorwiegend im Nahen Osten auftretende politisierte Wassernutzungskonflikte. Diese weisen trotz mittlerer Konfliktintensität ein hohes Eskalationspotenzial auf, das auf geopolitische Konstellationen und bestehende Konfliktlinien zurückzuführen ist. Eine sich verschärfende Wasserknappheit wirkt hier mit Bevölkerungsdruck, Migration, Armut und ethnische Spannungen zusammen.
3. Armutsbedingte Konflikte aufgrund von Wasser- und Bodendegradation, die vornehmlich in Afrika auftreten und lange Zeit lokal waren. Zu einer zum Teil hohen Konfliktintensität kommt eine nationale und grenzüberschreitende Ausbreitung der Konflikte hinzu. Gleichwohl werden auch diese Konflikte durch Regierungsversagen, asymmetrische Machtverteilung, Bevölkerungsdruck, Armut und ethnische Spannungen verstärkt.
4. Extreme Wettereignisse, insbesondere Fluten und Dürren, die eine große Zahl von Opfern fordern. Es zeigt sich, dass der Problemdruck beispielsweise in Süd- und Südostasien in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, wobei hier auch der Einfluss der Bevölkerungsdynamik von besonderer Bedeutung ist.
Umweltkooperation für Frieden und Stabilität
Die Auswertung der über 70 Umweltkonflikte zeigt, dass diese überwiegend lokal beschränkt waren. Nur vereinzelt gibt es Beispiele für grenzüberschreitende Konflikte, wie die Rebellionen bewaffneter Tuaregs in Mali und Niger in den 1990er Jahren. Neben dem Erklärungsansatz, dass sich der Umweltstress in einer Reihe von Regionen derzeit noch auf einem zu bewältigenden Niveau befindet, liegt eine weitere Erklärung in der stabilisierenden Wirkung der Zusammenarbeit, insbesondere bei grenzüberschreitenden Problemlagen.
Die Frage, wie kooperative umweltpolitische Arrangements die Konfliktprävention auf lokaler, regionaler und zwischenstaatlicher Ebene stärken und einen friedensfördernden Beitrag leisten können, beschäftigt die Umwelt- und Sicherheitsforschung schon seit einigen Jahren. Am weitesten fortgeschritten ist in diesem Zusammenhang die Forschung zu Verhaltensmustern an grenzüberschreitenden Gewässern. Empirisch zeigt sich, dass Konflikte um Wasser bislang noch in keinem der weltweit 263 grenzüberschreitenden Flussgebiete zu einem internationalen Krieg geführt haben. Bei der Analyse des Verhaltens von Anliegern an grenzüberschreitenden Gewässern kommen Forscher der Abteilung für Geowissenschaften an der Oregon State University zu dem Ergebnis, dass kooperative Arrangements sehr viel häufiger auftreten als gewaltsam ausgetragene Konflikte (Wolf 2004).
Die Konfliktgeschichte z.B. am Euphrat oder Nil verdeutlichet, dass zwar auch mit militärischer Gewalt gedroht wird, dass aber selbst in diesen Spannungsgebieten gemeinsame Lösungen und Kooperationsabkommen angestrebt werden. Durch institutionelle Arrangements wird die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Anliegern verstetigt und ein wesentlicher Beitrag zur Vertrauensbildung geleistet. Als Kernelemente einer stabilen Zusammenarbeit erweisen sich eine dauerhafte politische wie finanzielle Unterstützung, eine tragfähige Vision der Zusammenarbeit, die Schaffung einer gemeinsamen hydrologischen Datengrundlage sowie die Etablierung allerseits anerkannter Rechtsinstrumente. Neben der Kooperation am Nil zeigen die Beispiele am Indus (Indien und Pakistan) und Mekong (Laos, Kambodscha, Thailand und Vietnam), dass die Wasserkooperation zwischen den Anrainerstaaten sogar unter Kriegsbedingungen weitergeführt wird.
Will man Ansätze ökologischer Friedensbildung systematisieren, ergeben sich drei sich teilweise überschneidende Kategorien: (1) Bemühungen, Konflikte zu vermeiden, die sich direkt auf die Umwelt beziehen; (2) Versuche, einen Dialog zwischen den Konfliktparteien über Maßnahmen der grenzübergreifenden Umweltkooperation zu initiieren und in Gang zu halten; und (3) Initiativen, die darauf abzielen, über die Förderung nachhaltiger Entwicklung Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden zu schaffen (Carius 2008).
Bearbeitung ökologischer Konfliktursachen
Lautet die Minimalforderung für Frieden »Abwesenheit gewaltsamer Auseinandersetzungen«, dann kann die ökologische Kooperation möglicherweise eine Rolle bei der Verhinderung der Art von Gewalt spielen, die sich am Raubbau an natürlichen Ressourcen, der Vernichtung von Ökosystemen oder der Zerstörung der auf natürlichen Ressourcen basierenden Lebensgrundlagen der Menschen entzündet. Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen, die Umweltzerstörung mit gewaltsamen Konflikten in Verbindung bringen, weisen auf zwei zentrale Notwendigkeiten hin: Zum einen ist der Druck auf die Ressourcen zu vermindern, von denen die Menschen wirtschaftlich abhängen. Zum anderen ist die institutionelle Fähigkeit zu stärken, auf ökologische Herausforderungen zu reagieren. Mit anderen Worten besteht die unmittelbarste Form der ökologischen Friedensbildung in Maßnahmen zur Verhinderung ökologisch induzierter Konflikte (UNEP 2004; Conca et al. 2005).
Ökologische Kooperation kann unter Umständen auch den Unmut von Gruppen mildern, die sich als Opfer ökologischer Ungerechtigkeiten wahrnehmen und darin eine zusätzliche Verstärkung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligung sehen. Latente Umweltprobleme können somit eine riskante Verbindung zwischen materieller Unsicherheit und der Selbstsicht betroffener Menschen als marginalisierte Gruppen bilden. In Situationen, wo ethnische Zugehörigkeit über politische und wirtschaftliche Chancen entscheidet, betreffen Umweltfolgen die verschiedenen ethnischen Gruppen häufig in ungleichem Maße. So leben in den am meisten verschmutzten Industriegebieten der postsowjetischen Länder des Baltikums mehrheitlich ethnische Russen – ein Zustand, der eine potentiell explosive Mischung aus sich verstärkender ethnonationaler Identität, verschärfter sozialer Benachteiligung und ökologischen Missständen erzeugt. Eine offensive ökologische Kooperation könnte mithelfen, eine wichtige Ursache dieses Unmuts zu beheben, der durch diese Art der sozialen Spaltung und Ausgrenzung noch angeheizt wird.
Umweltkooperation als Dialogplattform
Ein zweiter Ansatz der ökologischen Friedenssicherung zielt auf Konflikte ab, die keine konkrete ökologische Ursache aufweisen. Das Ziel ist, durch kooperative Antworten auf gemeinsame ökologische Herausforderungen Frieden zu schaffen. Initiativen, die gemeinsame ökologische Probleme in Angriff nehmen, können dort, wo andere politische und diplomatische Ansätze gescheitert sind, dazu genutzt werden, einen ersten Dialog zwischen den Konfliktparteien herzustellen. In vielen Fällen haben Staaten, deren Beziehung zueinander ansonsten durch Misstrauen und Feindseligkeit – wenn nicht gar offene Gewalt – geprägt sind, festgestellt, dass Umweltprobleme zu den wenigen Themen gehören, in denen sie einen kontinuierlichen Dialog aufrechterhalten können.
Einer der schwierigsten noch nicht gelösten Konflikte in der politisch überaus instabilen Kaukasusregion ist der Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan um Nagorny-Karabach. Im Herbst 2000 gelang es der georgischen Regierung, die zuvor schon einen Dialog über Umweltschutzthemen vermittelt hatte, Armenien und Aserbaidschan dazu zu bewegen, der Einrichtung eines trilateralen Biosphärenreservats in der südlichen Kaukasusregion zuzustimmen. Die Initiatoren hoffen, durch diese regionale Umweltkooperation nicht nur den Naturschutz und eine nachhaltige Entwicklung, sondern darüber hinaus auch die politische Stabilität in der Region zu stärken. Vorhaben dieser Art suchen zunächst einen gemeinsamen Bestand an umweltbezogenen Daten zu sammeln, Handlungskapazitäten aufzubauen und das ökologische Bewusstsein in der Bevölkerung der Region zu stärken. Unabhängige internationale Umweltbewertungen, zum Beispiel durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, können mit objektiven und von beiden Seiten akzeptierten Daten einen ersten Grundstein für eine zukünftige Kooperation legen.
Ein ähnlicher Ansatz zeigt sich in Kaschmir, eine Region, um die sich Indien und Pakistan seit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg erbittert streiten. Internationale Umweltschützer sind der Meinung, dass die Einrichtung eines Friedensparks im Karakorum-Gebirge zwischen Indien und Pakistan am westlichen Ende des Himalaja und das gemeinsame Management dieser einzigartigen Gletscherregion, in der viele Soldaten eher den widrigen Naturgewalten als dem politischen Feind zum Opfer fallen, den Grenzkonflikt entschärfen könnte. Das Konzept eines gemeinsamen Managements wurzelt darüber hinaus in der Erkenntnis, dass die Umweltverschmutzung die größte Gefahr für dieses einzigartige Ökosystem darstellt. Natürlich darf nicht erwartet werden, dass ein gemeinsames Umweltschutzprogramm in einem abgelegenen und kaum besiedelten Gebiet, wo schon die Aufrechterhaltung einer dauerhaften militärischen Präsenz an den Kosten scheitert, die strukturelle Dynamik des indisch-pakistanischen Konflikts grundlegend verändern wird.
Gemeinsame ökologische Herausforderungen können jedoch nicht nur als Türöffner für einen gesellschaftlichen Dialog dienen, sondern möglicherweise sogar traditionell von Konflikten geprägte Beziehungen transformieren, indem sie die einer Kooperation entgegenstehenden Barrieren überwinden und Misstrauen, Argwohn und divergierende Interessen durch eine gemeinsame Wissensbasis und gemeinsame Ziele ersetzen. Technisch komplexe Themen, bei denen die Konfliktparteien fast zwangsläufig mit unterschiedlichen und bruchstückhaften Informationen arbeiten, drohen das gegenseitige Misstrauen noch zu verstärken. Um diese Defizite zu überwinden, kann die technische Komplexität vieler ökologischer Themen dazu benutzt werden, eine gemeinsame Wissensbasis aufzubauen. Beispielsweise identifizierte die »Permanent Okavango River Basin Water Commission« (OKACOM) gemeinsame Untersuchungen des Okawango-Durchflusses und der möglichen Konsequenzen des Baus von Staudämmen zur Wasserkraftnutzung und Ableitung von Wasser für die Bewässerungslandwirtschaft als einen zentralen Schritt auf dem Weg zur Festlegung von gemeinsam akzeptierten Mindestanforderungen für ein erfolgreiches und friedliches Management der Wasserressourcen (Earle/Mendez 2004).
Hier könnte skeptisch eingewandt werden, dass solche Initiativen marginal und ohne Relevanz für die tatsächlichen Konfliktursachen sind – nicht unähnlich der Kooperation der Supermächte im Weltraum zu Zeiten des Kalten Kriegs. Dieser Einwand ignoriert aber, dass die politischen und ökonomischen Einsätze, um die es bei der Umweltkooperation geht, in den betroffenen Gebieten sehr hoch sind. Da Probleme, die gemeinsame Flussbecken, die regionale Biodiversität, Waldökosysteme oder die Land- und Wassernutzung betreffen, häufig sehr kontrovers sind und mit einem hohen Ressourceneinsatz einhergehen, werden sie in den beteiligten Staaten auf höchster Ebene verhandelt.
Nachhaltige Entwicklung als Voraussetzung für dauerhaften Frieden
Ein dritter Ansatz der Konfliktprävention und Friedensentwicklung durch Umweltkooperation geht davon aus, dass dauerhafter Frieden langfristige und umfassende Nachhaltigkeit voraussetzt. So zielt die Frage, ob die Wasserknappheit die »Ursache« der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern darstellt, am Kern des Problems vorbei. Die Lösung der gemeinsamen Wasserprobleme stellt eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden dar. Auch wenn die Wasserstreitigkeiten zwischen Israelis und Palästinensern den eigentlichen Konflikt nicht ausgelöst haben, stellt die Verwaltung der gemeinsamen Wasserressourcen nicht nur eine wichtige Möglichkeit dar, ungeachtet des übergeordneten Konflikts den Dialog zwischen beiden Parteien am Leben zu erhalten. Sie ist auch ein Schlüssel für die Verhandlungen zur Konfliktbeilegung. Bei den Verhandlungen zum Osloer Friedensabkommen zwischen Palästinensern und Israelis spielte die Wasserproblematik eine so bedeutende Rolle, dass zu diesem Komplex eine eigene Verhandlungsgruppe eingerichtet wurde – was im übrigen auch auf für die im Jahr 2004 aufgenommenen Verhandlungen zwischen Indien und Pakistan über den Kaschmirkonflikt gilt. Unabhängig davon, ob Wasser die Ursache für den Konflikt ist oder den bereits bestehenden Konflikt lediglich verschärft, ohne eine nachhaltige und gemeinsame Wasserpolitik wird es in der Region keinen dauerhaften Frieden geben (Kramer 2009). Dabei ist jedoch die Beliebigkeit dieses Arguments in der politischen Debatte zu vermeiden, denn Konzepte nachhaltiger Entwicklung zielen auf ein Gleichgewicht ökologischer, sozialer und ökonomischer Interessen zur Sicherung substanzieller und gleicher Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen und streben insofern einen gesellschaftlichen Idealzustand an, der frei ist von Verteilungskonflikten, Armut, Marginalisierung, Korruption und Gewalt.
Fazit
Ansätze der ökologischen Friedensentwicklung tragen bislang dazu bei, umweltinduzierte Konfliktlagen einzudämmen. Der Fortbestand dieses Befunds wird allerdings angesichts der prognostizierten Trends des globalen Klimawandels in Frage gestellt (Carius et al. 2008). Für eine Reihe von Abkommen zur Wasserverteilung an grenzüberschreitenden Flussgebieten ist beispielsweise eine Anpassung der Regelungen notwendig, weil mit einer Abnahme der Wasserverfügbarkeit zu rechnen ist. Diese Weiterentwicklung der Arrangements dürfte zum Teil auf beträchtliche Vorbehalte treffen. Bislang vorherrschende friedvolle Formen des Interessenausgleichs kommen damit auf dem Prüfstand und bedürfen der systematischen Stärkung der internationalen Gemeinschaft.
Literatur
Carius, Alexander (2007): Environmental Peacebuilding. Environmental Cooperation as an Instrument of Crisis Prevention and Peacebuilding: Conditions for Success and Constraints. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Adelphi Report 03/07. Berlin.
Carius, Alexander, Dennis Tänzler und Achim Maas (2008): Klimawandel und Sicherheit – Herausforderungen für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Herausgegeben von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Eschborn.
Carius, Alexander, Dennis Tänzler und Judith Winterstein (2006): Weltkarte von Umweltkonflikten: Ansätze zur Typologisierung. Gutachten im Auftrag des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen (WBGU). Berlin, Potsdam.
Conca, Ken, Alexander Carius und Geoffrey D. Dabelko (2005): Frieden schaffen durch Umweltkooperation, in: Worldwatch Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2005: Globale Sicherheit neu Denken, 288-311. Münster.
Earle, Anton und Ariel Mendez (2004): An Oasis in the Desert: Navigating Peace in the Okavango River Basin, in: PEC News, Woodrow Wilson International Center for Scholars 2004, 1, 13-14, Washington DC.
Kramer, Annika (2008): Regional Water Cooperation and Peacebuilding in the Middle East. Studie im Rahmen der Initiative for Peacebuilding (IfP).
Tänzler, Dennis (2009): Entwicklungsrisiko Klimawandel. Die Notwendigkeit kooperativer Ansätze. SWP Working Paper. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik.
UNEP – United Nations Environment Programme, Department of Early Warning and Assessment (DEWA) (Ed.) 2004: Understanding Environment, Conflict, and Cooperation. Nairobi.
Wolf, Aaron T. (2004): Regional Water Cooperation as Confidence Building: Water Management as a Strategy for Peace. EDSP Working Paper No. 1. Berlin: Environment, Development and Sustainable Peace Initiative.
Alexander Carius ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Adelphi Research und Adelphi Consult. Er berät nationale und internationale Institutionen zu Fragen der Umwelt-, Entwicklungs- und Außenpolitik. Seit dem Frühjahr 2005 gehört er dem Beirat »Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung« der Bundesregierung an. Dennis Tänzler ist Senior Project Manager bei Adelphi Research. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die internationale und europäische Klima- und Energiepolitik sowie Fragen von Umwelt, Klima und Sicherheit. 2007 und 2008 war Dennis Tänzler als Experte für Klima- und Energiepolitik im Planungsstab des Auswärtigen Amtes tätig.