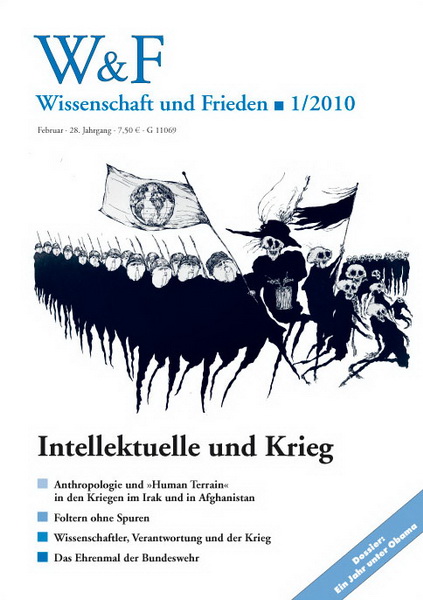»Operations other than War«
Die Politik akademischer Gelehrsamkeit im 21. Jahrhundert
von David Nugent
Im Jahr 2008 kündigte US-Verteidigungsminister Robert M. Gates die »Minerva Forschungsinitiative« an. Im Rahmen der dafür bereit gestellten 50 Millionen US-Dollar sollen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive vier Themen bzw. Regionen besonders beforscht werden: China, der Irak, der Islam, der Terrorismus. Ein fünftes Feld ist thematisch offen. Ziel des Projektes ist aus Sicht des Verteidigungsministeriums die Verbesserung und Verstetigung der Beziehungen mit Universitäten, um von einer langfristigen Kooperation profitieren zu können.
Zu den vielen schweren Bedenken, die das Minerva-Projekt hervorgerufen hat, gehört die nach der Beeinträchtigung der Autonomie und Unparteilichkeit der akademischen Sphäre - und nach den Bedingungen, die eine solche Unabhängigkeit entweder befördern oder einschränken.1 Gemeinhin besteht die Tendenz, Anstrengungen des Militärs, akademisches Wissen zu beeinflussen, als bedrohlich für das Zustandekommen einer kompromisslos unabhängigen Forschung zu bewerten. Es ist ähnlich naheliegend, das akademische Feld als einen »abgetrennten Bereich« anzusehen, in dem die ForscherInnen die Freiheit haben, kritische Positionen zum Militär zu entwickeln - unbeeinflusst von dessen Anliegen und Vorstellungen. Solche akkuraten Trennungen werden der Komplexität der Beziehungen zwischen diesen beiden institutionellen Sphären jedoch nicht gerecht. Bereits ein kursorischer Überblick der Geschichte der Beziehungen zwischen Militär und Hochschulen verdeutlicht dies.
Raum und Region
Eine Möglichkeit, die wechselhaften Beziehungen zwischen beiden Sphären zu vermessen, besteht bezüglich der periodischen Krisen der kapitalistischen Akkumulation und der Auswirkung dieser Krisen auf die Strategien imperialer Wirtschaft. Ein solcher Ansatz wäre gerade jetzt besonders passend, wo eine ökonomische Krise, die seit einer Dekade Fahrt aufgenommen hat (vgl. Arrighi 1994), mit verheerender Kraft zugeschlagen hat. Aber dies ist nicht die erste ökonomische Krise, die eine Verschiebung in den Beziehungen zwischen Militär und Wissenschaft hervorgerufen hat. Es gab eine frühere Periode der Krise - aber auch der Erholung und Handhabung, die eine erste bedeutende Intervention des Militärs in den Sozialwissenschaften in Gang gesetzt hat. Die Depression der 1930er Jahre und der ihr folgende Weltkrieg brachte militärische Anliegen direkt in die Universitäten - und andersherum. Es war das »Regionen«-Konzept, das die unverfälschte und unvoreingenommene Sozialwissenschaft in den Nachkriegsjahrzehnten dominierte und schließlich in den Mittelpunkt der poststrukturellen Kritik an der Rigidität des Kalten Krieges geriet. Dieses Konzept stellte die Brücke zwischen militärischen Interessen und akademischen Vorstellungen und Tätigkeiten dar und bestand in wenig mehr als der Reflektion militärischer Zweckmäßigkeiten. Es entstand unmittelbar aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges: Als den USA ein Sieg denkbar schien, wurde den Militärstrategen bewusst, dass sie für den Frieden, der dem Krieg folgen würde, völlig unvorbereitet waren. Sie stellten fest, dass sie auf die Verwaltung der umfangreichen Gebiete, die sie rund um den Globus bald von den Achsen-Mächten übernehmen würden, nicht vorbereitet waren.
Mit dem Ziel, sich auf die Regierung dieser weit verstreuten Territorien vorzubereiten, stellte die US-Armee rasch ein Team angesehener Sozialwissenschafter aller wichtigen Disziplinen zusammen. Ihre Aufgabe bestand in der Entwicklung eines standardisierten Curriculums, das die Streitkräfte nutzen konnten, um ihr Personal für die Einrichtung einer Militärverwaltung an beliebigen Stellen der Erde vorzubereiten. So wurde das »Regionen«-Konzept für das Militär dienlich gemacht.2 Unter dem Dach des »Foreign Area and Language«-Programms schulten interdisziplinär zusammengesetzte Teams von Sozialwissenschaftlern an 55 Universitäten im ganzen Land tausende Offiziere in der Kunst der Militärregierung (vgl. Nugent 2008).
Nach dem Krieg sah man das »Regionen«-Konzept auch als nützlich an, um die ursprünglichen Militärverwaltungen auf die Friedenssituation umzustellen. Bekanntermaßen gaben die US-Regierungen und die großen Stiftungen in den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges enorme Geldsummen für den Aufbau umfangreicher sozialwissenschaftlicher Infrastruktur aus. An angesehenen Universitäten wurden prominente Forschungszentren etabliert, und mit neuen und reorganisierten Förderstrukturen (National Science Foundation/NSF, Social Science Research Council/SSRC, American Civil Liberties Union/ACLU, usw.) und mit noch nie dagewesenen Geldmitteln für die Ausbildung von Hochschulabsolventen wurde eine Infrastruktur etabliert, die sicherstellte, dass die Analyse der Welt durch die »Regionen«-Linse vorgenommen wurde. So wie einige Tausend Offiziere darin trainiert wurden, die in Kriegszeiten übliche Variante der Regionalstudien umzusetzen, so wurden nun Tausende Zivilisten (Sozialwissenschaftler) in deren Wiederholung in Friedenszeiten ausgebildet. Hierzu gehörten auch einige der einflussreichsten Forscher jener Zeit (vgl. Szanton 2004; Wallerstein 1997).
Der Rückblick auf diesen historischen Verlauf dient nicht der Benennung der Schwächen der Regionalstudien. Vielmehr geht es darum deutlich zu machen, wie schwierig es ist, klare Grenzen zwischen militärischen und akademischen Interessen zu ziehen. Während dieser ganzen Periode war die »relative Autonomie« von Organisationen wie der NSF oder des SSRC erheblichen Einschränkungen unterworfen durch die Tatsache, dass das »Regionen«-Konzept seine Wurzeln in den Erfordernissen des Militärs hatte und schließlich entmilitarisiert wurde, um dem Interesse an einer Stabilität im Kalten Krieg gerecht zu werden. So waren in der längsten Zeit des Kalten Krieges die geopolitischen Ansichten des US-Militärs auch konstitutiv für die konzeptionellen Ansätze, die in den Sozialwissenschaften zur Erklärung und zum Verstehen der Welt verwandt wurden.
Während die dem »Regionen«-Konzept inhärenten Annahmen sicherlich zur Beschränkung der Forschungsparameter beitrugen, war es jedoch nicht der Ansatz der »Area-Studies« als solches, der kritisches Forschen verhinderte. Tatsächlich sind viele der ForscherInnen, die in diesem Feld ausgebildet wurden, zu ausgesprochenen KritikerInnen der Dimension »Raum« geworden und haben sich auch kritisch zu den Strukturen von Regierung und Militärapparat geäußert, aus denen dieses Konzept hervorging. Tatsächlich war es das ungewöhnlich repressive politische Klima dieser Epoche, das die größte Bedrohung der akademischen Freiheit darstellte. Ironischerweise wurde das Bedrohungsgefühl, das das Land im Zuge des Mc Carthyismus erfasste, stärker von zivilen als von militärischen Institutionen befördert - durch den US-Kongress, die exekutiven und judikativen Teile der Regierung sowie den privaten Sektor.
Auch war es nicht der Zusammenbruch des »Area Studies«-Netzwerkes, der irgendwie die Forschenden zu radikaler Kritik in den 1960er Jahren ermutigte. Vielmehr fand die Einbeziehung einer relevanten Anzahl von Jugendlichen aus der Mittelschicht in die politischen Auseinandersetzungen um den Vietnam-Krieg seinen Niederschlag in beträchtlichem Ausmaß auch in der Radikalisierung der Sozialwissenschaften.
Operationen jenseits des Krieges
Das US-Militär hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg erheblich verändert. Dies gilt auch für das Imperium, das die USA zu führen versuchen. Was können wir aus der Vergangenheit hinsichtlich der Dilemmata lernen, die durch das jüngste Angebot des Verteidigungsministeriums zur Forschungsförderung entstanden sind? Seit der Auflösung der Sowjetunion hat das US-Militär eine neue Rolle in der Weltpolitik übernommen. Während es auch weiterhin in großem Ausmaß schikaniert und gewaltsam auftritt, ist es zugleich an einer großen Bandbreite von scheinbar nicht-militärischen Aktivitäten beteiligt (vgl. Lutz 2004). Unter der Bezeichnung »Operations Other than War« (OOTW) reichen diese von Evakuierungsoperationen und Katastrophenhilfe über die Sanierung der Umwelt bis hin zur Wahlbeobachtung. Ebenfalls zu nennen ist der Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen vor Nahrungsmittelknappheit und Seuchen, die Absicherung ziviler Autoritäten und Regierungsinstitutionen und die Förderung des Friedens. Zu den OOTW gehört auch der Bau von Straßen und Sanitärsystemen sowie das Anlegen von Brunnen für die Gewinnung von Trinkwasser und Bewässerung (Vgl. J-7 Joint Staff n.d.; ACT 1995).
Viele dieser »nicht-traditionellen« Aktivitäten des Militärs sind fast identisch mit denen, die in den letzten Jahrzehnten in erheblichem Umfang zum Handlungsfeld der großen Stiftungen und der US-Regierung gehört haben. Es ist interessant festzustellen, dass dies gerade jene Aktivitäten und Probleme sind, zu deren Erforschung SozialwissenschaftlerInnen von einer Vielzahl nicht-militärischer Forschungsförderer aufgefordert werden, und zwar sowohl innerhalb wie außerhalb der Regierungsstrukturen. Seit dem Ende des Kalten Krieges - und insbesondere nach 9/11 - gibt es eine starke Konvergenz in den strategischen Ansätzen der Regierung, der Stiftungen und des Militärs. Bei Themen wie »Schurkenstaaten«, Rechtsgrundsätze, die Zivilgesellschaft oder nachhaltige Entwicklung lassen die Förderer jeglicher Größe und Ausrichtung eine starke Orientierung auf Fragen der »Sicherheit« erkennen.
Tatsächlich erstaunt bei einer Durchsicht der Beschreibung des »Minerva-Projekts« nicht, wie fremd die Forschungsthemen sind, die das Militär vorantreiben möchte (autoritäre Regime, religiöser - besonders islamischer - Fundamentalismus, terroristische Organisationen), sondern wie vertraut sie sind. In ihrer Mehrzahl sind sie kaum von denen zu unterscheiden, denen sich auch nicht-militärische Forschungsförderer widmen.
Trotz gewisser Ähnlichkeiten - insbesondere ein verbreiteter Argwohn bezüglich politischer Meinungsverschiedenheiten gegenüber massiven US-Interventionen - unterscheiden sich die Bedingungen des heutigen Verhältnisses zwischen Militär und akademischem Feld in erheblicher Weise von denen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die 1950er Jahre waren eine Phase der Erholung von einer globalen Wirtschaftskrise, in der eine erhebliche Ausweitung der Sozialwissenschaften möglich war. Heute befinden wir uns jedoch in einer Periode ernsthafter ökonomischer und politischer Einschränkungen. Viele Wissenschaftler haben daher angemerkt, dass es in den letzten beiden Jahrzehnten zu einer weitreichenden Umorganisation der Universität gekommen ist.
Der Umbau der Universitäten
Bis vor kurzem war ein großer Teil dieser Reorganisation eine Funktion der wachsenden Einflussnahme des Privatsektors auf die Forschung. Neuerdings hat allerdings ein Trend, der sich seit den 1980er Jahren entwickelt hat, mit Wucht durchgeschlagen. In den letzten Jahren ist die finanzielle Unterstützung für universitäre Forschung und Ausbildung - insbesondere in den Sozial- und Geisteswissenschaften - erheblich geschrumpft. Die Haushaltsmittel für die NSF, das National Institute of Health (NIH) und die National Endowment for the Humanities (NEH) wurden drastisch gekürzt - auf Initiative von zivilen, nicht von militärischen Entscheidungsträgern. Selbst die prestige-trächtigsten und wohlhabendsten öffentlichen und privaten Universitäten mussten sich einschränken und ihre Budgets beschneiden.
Einige Fakultäten waren gezwungen, Abteilungen zu fusionieren oder sogar ganz zu schließen. Einstellungsstopps und Gehaltskürzungen sind üblich. Arbeitsverdichtungen verschiedener Art sind allgegenwärtig. Das gesamte akademische Personal ist einem bedeutenden Prozess der Restrukturierung ausgesetzt. Gleichzeitig werden die Anforderungen an Forschung und Publikationen für diejenigen angehoben, die sich um unbefristete Stellen bemühen.3
In dem Maße, in dem die Anforderungen an Lehre und universitäre Dienstleistung steigen und die Mittel für die Forschung ein geschränkt werden, hängt das berufliche Überleben von der Fähigkeit ab, Geldmittel für Forschung und Publikationen einzuwerben. In dieser Situation richten Akademiker ihre Aufmerksamkeit auch auf nicht-traditionelle Finanzierungsmöglichkeiten, wie etwa das Verteidigungsministerium. Sie suchen auch die Zusammenarbeit mit Forschenden, die in den Feldern arbeiten, die den Großteil der zurückgehenden Ressourcen vereinnahmen. Dieser Prozess ist bereits in zahlreichen Disziplinen sichtbar.
Daraus ergibt sich keineswegs, dass das »Minerva-Projekt« ohne Risiken für die Sozialwissenschaften ist. Vielmehr ist darauf zu verweisen, dass die Gefahren nicht daher rühren, dass es aus dem Verteidigungsministerium stammt. Wie wir gesehen haben, gibt es eine lange und ehrwürdige Tradition der Kooperation und der gegenseitigen Unterstützung zwischen Militärplanern und Akademikern, die es besonders schwer macht, zwischen wissenschaftlichen und soldatischen Angelegenheiten zu unterscheiden. Die Bedrohung durch das »Minerva-Projekt« ist nicht unähnlich derjenigen, wie sie von allen Programmen - militärisch wie zivil gleichermaßen - ausgeht, die OOTW fördern. Erstens gibt es die Gefahr, dass Forscher die Unterstützung annehmen, ohne ein gründliches Verständnis dafür zu haben, warum sie angeboten wird und wie die Forschungsergebnisse verwendet werden. (...) Zweitens gibt es das Risiko, dass wir es unterlassen, die angebotenen Ressourcen zu nutzen, um eine scharfe Kritik an den Machtstrukturen zu entwickeln, aus denen diese Programme hervorgegangen sind - eine Aufgabe, bei der sich zahlreiche Wissenschaftler, die in Regionalstudien ausgebildet sind, auszeichnen. Schließlich - und am bedeutendsten - die Gefahr, dass Forschende mit Rücksicht auf all die Förderung darauf verzichten, streitlustig zu sein und darauf zu bestehen, die Bedingungen zu bestimmen, zu denen wir Unterstützung akzeptieren oder auch nicht. Die »American Anthropological Association« hat einen bescheidenen, aber wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen, indem sie darauf bestand, dass ein unabhängiges Gremium wissenschaftlicher ExpertInnen - in diesem Fall die NSF - die Bewertung der im Rahmen des »Minerva-Programms« eingereichten Forschungsanträge vornimmt. Aber es kann viel, viel mehr getan werden. Die Art der Probleme, die wir erforschen, und wann und wo wir dies tun, sind Angelegenheiten, über die die Forschenden entscheiden sollten. Nur so werden wir die Beziehungen zwischen der Wissenschaft und den Förderern verändern.
Literatur
ACT (Center for Advanced Command Concepts and Technology) (1995): Operations Other than War (OOTW): The Technological Dimension. Washington, D.C.: National Defense University Press.
Arrighi, Giovanni (1994): The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times. New York: Verso.
J-7 Joint Staff (n.d.): Military Operations Other than War. Joint Doctrine. Joint Force Employment (J-7 Operational Plans and Interoperability Directorate). Washington, D.C.
Lutz, Catherine (2004): Militarization, in: David Nugent & Joan Vincent (eds.): A Companion to the Anthropology of Politics, Malden, MA and Oxford, UK: Blackwell, S.318-331.
Nugent, David (2008): Social Science Knowledge and Military Intelligence: Global Conflict, Territorial Control and the Birth of Area Studies, Anuário Antropológico 2006: 33-64 (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro).
Nugent, David (2002): Introduction, in: ders. (ed.): Locating Capitalism in Time and Space: Global Restructurings, Politics and Identity, Stanford: Stanford University Press, S.1-59.
Szanton, David (2004): Introduction: The Origin, Nature and Challenge of Area Studies in the United States, in: David Szanton (ed.): The Politics of Knowledge. Area Studies and the Disciplines, Berkeley: University of California Press, S.1-33.
Wallerstein, Immanuel (1997): The Unintended Consequences of Cold War Area Studies, in: Noam Chomsky et al. (eds.): The Cold War and the University. Toward an Intellectual History of the Postwar Years, NY: Free Press, S.195-231.
Anmerkungen
1) Ich danke Chris Krupa für seine Anmerkungen zu einer früheren Fassung dieses Beitrages.
2) In keiner Weise war das Militär allerdings Erfinder des »Regionen«Konzepts, präferierte es allerdings gegenüber anderen Ansätzen der Befassung mit soziokulturellen Phänomenen. Vor dem Zweiten Weltkrieg spielten »Räume« eine sehr untergeordnete Rolle in den Sozialwissenschaften (vgl. Nugent 2008).
3) Als Ausdruck von »Fairness« haben sozialwissenschaftliche Fakultäten an mehreren größeren Universitäten kürzlich entschieden, bei den Anforderungen für unbefristete Stellen Transparenz herzustellen; fortan seien drei Buchpublikationen erforderlich.
David Nugent ist Professor an der Emory University in Atlanta, USA, wo er das Latin American and Caribbean Studies Program leitet.