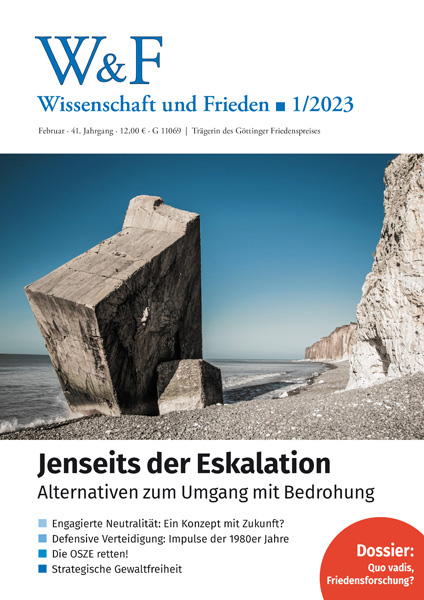Rezension: Pazifismus. Eine Verteidigung
Olaf Müller (2022): Pazifismus. Eine Verteidigung. Ditzingen: Philipp Reclam jun., ISBN: 978-3-15-014354-4, 116 S., 6 €.

Der Pazifismus steht unter Druck – mal wieder. Insbesondere dann, wenn Politik oder auch Wissenschaft den Griff zu den Waffen erwägen, droht dem Pazifismus ein mehr oder weniger schmutziger Abgesang. Das war bereits im Kontext des Kosovokrieges der NATO 1999 so, als Deutschland sich an dem als humanitäre Intervention geführten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beteiligte. Und das ist jetzt im Kontext des russischen Überfalls auf die Ukraine wieder so, welche die Bundesregierung mit allen Kräften einschließlich militärischer Mittel zu unterstützen sucht. Der Pazifismus besitzt jedoch die Kraft, die legitimatorische Erzählung von der Alternativlosigkeit gewaltsamer Lösungsversuche zu unterminieren. Denn er ist, wie Harald Müller – lediglich ein Namensvetter des hier besprochenen Autors – bereits vor über zwanzig Jahren formulierte, jener „Stachel im Fleisch der Selbstgerechten“, der an die „unverrückbare Ungerechtigkeit jedes Krieges“ (Müller 2002, Herv. SJ) erinnert. Das schließt den zulässigen Verteidigungskrieg prinzipiell mit ein, wie ihn nunmehr die Ukraine gegen den russischen Aggressor führt.
Der Pazifismus hat mithin jene Verteidigung verdient, die Olaf Müller in seinem kleinen Buch schwungvoll vorträgt. Den Weg zu seiner eigenen philosophischen Perspektive auf den Pazifismus räumt er erst einmal frei, indem er mit den zwei gängigen Begründungsdiskursen abrechnet: So begibt sich der Autor auf die Suche nach einem „Mittelweg zwischen der moralischen Arroganz von Gesinnungsethikern und der erkenntnistheoretischen Arroganz ihrer verantwortungsethischen Gegenspieler“ (S. 10). Diesen Mittelweg findet er im Pragmatismus nordamerikanischer Prägung. Dieser verzichte auf Prinzipienreiterei und ermögliche mithin eine situationsbezogene Flexibilität, ohne der Beliebigkeit anheim zu fallen. Denn der Autor hält an der Maßgabe der Prinzipientreue fest, er verbindet sie aber mit der Bereitschaft, die Grundsätze „im Lichte neuer Ereignisse zu modifizieren, umzuformulieren und – falls es nicht anders geht – sogar preiszugeben“ (S. 11). Insbesondere übernimmt Müller aus dem Pragmatismus die Einsicht, wonach sich objektive Fakten nicht sauber von Werten und Normen trennen ließen. Das gelte angesichts der Schwierigkeiten eindeutiger Faktenermittlung insbesondere auch für Kriegsgeschichtsschreibung. Vor allem aber komme eine erkenntnistheoretische Besonderheit verantwortungsethischer Folgeabschätzung hinzu, die Müller als kontrafaktische Konditionale problematisiert:
„Wer diese Folgenbetrachtung […] erfolgreich zum Abschluss bringen möchte, muss nämlich nicht nur den tatsächlichen Ablauf der Dinge kennen […]; er muss zusätzlich wissen, wie sich die Dinge in alternativen Szenarien entwickelt hätten: was also dann geschehen wäre, wenn z.B. an die Stelle eines bestimmten Kriegs der Verzicht auf diesen Krieg getreten wäre. Die philosophische Schwierigkeit, die sich hier auftut, hat damit zu tun, dass alternative Szenarien kein Teil der Wirklichkeit sind; sie lassen sich nicht so beobachten wie der Krieg vor unserer Haustür“ (S. 38).
Gerade weil das alles unmittelbar einleuchtet, frappiert es umso mehr, mit welcher Gewissheit sich wissenschaftliche wie politische Deuter*innen des Ukrainekrieges unterschiedlichster Couleur immer wieder über die prinzipiellen Schranken ihrer Erkenntnis hinwegsetzen, indem sie vorgeben, genau zu wissen: wie es zum Ukrainekrieg gekommen ist; was geschehen wäre, hätte sich die Staatengemeinschaft zu einem gewissen Zeitpunkt anders verhalten; und was passieren wird, wenn eine bestimmte Handlung heute ergriffen oder eben unterlassen würde. Demgegenüber erinnert Müllers Pragmatismus in erfreulicher Weise an die gebotene erkenntnistheoretische Demut, die ein unnachgiebiges Beharren auf der je eigenen Einsicht systematisch unterspült. Auf dieser Ebene sind Pazifismus und Bellizismus also erstmal gleichgestellt.
Wie begründet Müller nun seine Präferenz für den Pazifismus? Hier hält sein Argumentationsgang eine Überraschung bereit. Erwartet würde der direkte Weg über eine primär normative bzw. ethisch-moralische Positionierung gegen die Zulässigkeit des Tötens – also eine pazifistische Spielart der Friedensethik, die jene eben nicht über den Gedanken der gerechtfertigten Gewalt oder gar über die Lehre des gerechten Krieges entwickelt, wie das in dieser akademischen Disziplin durchaus üblich ist. Zwar gibt es auch bei Müller eine normative Komponente. So sieht er Pazifist*innen mit einem spezifischen „Wertekompass“ (S. 74) ausgestattet. Bei ihnen gingen der „Glaube an den Frieden und die Sehnsucht nach dem Frieden […] Hand in Hand“ (S. 77), so Müller. Aber die Existenz dieses Wertekompasses wird als im einzelnen Individuum gegeben oder (noch) nicht gegeben vorausgesetzt, jedoch nicht mit einer ethisch-moralischen Überlegenheit pazifistischer Normen begründet. Eher sei dieser Kompass Ausdruck des „ganze[n] Inhalt[s] unseres seelischen Gepäcks“. In dieses „Gesamtbild“ (S. 99) gingen u.a. Werte, Normen, Leitprinzipien, kontrafaktische Wenn-dann-Meinungen, Grundüberzeugungen, Erinnerungen, Gefühle und Schönheitsempfindungen ein. Dazu rechnet Müller auch „den Glauben an das Gute im Menschen“ und an die „Liebe“ (S. 98), auf den andere säkular wie religiös inspirierte Pazifismen ebenfalls zurückgreifen. Den naheliegenden Vorwurf eines naiven Optimismus entkräftet der Autor allerdings gleich mit. Der Pazifismus sei tatsächlich nicht optimistischer als sein bellizistischer Gegenspieler. Vielmehr seien die optimistischen und pessimistischen Elemente in beiden Denkansätzen spiegelverkehrt verteilt: Der Pazifismus vertraue zwar auf das Gute im Menschen, misstraue jedoch der Beherrschbarkeit kriegerischer Gewalt – beim Bellizismus sei es umgekehrt. Dieses persönliche Gesamtpaket sieht Müller nicht als in Stein gemeißelt, sondern als „ständig im Wandel begriffen“ (S. 99) an. Aber im Streit darüber, ob nun der Pazifismus oder der Bellizismus vorzuziehen sei, findet er auch auf der Ebene der Gesamtpakete mit ihren „gegensätzlichen Mischungen aus Optimismus und Pessimismus […] kein zwingendes, objektives Argument“ (S. 98, Herv. SJ) für eine der beiden Optionen.
Dennoch redet Müller nicht einem subjektivistischen Dezisionismus das Wort, wonach der einzelne Mensch zwischen einander ausschließenden Positionen nur frei nach Gusto entscheiden könne. Vielmehr offeriert er ein Argument für den Vorrang des Pazifismus: Das pazifistische Gesamtpaket sei seinem bellizistischen Gegenstück vorzuziehen, denn es passe „insgesamt besser in das gesamte Bild dessen, was sich die meisten unserer Zeitgenossen in ihrem Lebens- und Meinungswandel mehr oder minder deutlich von der Welt, von der Menschheit und von sich selber zurechtgelegt haben“ (S. 98). Das liest sich zunächst wie ein Plädoyer für die Geltungsmacht empirischer Quantität, getreu dem Motto »Millionen Bildzeitungsleser können nicht irren«. Allerdings greift diese Interpretation zu kurz. Denn Müller würde seinen Pazifismus wohl auch dann nicht aufgeben, wenn sich empirisch herausstellte, dass die Mehrheit der Menschen dem bellizistischen Gesamtpaket zuneigte. Wie sich in der obigen Rede von der besseren Einfügung eines Aspekts in ein bestimmtes Ganzes andeutet, geht es dem Autor um eine Entscheidung vornehmlich entlang außerempirischer Theorietugenden, denen auch eine starke ästhetische Dimension innewohnt. Dabei lässt er sich insbesondere vom Ideal der Stimmigkeit, aber auch von den Kriterien der Einfachheit und Schönheit leiten. Diese (ästhetischen bzw. ästhetisch aufgeladenen) Vorgaben destilliert Müller, der neben Philosophie auch Mathematik und Informatik studiert hat, aus den Naturwissenschaften, deren Ästhetik er bereits in anderen Werken ausführlich thematisiert hatte. Die erwählten Kriterien sieht er deutlich stärker mit dem Pazifismus als dem Bellizismus korrespondieren. Diese aus den exakten Wissenschaften geborgte Autorität schirmt den Pazifismus auch vor Vorwürfen der Naivität ab: Was in den – der Weltfremdheit und Ideologisierung unverdächtigen – Naturwissenschaften richtig sei, so das Argument, könne dem Pazifismus nicht mehr mit gutem Grund vorgeworfen werden.
Allerdings bereitet die Einfachheit, für die Müller plädiert, auch Mühen. Denn seines Erachtens überzeugen im konkreten Konfliktfall nicht allein die abstrakten Prinzipien des Pazifismus. Vielmehr müssen konkrete Handlungsalternativen hinzukommen. Und diese bedürfen einer intensiven Einarbeitung in die jeweiligen Konflikte, wie es der Autor am Beispiel des Kosovokrieges schon einmal vorexerziert hatte. Dass sich die wahrnehmbare Realität nicht immer dem pazifistischen Blick geschmeidig fügen dürfte, dessen zeigt sich der Autor selbstreflexiv bewusst. Und damit befindet er sich vollständig in Übereinstimmung mit seinen Einsichten in die erkenntnistheoretischen Schranken, denen auch ein sympathischer Pazifismus unterliegt. Daher sei es zum einen „keine Schande, eine […] Wissensschwäche zuzugeben“ (S. 104). Zum anderen hadert der Autor mit einer „kaum auszuhaltende[n] Spannung“ (S. 107) zwischen seinem Impuls, der Ukraine als dem Opfer einer völkerrechtswidrigen Aggression auch mit militärischen Mitteln beizuspringen, und den Haltelinien, die ihm sein pazifistisches Gesamtpaket auferlegt, das eben eine prinzipielle Skepsis gegenüber der Begrenzbarkeit kriegerischer Gewalt einschließt. Trotz zahlreicher Handlungsoptionen unterhalb der militärischen Schwelle, die von der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bis hin zu starken Wirtschaftssanktionen gegen Russland reichen können, räumt Müller ein, dass er weder mit sich selbst noch mit der Welt im Reinen sei: „Auch deshalb bin ich alles andere als sicher, dass ich es insgesamt richtiger sehe als die Gegner des Pazifismus.“ (S. 107) Wer dieses Eingeständnis nun gegen den Autor und seine Position wendet, setzt sich nicht nur über die Grenzen der eigenen Erkenntnis hinweg, sondern schreibt den gegenwärtigen Machtdiskurs fort, in dem unliebsame Positionen nicht argumentativ ernstgenommen, sondern diffamiert und ausgegrenzt werden.
Alles in allem präsentiert Müller eine eigene Version des Pazifismus, dessen einzelne Facetten durch die philosophische Perspektive des Pragmatismus zusammengehalten werden. Gerade angesichts der inhaltlichen Fülle beeindrucken argumentative Konsistenz und sprachliche Leichtigkeit umso mehr. Auch wer dem Müller’schen Pazifismus nicht zustimmen mag: Anregungen zum Schärfen der eigenen Position findet er allemal. Lange Rede, kurzer Sinn: Kleines Büchlein ganz groß.
Literatur
Müller, H. (2002): Stachel im Fleisch der Selbstgerechten. Frankfurter Rundschau, 24.01.2002.
Sabine Jaberg