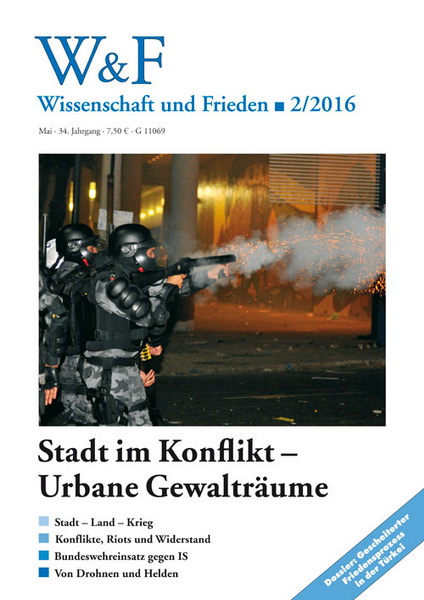Stadt und Frieden
Eine architektonisch-umweltpsychologische Betrachtung
von Nicole Conrad und Klaus Harnack
Die Stadt: Anregung, Abwechslung, Arbeitsplätze, Anonymität in der Masse, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Eine Stadt, der gebaute Raum, ist das Spiegelbild der Gesellschaft, die sie gebaut und weitergebaut hat. Die Stadt ist ein interdependentes und dynamisches Konstrukt, dessen Wirkung ihre Strukturen und Werte rückkoppelnd verstärkt. Städte sind folglich materiell-räumlich fixierte Werte und gehören zu den grundlegenden Einheiten der menschlichen Zivilisation. Der Beitrag versucht, die Wirkungsweisen einiger neuralgischer Punkte, die die Strukturen und Werte der Stadt definieren, aufzuzeigen und mögliche Chancen und Entwicklungspotentiale für den Zivilisationsraum Stadt darzustellen.
Jede Stadt hat ihre eigene Logik, und häufig werden durch die Stadt Werte festgeschrieben, die nie beabsichtigt waren und weder zeitgemäß noch zukunftsweisend und nachhaltig sind. Betrachten wir beispielsweise die autogerechte Stadt mit ihren großen Um- und Neuplanungen in den 1960er Jahren: Hier wird der öffentliche Raum von motorisiertem Individualverkehr und dem geparkten Automobil dominiert. Ein öffentliches Leben findet dort nur begrenzt statt, und nicht selten leiden diese Städte inzwischen unter den Folgen von Umweltbelastung und sozialen Problemen, die aus den über ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Planungsentscheidungen resultieren. Die Bedürfnisbefriedigung der StadtbewohnerInnen, vor allem der sozial Benachteiligten, bezüglich Wohnen, Wohnumfeld und Stadtraum wird durch diese Lebensbedingungen oft stark eingeschränkt.
Ähnliche Fehlentwicklungen finden wir in Städten, in denen der öffentliche Raum fast exklusiv dem Konsum dient: Kein Sitzplatz ohne Verzehr, kein Vergnügen ohne Bezahlung, keine Flächen, die der Bevölkerung »einfach so« zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Spielplätze, kleine Parks oder Sportflächen. Hier werden bestimmte Bevölkerungsschichten nicht mit Zäunen, sondern durch ihre fehlende Kaufkraft ausgegrenzt. Ähnlich verhält es sich mit Städten, deren Quartiere nach Einkommen oder ethnischer Zugehörigkeit der BewohnerInnen aufgeteilt sind. Segregation, Gentrifizierung, Gated Communities oder Slums sind Zeichen einer zu Stein gewordenen sozialen Ungleichheit.
Um das Potenzial von Städten als materiell-räumliche Vermittler von Werten ausschöpfen zu können, müssen Ziele definiert werden, die die Befriedigung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse fördern. Ein Positivbeispiel für die Abwendung der Autofixiertheit ist Kopenhagen: Hier wurde der innerstädtische öffentliche Raum Stück für Stück vom Verkehr befreit und der Bevölkerung wieder zur Verfügung gestellt. Eine solche stadtplanerischen Umorientierung ermöglicht auch die (Wieder-) Zurverfügungstellung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, um die Biodiversität in der Stadt zu erhöhen und das Stadtklima zu verbessern. In diesem Zuge wird zunehmend auch die Bereitstellung von Flächen zur innerstädtischen Lebensmittelproduktion und Energiegewinnung thematisiert.
Bedürfnisse
Was also soll, muss und kann eine Stadt leisten? Welche Werte soll sie vermitteln? Wie sieht das menschliche Habitat Stadt aus, das seine BewohnerInnen möglichst konfliktfrei auf engem Raum miteinander leben lässt? Einen auf den ersten Blick skurrilen Denkanstoß lieferte der Zoologe Hinrich Sambraus mit folgender Äußerung: „Wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, läuft das Zusammenleben der Schweine äußerst harmonisch ab. So wie beim Menschen auch.“ (Greiner 2015)
Folgen wir diesem Bild der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse in Anlehnung an die vom US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow (1943) beschriebene Bedürfnishierarchie, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
- Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und sauberem Wasser muss gewährleistet sein.
- Es wird Wohnraum benötigt, der Privatheit, Rückzug, ruhigen Schlaf, Wärme, Sauberkeit, Schutz und Sicherheit bietet.
- Die BewohnerInnen benötigen Arbeitsplätze und die Möglichkeit, dorthin zu gelangen.
- Der Lebensraum muss Orientierung, Vertrautheit und Beständigkeit vermitteln und die Möglichkeit zu Kontakt, Teilnahme, Identifikation und Integration bieten.
- Außerdem sollte der Lebensraum das Bedürfnis nach Anregung und Ästhetik befriedigen sowie Bildung und ein kulturelles Leben ermöglichen.
Mit der Frage, wie Städte diese Bedürfnisse befriedigen könnten und welche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Aspekten bestehen, befassen sich u.a. Umwelt- und Architekturpsychologen. Ausgehend vom amerikanischen Mitbegründer der modernen Umweltpsychologie, Roger Barker, der den Begriff des »Behavior Setting« prägte, werden nachfolgend einige Zusammenhänge aufgezeigt.
Mechanismen
Ein Behavior Setting beschreibt, wie das Verhalten von Menschen über das Setting beeinflusst wird (Barker 1968). Das Setting stellt die Summe aller Einflussfaktoren dar: der Raum mit seinen Gestaltungselementen, die anwesenden Personen und deren Verhalten. Barker stellte fest, dass das Verhalten einer bestimmten Person sich vom Verhalten der anderen Personen im selben Setting weniger stark unterscheidet als von seinem eigenen Verhalten in einem anderen Setting. Betrachten man das Setting »Kirche« im Vergleich zum Setting »Bierzelt«, wird schnell klar, was Barker meinte: Die Umgebung kommuniziert über ihre Gestaltungsmerkmale einen Verhaltenskodex.
Ähnlich beschreibt die Anfang der 1980er Jahre entwickelte Broken-windows-Theorie den Einfluss der unmittelbaren Umwelt auf das menschliche Verhalten (Kelling and Wilson 1982). Die Theorie lässt sich vereinfacht am Beispiel weggeworfener Bonbonpapiere illustrieren: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein Bonbonpapier einfach auf den Boden anstatt in den Papierkorb wirft, wird beeinflusst durch den Verschmutzungsgrad der unmittelbaren Umwelt. Liegen bereits Bonbonpapiere auf dem Boden, so sinkt die Hemmschwelle, ein weiteres fallen zu lassen. Im Kern verfolgt die Theorie also die Logik, dass es räumlich-strukturelle Kondensationskerne für friedensantagonistisches Verhaltens gibt. Weiteren gibt es Hinweise, dass Unordnung als Stressor wirkt sowie als Zeichen fehlender sozialer Kontrolle und damit als Sicherheitsdefizit wahrgenommen wird. Der holländische Umweltpsychologe Kees Keizer (2008) konnte mit seinem Team empirisch zeigen, dass Unordnung oder Graffiti weitere normverletzende Handlungen und damit letzten Endes auch Kriminalität begünstigt.
Ein weiteres Element, das besonders in unterprivilegierten Stadtteilen ein Problem darstellt und in der neueren Stadtplanung Berücksichtigung findet, ist die so genannte räumliche Ungerechtigkeit (spatial injustice). Sie ist gekennzeichnet durch eine räumliche Unausgewogenheit zwischen Stressoren und erquickenden Stadtelementen. So finden sich in unterprivilegierten Stadtteilen Kindergärten oder Schulen oftmals in der Nähe großer Durchgangsstraßen oder sogar in Einflugschneisen von Flughäfen. Dadurch wird die Benachteiligung der BewohnerInnen zusätzlich verstärkt.
Für die friedliche Stadt ist die Befriedigung elementarer Sozialbedürfnisse ein zentrales Element. In einer Studienreihe, die die Entwicklung von Sozialkontakten im gebauten Raum zum Inhalt hatte, untersuchte der Sozialpsychologe Matthew Easterbrook zusammen mit seinen Kollegen das Verhalten von Studierenden in Abhängigkeit von ihrer Wohnsituation. Es konnte gezeigt werden, dass die Wohnsituation einen Einfluss auf die Entstehung von Freundschaften hatte. Anhand der Anzahl zufälliger Begegnungen der BewohnerInnen untereinander konnte die Entstehung und Anzahl von Freundschaften vorhergesagt werden. Entscheidend war hierbei die Art der Wohnungsausstattung, z.B. Einzel- oder Gemeinschaftsbad oder Gemeinschaftsküche vs. individuelle Küchenzeile (Easterbrook and Vigonoles 2015). Eine weitere Studie (Ebbesen et al 1976), die sich mit der Lage der Wohnung (nahe bei oder entfernt von einer stark frequentierten Treppe) und den sozialen Beziehungen der BewohnerInnen beschäftigte, kam zu ähnlichen Ergebnissen: Je größer die Anzahl zufälliger Kontakte, umso größer die Zahl positiver sozialer Beziehungen.
Was tun?
Über Planungsvorgaben kann die Stadtverwaltung versuchen, eine ausgewogene Durchmischung herzustellen und in allen Stadtteilen Wohnraum für unterschiedliche Einkommensschichten zur Verfügung zu stellen. Im Interesse der Allgemeinheit wäre dies wünschenswert, um Segregationsprozessen entgegen zu wirken und die Spirale von Gewalt und Kriminalität in benachteiligten Gebieten zu unterbrechen. Solche Vorgaben sind derzeit aber nur schwer umzusetzen, denn häufig bestimmt der freie Markt über den Wohnraum. Als Alternative kann die Stadtverwaltung die Lebensqualität in den benachteiligten Gebieten durch Einrichtung von Parks, Spiel- und Sportstätten, mit Immissionsschutzmaßnahmen und der Pflege und Aufwertung des Straßenraums gezielt erhöhen. Dabei muss besonders darauf geachtet werden, dass über eine solche Aufwertung nicht ein Verdrängungsprozess der ursprünglichen Bewohner, also eine Gentrifizierung, in Gang gesetzt wird.
Im Stadtzentrum ist es wichtig, dass den BewohnerInnen frei nutzbare Flächen mit Stadtmobiliar zur Verfügung stehen und einer Kommerzialisierung dieser Flächen durch Stände, Cafés und vor allem Werbeflächen entgegen gewirkt wird. Im Zentrum sollte FußgängerInnen und RadfahrerInnen Vorrang gegeben werden. Der motorisierte Individualverkehr stellt gerade für Kinder und ältere Menschen ein enormes Sicherheitsrisiko dar und schränkt die Nutzung öffentlicher Flächen stark ein.
Die Stichworte Anregung, Kunst, Kultur, Bildung, Entwicklungsperspektiven, Anerkennung und Selbstwert beschreiben einen weiteren Bereich, über den die Ungleichheit mit Hilfe von Stadtplanungsmaßnahmen abgeschwächt und damit die Entstehung von Aggression eingedämmt werden kann. Hier sind konkrete Maßnahmen, wie der erleichterte Zugang zu Bildungseinrichtungen, Museen, Kunst und kulturellen Veranstaltungen, zu nennen. Ein erster Schritt: In vielen Städten wird ein freier Eintritt für Kinder, junge Erwachsene und Geringverdiener bereits gewährt. Die konsequentere Variante ist das Vorgehen Londons: Zahlreiche Museen und Galerien von Weltrang, wie die National Gallery oder Tate Modern, stehen allen BesucherInnen frei zur Verfügung.
Wichtig für die Prävention von sozialen Ungleichheiten und die daraus resultierenden Konflikte ist der Bereich der Ernährung. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, ob gesunde Lebensmittel leicht zu bekommen sind oder ob sich das Angebot in der Nachbarschaft auf den Discounter und die Fastfood-Kette beschränkt. In einer Studie des Gesundheitspsychologen Paul Rozin zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang von Übergewicht und den damit verbundenen Folgeerkrankungen zur räumlichen Nähe von Fastfood-Restaurants im Stadtquartier (Rozin et al. 2011). Angebote für eine gesunde Lebensweise im Stadtraum, wie die Nähe zu Parks, Urban-gardening-Initiativen oder Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche, sind gleichfalls relevante Faktoren. Auch bezüglich der medizinischen Versorgung und des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen unterscheiden sich die Quartiere in einer Stadt oft deutlich.
Was zukünftig tun?
Die Stadt und der gebaute Raum beeinflussen also auf vielfältige Art und Weise das Verhalten und Empfinden der Menschen. Zugleich manifestiert die Stadt, wie wir als Gesellschaft zusammen leben möchten: In welchem Maß nehmen wir soziale Ungleichheit als gegeben hin, wie sehr legen wir Wert auf die Befriedigung der Bedürfnisse aller BewohnerInnen?
Städte, die zukunftsfähig sein wollen, müssen zukunftsweisende Ziele definieren und sich einem Wandel unterziehen, der nicht nur räumlicher, sondern auch gesellschaftlicher Natur ist. Trotz der Komplexität dieser Aufgabe kann jeder einzelne über kleine Interventionen im gebauten Raum einen Teil dazu beitragen, die Stadt zu einem besseren Lebensraum für alle BewohnerInnen zu machen und damit Konflikte zu vermeiden. Kleine Maßnahmen, wie die Gestaltung des Straßenraums mit Bepflanzungen oder dem Aufstellen einer Bank, die Einrichtung eines Stadtteilgartens oder Spielplatzes, das Anregen eines Quartierstreffpunkts, das Erkämpfen eines Radwegenetzes etc., können dabei durchaus wirkungsvoll sein.
Zahleiche Städte weltweit haben bereits begonnen, im Sinne einer umweltpsychologischen Stadtplanung das friedliche Zusammenleben zu fördern. Positivbeispiele sind die »laneways and arcades« in Melbourne/Australien, der anstehende Bau einer Stadtseilbahn in Bogotá, die fantasievolle farbliche Gestaltung von Favelas oder heruntergekommenen Stadtteilen (vgl. Haas&Hahn 2014), Urban-gardening-Projekte und der Aufbau von Stadtteilcafés.
Städte sind nur schwer planbar und sehr komplex. Dennoch muss geplant werden, denn die Struktur und die Werte einer Stadt beeinflussen Konflikte und Friedensprozesse regional und global. Entscheidende Faktoren dabei sind die Beziehung zum direkten Umland (Verkehr, Industrien), der Umgang mit Ressourcen und Naturraum (Wasser, Abfall, Energieverbrauch, Biodiversität im Stadtraum, öffentliche Verkehrssysteme, Klimagerechtigkeit), der Verbrauch und die Produktionsweisen (Nachhaltigkeit, Förderung regionaler Produkte, innerstädtische regenerative Energiegewinnung und Lebensmittelproduktion) und die Raumforderung (massive Urbanisierung vs. Stärkung von Unterzentren).
Um diese Wechselwirkungen besser modellieren zu können, muss die Stadt weiter untersucht und verstanden werden; Bedürfnisse müssen erkannt und Handlungsempfehlungen beschrieben werden. Hier bedarf es verstärkter inter- und multidisziplinärer Stadtforschung und einer Plattform, auf der Informationen zu »Best Practices« veröffentlicht und für die Praxis zugänglich gemacht werden.
Literatur
Roger Garlock Barker (1968): Ecological psychology – Concepts and methods for studying the environment of human behavior. Standford/California: Stanford University Press.
Kerstin Greiner (2015): Zurück zur Natur. Süddeutsche Zeitung Magazin, 24. September 2015.
Abraham A. Maslow (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), S.370-396.
Matthew J. Easterbrook and Vivian L. Vignoles (2015): When friendship formation goes down the toilet – Design features of shared accommodation influence interpersonal bonds and well-being. British Journal of Social Psychology, 54(1), S.125-139.
Ebbe B. Ebbesen, Glenn L. Kjos and Vladimir J. Konecni (1976): Spatial ecology – Its effects on the choice of friends and enemies. Journal of Experimental Social Psychology, 12(6), S.505-518.
Haas&Hahn (2014): How painting can transform communities. Transcript eines Vortrags der Künstler Jeroen Koolhaas and DreUrhahn vom 24. Oktober 2014; ted.com/talks.
Kees Keizer, Siegwart Lindenberg and Linda Steg (2008): The spreading of disorder. Science 322(5908), S.1681-1685.
George L. Kelling and James Q.F. Wilson (1982): Broken Windows -The police and neighborhood safety. The Atlantic, March 1982.
Paul Rozin, Sydney Scott, Megan Dingley, Joanna K. Urbanek, Hong Jiang and Mark Kaltenbach (2011): Nudge to nobesity I – Minor changes in accessibility decrease food intake. Judgment and Decision Making, 6(4), S.323.
Weitere Hinweise und Anregungen u.a. auf internationalcitiesofpeace.org und c40.org.
Dipl.-Ing.Nicole Conrad ist freie Architektin, Stadtplanerin und Lehrbeauftragte für Architektur an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Außerdem ist sie ausgebildete Sozialpsychologin.
Dr. Klaus Harnack arbeitet und lehrt am Psychologischen Institut der Westfälischen Universität Münster zum Thema Mediation und Verhandlung.