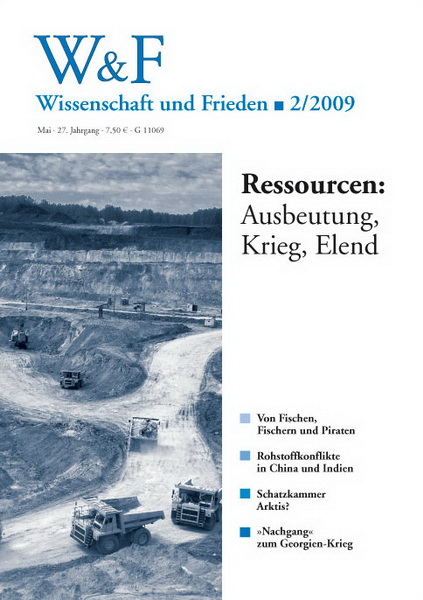Von Fischen, Fischern und Piraten
von Francisco Mari und Wolfgang Heinrich
Eine ganze Armada von Kriegsschiffen tummelt sich gegenwärtig im Golf von Aden. Sie machen Jagd auf neuzeitliche Piraten. Wie zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gerät dabei Somalia in den Mittelpunkt einer militärischen Strategie zur Lösung eines im Kern politischen Problems. Damals ging es um »Terrorismus«, heute geht es um Handelsrouten. Dabei rangiert das Gebiet um den Golf von Aden weltweit erst an dritter Stelle in Bezug auf Piraterie. An der Spitze liegt Nigeria, dicht gefolgt vom Ursprungsgebiet der modernen Piraterie, Indonesien mit der Straße von Malakka.
In der Hysterie über die Folgen der Piraterie für unsere Handelsströme und die Freiheit der Kreuzfahrtschiffe werden die eigentlichen Ursachen, die dazu führen, dass gerade an Afrikas Küsten die Überfälle auf Handelsschiffe zunehmen, nur selten erwähnt. Außen vor bleibt, dass die jahrzehntelange Ausbeutung von Fischgründen und Bodenschätzen durch die Industrienationen an den afrikanischen Küsten eine vielschichtige Basis für die Organisierung von kriminellen Aktivitäten geliefert haben. „Früher waren wir ehrliche Fischer, aber seit Fremde unsere Meere leer fischen, müssen wir nach anderen Wegen suchen, um zu überleben“, sagt Abdullah Hassan, 39 Jahre alt. Er ist Chef einer Gruppe aus 350 ehemaligen Fischern und Milizangehörigen, die sich »Küstenwache« nennt.1 Er lebt in der sogenannten Welthauptstadt der Piraterie, dem ehemalige Fischerdorf Eyl 2 mit seinen 18.000 Einwohnern im halbautonomen Gebiet Puntland im früheren Somalia.
Was nach einer beschönigenden Ausrede für kriminelles Handeln klingt, hat leider handfeste Ursachen. Mit dem Zusammenbruch der staatlichen Autorität in Somalia, noch mehr aber nach dem Rückgang der Thunfischbestände im östlichen Pazifik, wurde die fischreiche Küste vor Somalia interessant für asiatische und europäische Trawler. Die Fischer Somalias hatten keine reale Chance mehr, selbst Thunfisch zu fangen; ihre Boote sind zu klein, sie erreichen kaum die Schwärme weit vor der Küste. Auch der lukrative küstennahe Krabben- und Hummer-Fang wurde ihnen in den letzten Jahren durch die Trawlerflotten Europas und Asiens weggeschnappt. Kommt hinzu, dass – wie überall auf der Welt, nur in Somalia vollkommen unkontrolliert – die Unmengen Beifang auch die küstennahen Fischsorten extrem reduziert haben.
Die Plünderung der afrikanischen Fischbestände.
Somalia ist kein Einzellfall. Die jahrzehntelange Plünderung der Gewässer vor Afrikas Küsten hat auch die Konflikte im Fischereibereich entlang der westafrikanischen Küste drastisch erhöht. Auslöser dafür ist, dass die Ausbeutung der eigenen Fanggründe in Europa, Korea und Japan – diese stellen nach dem pro Kopf Verbrauch das Gros der Fischkonsumenten dar (gefolgt von Kanada und den USA) – ihre Grenzen erreicht hat. Zusätzlich beschränken hier die Kontrolle der Küstengewässer sowie die Überwachung von Fangmethoden und Fangmengen die Profite der Fischerei erheblich.
Durch die Erweiterung der Hoheitsgewässer auf 200 Seemeilen in den 1980er Jahren standen die Gewässer vor den afrikanischen Küsten nicht mehr ohne weiteres als billige Alternative zur Verfügung. Allerdings ließ der damalige UN-Beschluss die Tür zu den Fischreichtümern der Welt für die Fischfangflotten der Industriestaaten weit offen, indem festgelegt wurde, dass die Zone zwischen 12 und 200 Seemeilen zur wirtschaftlichen Nutzung ausgeschrieben werden muss, wenn die Staaten selbst diese nicht abfischen können. Aber welches Entwicklungsland hatte damals hochseefähige Fischkutter? In Westafrika war das nur Ghana.
Also boten europäische Länder mit ihren Fangflotten vielen afrikanischen Ländern Fischereiabkommen an. Es wurde Kompensation vereinbart – basierend auf einer Begrenzung der Anzahl von Trawlern, aber ohne Nennung von Quoten. Gleichzeitig wurde in Europa der Bau von neuen, größeren Trawlern subventioniert. Nur Ghana weigerte sich, ein solches Abkommen zu unterschreiben.
Meist ging es in den letzten Jahren nur um die Folgen der Fischereiabkommen auf das ökologische Gleichgewicht und die Lebensbedingungen der Kleinfischer. Mauretanien, Senegal, Guinea – um nur die Länder mit den höchsten Kompensationen zu benennen – hatten ihre Küsten den europäischen Trawlern zum Abfischen geöffnet und dafür einen finanziellen Ausgleich bekommen. Die Kleinfischer und die gerade entstandene kleine industrielle Fischerei in diesen Ländern haben von diesen Geldern nichts gesehen.
In den neuen, nun »Fischereipartnerschaftsabkommen« genannten Verträgen wird zumeist festgeschrieben, dass ein Teil der Mittel zur Unterstützung der Kleinfischer verwendet werden soll. Dabei geht es aber meist darum, ihnen technische Hilfe zu leisten, damit sie ihren Fang der industriellen Fischerei und damit dem Export – sprich dem europäischen Bedarf – zuführen können. Besonders in Mauretanien wird das durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Nicht einmal die EU-Kommission behauptet, dass diese Abkommen auf wirklich unabhängigen Untersuchungen über die Situation der Bestände beruhen, obwohl sie sich durch Ruhezeiten, Vorgaben bei den Fangtechniken und Zulassung von Kontrolleuren auf den Trawlern der Problematik bewusst ist. Entsprechend haben die Abkommen zu einem großen Rückgang der Meeresressourcen geführt. Wie in Somalia nicht nur bei dem Fisch, der für die europäischen Märkte interessant ist, sondern eben auch bei den küstennahen Beständen, die früher den lokalen Bedarf gedeckt haben.
Wie Ghana um seine Reichtümer gebracht wurde
Ghana ist ein Beispiel dafür, wie sehr ein Land ohne Abkommen genauso um seine Bestände gebracht werden kann und dann noch nicht einmal einen kleinen Sold dafür erhält. Ghana war vor der Erweiterung der 12 Meilen Zone Westafrikas Fischereination Nr.1. Ghana fischte überall in Westafrika. Vom einstigen Stolz der 140 Fischtrawler, die nach der Unabhängigkeit von der ehemaligen Sowjetunion an Ghana geliefert wurden, sind noch 45 geblieben. Davon sind höchstens noch 20 Thunfischboote wirklich in ghanaischem Besitz. Ghana wurde systematisch um seine Reichtümer gebracht:
Durch die Erweiterung der Hoheitsgewässer durften die ghanaischen Fischer nicht mehr wie früher in den Nachbargewässern fischen, da die Fischereirechte in diesen an Europa verkauft wurden.
Die Weltbank zwang Ghana zum Verkauf, zu Privatisierung und zum Abwracken der staatlichen Flotte. Im Rahmen seiner Entschuldung musste Ghana ausländischen Investoren den Zugang zur Fischerei gewähren. Immerhin musste es nur bis zu 49% seiner Besitzanteile an den Fischerbooten abgeben. In der ghanaischen Hauptstadt Accra ist es aber kein Geheimnis, dass auch die restlichen 51% überwiegend koreanische und chinesische Besitzer haben, die sich ghanaischer »Strohpuppen« bedienen.
Die küstenfernen Fischschwärme werden illegal von europäischen Trawlern, die aus ihren legalen Nachbarpositionen in die Gewässer eindringen, abgefischt. Das führt dazu, dass die ghanaischen Kutter mit koreanischen oder chinesischen Mannschaften in die für die Kleinfischer reservierten küstennahen Zonen eindringen. Mit illegalen Fangtechniken zerstören sie die Bestände und den Jungfisch sowie die Netze der Kleinfischer.
Die Existenzgrundlagen der Kleinfischer werden so vernichtet. Hinzu kommt, dass aus den Fischtrawlern der minderwertige Beifang in Eisblöcken angelandet und billig auf den Markt geworfen wird, so dass er die Preise kaputt macht, die die Kleinfischer für ihre geringen Mengen an Frischfisch bisher erzielen konnten.
Illegal in Küstennähe fischende ausländische Fischerboote, die Netze zerstören, in Kollisionen oder sogar tödliche Unfälle verwickelt sind, werden nur selten zur Rechenschaft gezogen. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht einer Menschenrechtsorganisation in Johannesburg wird detailliert beschrieben, dass der gesamte Fischereisektor Afrikas durchsetzt ist mit Korruption, Begünstigung und mafiösen Strukturen, die von europäischen und asiatischen Unternehmen genutzt werden, um sich den letzten Fang zu sichern.
Rebellion im Nigerdelta
Die großen Mangrovenwälder vor Nigerias Küste sind die Laichgründe für die meisten Fischarten im Golf von Guinea. Sie boten jahrhundertelang den Küstenbewohnern eine ausreichende und sichere Nahrungsgrundlage. Nigerias Gewässer blieben auch nach der Erweiterung der Hoheitsgewässer mangels ausreichender Fischvorkommen für die EU uninteressant für ein Fischereiabkommen. In Nigeria ist man an anderen Vorkommen interessiert, die allerdings viel gefährlicher geworden sind für die nigerianischen Küstenbewohner.
Die Erdölvorkommen sind zum weltweit bekannten Fluch einer Region rund um das Nigerdelta geworden. Von Anbeginn wurden die Küstenbewohner von ausländischen Investoren und den von ihnen geförderten korrupten nigerianischen Eliten vom Reichtum ausgeschlossen. Selbst einfache Arbeitsplätze wurden der Küstenbevölkerung nicht angeboten. Stattdessen wurden große Teile des Landes ökologisch verseucht, die küstennahe See verschmutzt und die gesamte soziale und kulturelle Lebenswelt zerstört.
Chibuike Rotimi Amaechi, Gouverneur des River State, klagt in einem Interview, dass die Manager der Ölfirmen ihre ausländischen Freunde auf die leitenden Positionen setzen, die nun „in teuren Wohnanlagen mit modernen Klimaanlagen, Tennisplätzen und Schwimmbädern hinter Stacheldrahtzäunen und bewacht von schwer bewaffneten
Widerstand gegen Plünderung
Zum ersten organisierten Widerstand gegen die weitere legalisierte Plünderung seiner Gewässer hatte im Jahre 2005 das Angebot der EU für einen neuen Vertrag mit Senegal geführt. Die EU bot einen Vertrag mit reduzierter Kompensation an, mit der zynischen Begründung, die Fischgründe wären nicht mehr so ergiebig wie früher. Dies brachte nicht nur die Kleinfischer in Rage. Nachdem sich 15 Jahre lang die europäischen Trawler billig am Fischbestand Senegals bedient hatten, empfand es auch die ansonsten neo-liberal agierende Regierung von Präsident Wade als Provokation, dass die durch diesen Raub und die Überfischung verursachte Verringerung der Fischbestände nun als Begründung für die Reduzierung der Zahlungen benutzt wurde. Bis heute hat Senegal kein neues Abkommen unterschrieben. Ob das Land und vor allem die Kleinfischer damit besser fahren, ist aber – das zeigt das Beispiel Ghana – nicht ausgemacht. Kommt hinzu, dass die Vergabe von Einzellizenzen an private Fischereiflotten noch undurchsichtiger ist. Jedenfalls findet man im Hafen von Dakar nach wie vor modernste Trawler unter spanischer Flagge, was eigentlich nicht mehr sein darf, weil nur noch Fischerboote mit senegalesischer Flagge in Senegals Gewässern fischen dürfen.
Vom Fischer zum Flüchtling…
Wie lange werden sich Kleinfischer das noch gefallen lassen? Noch vor kurzem war für viele jugendliche Kleinfischer Westafrikas die Migration über das offene Meer ein Ausweg aus ihrer verzweifelten Situation. Aber auch hier beweist Europa, ähnlich wie in Somalia, wie effektiv es seine Interessen zu schützen weiß. Die »Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen«, kurz FRONTEX, sorgte mit modernster Technologie für einen deutlichen Rückgang der Flüchtlinge, die sich Richtung Kanarischer Inseln auf den Weg machen. Offiziell nur außerhalb der Hoheitsgewässer Afrikas tätig, spürt sie den kleinen überfüllten Booten nach, schickt sie zurück oder bringt sie zur Abschiebung der Bootsflüchtlinge kurz ans Festland. Sie bildet die Polizei in Senegal und Mauretanien in der Bekämpfung von Fluchtversuchen und Schlepperringen aus. Kleinfischer berichten, dass die Agentur – ohne rechtliche Grundlage – auch an afrikanischen Küstenabschnitten aktiv ist und Fischerboote zerstört, wenn sie annimmt, dass diese zur Flucht verwendet werden sollen. Die Familien der Kleinfischer sind verzweifelt. Eine ältere Fischerfrau aus Kayar/Senegal brachte es gegenüber einer Delegation des Evangelischen Entwicklungsdienstes im September 2008 auf den Punkt: „Erst raubt ihr unseren Fisch, dann schickt ihr unsere Kinder zurück, für die wir alle zusammengelegt haben, damit sie bei euch arbeiten und uns unterstützen. Wovon sollen wir nun leben?“
Dao Gaye, der Vorsitzende des senegalesischen Fischereiverbandes, kritisiert: „Ihr habt Geld, eine Armada gegen Piraten in Ostafrika loszuschicken, und Milliarden, um Euch unsere Jugendlichen vom Hals zu schaffen. Wenn wir Euch aber bitten, effektiv gegen Eure eigenen Fischpiraten in unseren Gewässern vorzugehen, dann entdeckt Ihr auf einmal unsere Souveränität, schenkt unserer Marine zwei abgewrackte Schnellboote, mit denen wir uns selber um Eure Kriminellen kümmern sollen. Das ist blanker Zynismus und es gibt nicht wenige, die hinüber nach Nigeria schauen, wie dort auch ehemalige Fischer am Nigerdelta sich durch Lösegelder Entschädigung dafür holen, was die Ölverschmutzung vor ihren Gewässern und in ihren Dörfern angerichtet haben.“
… oder in den Drogenhandel
Dass sie auch ganz schnell und anders als mit sicherheitstechnischen und militärischen Mitteln handeln kann, demonstrierte die EU in Guinea Bissau. Dort sieht das Fischereiabkommen vor, dass 30% der Mittel genutzt werden, um die Kleinfischer zu unterstützen. Die EU-Delegation vor Ort überwacht die Regierung, damit das Geld wirklich dort ankommt. Sie fordert die Kleinfischerverbände und Vertreter der Zivilgesellschaft an den Tisch. Warum das Alles? Nun, die Kleinfischer haben angefangen, die kolumbianische Drogenmafia dabei zu unterstützen, ihre mit Flugzeugen und Booten angelandeten Drogen von den vielen Inseln an Land zu bringen, von wo aus sie auf den Weg nach Europa gebracht werden. Der Streit in der Armee um die Verteilung dieser Gewinne aus dem Drogengeschäft soll auch der Hintergrund für den Putsch und die Ermordung von Präsident Viera im Februar 2009 sein. Nicht wenige Kleinfischer an Afrikas Küsten hoffen auf kolumbianische Emissäre. In Guinea/Conakry, wo vor wenigen Wochen ebenfalls geputscht wurde und die EU ein Fischereiabkommen wegen nicht mehr ausreichender Fischgründe hinauszögert, konnten sich die ausländischen Gäste eines Kongresses der westafrikanischen Kleinfischerverbände persönlich am Flughafen überzeugen, dass die südamerikanischen Gesandten schon auf dem Weg in das Land sind.
… oder in die Piraterie
Vor Somalia wurden die Fischbestände in einem solchen Ausmaß überfischt, dass die Lebensgrundlagen der somalischen Fischer vernichtet wurden. Die UN schätzen den jährlichen Marktwert des Fischfangs, der in somalischen Hoheitsgewässern kostenlos abgefischt wird, auf ca. 300 Millionen US-Dollar. Diesem gesellschaftlichen Verlust an Einnahmen standen in 2008 ca. 120 Millionen US-Dollar Einnahmen in Form von Lösegeldern für gekaperte Schiffe gegenüber. Clive Schofield vom Australian National Centre for Ocean Resources and Security und Autor einer Studie über die Plünderung der somalischen Fischbestände hat ausgerechnet, dass die fremden Fangflotten erheblich mehr Protein aus Somalias Gewässern entnommen haben als die Welt den Menschen in Somalia in Form von humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt hat. Es sei schon „ausgesprochen ironisch“, so Schofield in der ZEIT am 27.11.08, „dass viele der Nationen, deren Kriegsschiffe derzeit am Horn von Afrika patrouillieren oder auf dem Weg dorthin sind, unmittelbar mit den Fischereiflotten verbunden sind, die geschäftig Somalias Meeresschätze plündern“.3
Die ökologischen Folgen der Überfischung durch Trawlerflotten sind ebenso katastrophal wie die wirtschaftlichen und sozialen. Der Thunfischbestand wird unwiederbringlich zerstört, da die Laichzeiten vor Somalias Küsten selbstredend nicht respektiert werden. Die Tsunami Katastrophe 2005 brachte eine weitere Folge der Rechtlosigkeit in somalischen Gewässern buchstäblich aus den Tiefen hervor. Seit den 1990er Jahren, als das Regime Siad Barrés in Somalia kollabierte, haben wohl vor allem italienische Schiffe Chemieabfälle und auch zumindest schwach radioaktiven Müll vor Somalias Küste verklappt. Der Tsunami spülte Hunderte von Fässern an die Küste. Der nun so aufgeregten Weltpresse waren die damaligen Warnungen der Weltgesundheitsorganisation vor einer Gesundheitskatastrophe mit bisher mindestens dreihundert nachweislich an den Vergiftungen gestorbenen KüstenbewohnerInnen nur wenige Zeilen Wert. Schlimmer noch, auch die EU weigert sich, die nachweislich aus Europa stammenden toxischen Abfälle zu untersuchen und auf eigene Kosten fachgerecht zu entsorgen. Inwieweit die restlichen Fischbestände betroffen sind, wurde bisher nicht untersucht.
Wie überall führen nun auch die somalischen Kleinfischer direkt vor ihren Küsten einen aussichtslosen Kampf gegen ausländische Fischerboote in den für sie reservierten 6 bis 12 Meilen Zonen. Die Trawler finden nämlich nun nicht mehr genügend Fang außerhalb dieser Zonen und rauben mit besonders brutalen Methoden, wie dem Grundfischen, die letzten Fischgründe aus. Mit dem Eindringen der ausländischen Fischtrawler in die küstennahen Gewässer hat auch in Somalia der Kampf um das Überleben der Küstenfischer und der Kampf zum Schutz der eigenen Küste begonnen, den wir nun Piraterie nennen. Vorher aber hat die internationale Staatengemeinschaft nichts gegen die rechtswidrigen Fischfangmethoden der Trawlerflotten unternommen, die die Lebensgrundlage der Küstenfischer zerstörten. Im Gegenteil: durch EU-Subventionen in der Fischerei wurde es sogar noch gefördert, dass die Eigentümer der Trawler ihre riesigen Überkapazitäten durch die Weltmeere ziehen und wo immer möglich die Schiffsbäuche für den rasant ansteigen Fischkonsum in Europa füllen ließen.
Die somalischen Küstenfischer, die sich in Gruppen wie der »Küstenwache« organisierten, wollten wenigsten einen Teil der Gewinne aus dem gestohlenen Fisch in die Fischerdörfer lenken – durch das Kapern und »Besteuern« der Trawler. Der Erfolg ihrer Aktionen lockte finanzstarke Warlords im regierungslosen Somalia an. Deren Milizen sind es, die die schweren Waffen besorgten, deren Hintermänner sind es, die die internationalen Finanztransfers regeln. Neue maritime und militärische Technologie (Schnellboote und moderne Waffensysteme) gekoppelt mit den nautischen Kenntnissen der Fischer ermöglichten es, immer weiter in den Golf von Aden einzudringen und Erlöse zu erzielen, von denen die Kleinfischer für ihre früheren Fangaktivitäten nur träumen konnten.
Es kam der EU, der NATO und auch den neuen maritimen Weltmächten, der VR China und Indien, nie in den Sinn, ihre eigenen »Fischpiraten« vor der somalischen Küste zu bekämpfen. Im Gegenteil, ihre Häfen – etwa in Europa Las Palmas (Kanarische Inseln) – dienen als Geldwaschanlagen dieser räuberischen Fischerei. Jetzt patrouillieren alle gemeinsam auf der Jagd nach den Piraten und sichern, wie Berichte der französischen Marine zeigen, genau diese illegale Fischereipraxis militärisch ab. Denn die Fischpiraten werden zwar, wie schon von der im Rahmen von »Enduring Freedom« durchgeführten Marineoperation am Horn von Afrika gegen den internationalen Terrorismus, gelegentlich angehalten, wenn Verdacht besteht, sie könnten Waffen an Bord haben. Haben sie nur geraubten Fisch an Bord, lässt man die Schiffe unbehelligt weiter ziehen. Die gleiche Verhaltensregel gilt nun auch für die NATO-Aktion »Atalanta«.
Europäische Fischpiraten werden vor somalischen Kriminellen geschützt. Es ist kaum zu erwarten, dass die EU/NATO dafür an der Küste viel Verständnis findet. Wie unzählige Male schon seit dem Sturz der Regierung vor 18 Jahren werden den Menschen an den Küsten zwar entwicklungspolitische Programme für einen Ausstieg aus der Piraterie angeboten. Doch rasches Handeln sehen sie nur dann, wenn es um den Schutz der Interessen der Industrieländer geht.
Sicherheitsdiensten im Luxus leben“. Seit Jahren kämpfen sowohl zivilgesellschaftliche als auch staatliche Akteure gegen Korruption und Machtmissbrauch und haben in letzter Zeit einige Erfolge verbuchen können. So wurden mehrere Gouverneure von Bundesstaaten im letzten Jahr ihres Amtes enthoben, nachdem Gerichte ihnen Wahlbetrug nachgewiesen hatten. Trotzdem prangert Amaechi die Ungerechtigkeit an, die der Ölreichtum des Landes den Menschen in Nigeria gebracht hat: „Seit das Wettrennen auf das nigerianische Öl in den 1950er Jahren begonnen hat“, so Amaechi, „wurden Hunderte Millionen Dollar verschwendet, durch Misswirtschaft vergeudet, wurde der Reichtum des Landes von korrupten Behörden und Politikern ausgeplündert. Während diese korrupten Eliten das Leben in ihren teuren Villen in vollen Zügen genießen, leben die Menschen in den Dörfern wie Ogboinbiro, einem Fischerdorf in Nigerias südwestlicher Ecke, in Lehmhütten unter steinzeitlichen Bedingungen“.Erst kämpften Rebellengruppen wie die MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) für eine Beteiligung der Bevölkerung an den Gewinnen aus dem Ölgeschäft und entführten dafür Mitarbeiter ausländischer Ölgesellschaften. Danach verlegte man sich auf das Ausrauben von Schiffen, die Nachschub für die Ölindustrie bringen. Mit moderner Bewaffnung – aus den Rauberlösen finanziert – werden heute gleich ganze Schiffe gekapert und Lösegelder erpresst. In den schwierigen Gewässern am Nigerdelta und den undurchsichtigen Mangrovenwäldern sind natürlich die Kenntnisse der Kleinfischer gefragt. Es darf aber bezweifelt werden, dass die Bevölkerung aus den Einnahmen dieses modernen Geschäftsbereichs einen Nutzen hat.
Die Ölgesellschaften reagieren mit der Aufrüstung der Sicherheitskräfte auf ihren Schiffen und Ölplattformen und machen es den geschäftsmäßig agierenden Piraten immer schwieriger. Diese gehen jetzt dazu über, nigerianische Fischkutter zu kapern. Deren Ausrüstung und Bargeld wird geraubt oder gar ganze Boote entführt. Das hatte bereits in Lagos einen Mangel an Frischfisch zur Folge, den die Regierung durch Importe auszugleichen versucht. Zusätzlich rüstet nun auch die Küstenwache auf, um diese »Binnenpiraterie« zu beenden. Wer Nigeria und seine fragile innenpolitische Situation kennt, weiß um die Explosivität dieser Situation. Dass es noch nicht zu massiven Gewalteskalationen gekommen ist, liegt vor allem daran, dass die nigerianische Regierung im Nigerdelta bisher nicht sehr effektiv vorgeht. Sie hält sich offensichtlich zurück, solange die Ölexporte nicht wirklich gefährdet werden.
Anmerkungen
1) http://www.stern.de/panorama/:Piraten-Somalia-Frueher-Fischer/647843.html
2) http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7623329.stm
3) Andrea Böhm und Heinrich Wefing: Wer ist hier der Pirat? in DIE ZEIT, 27.11.2008 Nr. 49 http://www.zeit.de/2008/49/Piraten (eingesehen am 29.12.2008).
Francisco Mari ist Experte für Landwirtschaft, Agrarexport und Fischerei. Er unterstützt Kleinbauern und Kleinfischer in Westafrika, sich zum Schutz ihrer Lebensgrundlagen und Durchsetzung ihrer Interessen zu organisieren. Er ist Mitarbeiter des Referats Entwicklungspolitik des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED). Dr. Wolfgang Heinrich verfolgt seit über 25 Jahren die politischen Entwicklungen am Horn von Afrika. Er ist im Referat Entwicklungspolitik des EED zuständig für Fragen der zivilen Konfliktbearbeitung und entwicklungspolitischen Friedensarbeit.