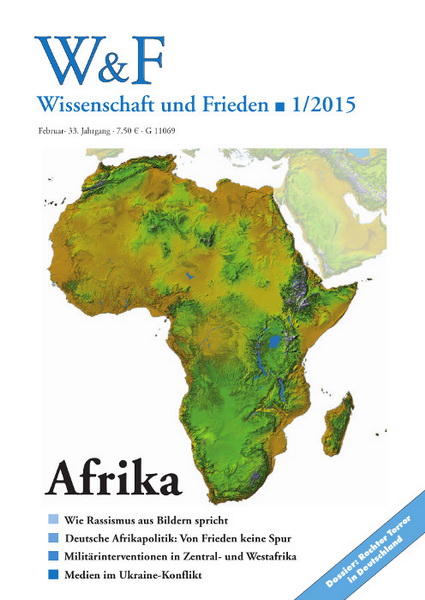Wie Rassismus aus Bildern spricht
von Susan Arndt
„Wir waren entsetzt über das Afrikabild, das in den Illustrationen/Karikaturen der Ausgabe 1-2014 von »Wissenschaft und Frieden« vermittelt wird“, schrieben Christoph Butenschön und Ulrich Wagner der Redaktion in einem Leserbrief. „Die folgenden Klischees sind zu sehen: Schwarze sind durchgängig halbnackt (S.17 und 23) oder barfuß (S.9 und 31), sind in Mangelsituationen (Bildung S.9, Hunger S.17, Durst S.31 und Belastung S.23), sind passiv oder unmündig.“ Seit den 1980er Jahren sehen sich deutsche Medien mit solcher Kritik konfrontiert; wissenschaftliche Studien dieser rassistischen Repräsentationen von Afrika, die oft euphemistisch »Afrikabilder« genannt werden, gibt es zuhauf. Dennoch halten Medien, auch linke und oft karikaturistisch, an der verstörenden (Bilder-) Sprache des Rassismus fest. Die Zeitschrift »Wissenschaft und Frieden« wollte die an sie gerichtete Kritik nicht verschweigen, druckte den Leserbrief in Heft 2-2014 ab und lud zu dem nachfolgenden Artikel 1 ein, der die oben beschriebenen Repräsentationen historisch einbettet, im Rassismus verortet und fragt: Rassismus generiert rassistische (Sprach-) Bilder, die ihn nähren – warum erweisen sie sich als so kritikresistent?
Kein anderes System der Unterdrückung einer Kultur durch eine andere hat strukturell wie diskursiv eine dermaßen tiefgreifende, nachhaltige und global weitreichende Agenda erschaffen wie der Rassismus. Rassismus ist eine in Europa historisch gewachsene Ideologie und Machtstruktur, die die Kategorie »Rasse« aus dem Tier- und Pflanzenreich auf Menschen übertrug. Aus einer willkürlichen Auswahl bestimmter körperlicher Kategorien wurden Bündel geschnürt, diesen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben und die auf diese Weise hergestellten Unterschiede verallgemeinert und hierarchisiert. Diese »Rassen«-Klassifikation von Menschen folgte dem europäischen Streben, koloniale Verbrechen an Millionen von Menschen zu rechtfertigen. Sie wurden als nicht-weiß und damit als unterlegen – dem Weißsein und zugleich auch dem Menschsein unterlegen – positioniert. Weiße machten sich mittels des Rassismus die Welt passförmig, um sie zu beherrschen. Rassismus ist daher »white supremacy«, eine weiße Herrschaftsform.
Unsichtbar herrschen
„Rassen gibt es nicht“, schreibt die feministische Soziologin Collette Guillaumin, „und doch töten sie“.2 Der Glaube, dass es »Rassen« gebe, der Rassismus also, ist bis heute präsent. Shankar Raman hält es für notwendig, einen Kampf um die Bedeutung von »Rasse« zu führen, um sich diesen Begriff aus antirassistischer Sicht anzueignen. Deswegen schlägt der deutsche Literaturwissenschaftler eine doppelte Denkbewegung vor: weg von »Rasse« als biologischem Konstrukt hin zu Rasse als sozialer Position. Raman bezeichnet diese Denkbewegung als „racial turn“. Sie schließt ein, Rasse als kritische Wissenskategorie zu etablieren.3
Für mich beinhaltet der »racial turn« zudem einen gewichtigen Perspektivenwechsel in der Rassismusforschung. Ihm hat Toni Morrison 1992 mit ihrem Buch »Playing in the Dark«4 Gehör verschafft. Die afroamerikanische Literaturnobelpreisträgerin weist darauf hin, dass Rassismus-Analysen im weißen akademischen Mainstream die Tendenz haben, allein über Schwarze und People of Color zu sprechen. Dabei entstehe schnell der Eindruck, Rassismus sei allein eine Angelegenheit von Schwarzen – Weiße seien diesbezüglich »neutral«, so als hätten sie damit nichts zu tun. Sich nicht im System des Rassismus verorten zu müssen, sei jedoch ein Privileg, das der Rassismus nur Weißen gebe – eine Option, die People of Color nicht leben können. Wenn Weißsein ignoriert oder für das eigene Leben als nicht relevant eingestuft wird, werden zugleich auch die sozialen Positionen, Privilegien, Hegemonien und Rhetoriken verleugnet, die daran gebunden sind. Weißsein behält dadurch seinen Status als universaler, „unmarkierter Markierer“5 und „unsichtbar herrschende Normalität“6 bei.
»Weißsein« als kritische Wissenskategorie
Vor diesem Hintergrund ist das Ignorieren von »Hautfarben«, so paradox das klingen mag, also keine Lösung. Der Rassismus kategorisiert, markiert und positioniert – unter anderem mit Hilfe von »Hautfarben« – Menschen als Diskriminierte, Fremdmarkierte und Entmachtete oder eben als Diskriminierende, Markierende und Privilegierte des Rassismus. Das passiert zumeist unabhängig vom individuellen Wollen und losgelöst davon, ob jemand Rassismus befürwortet oder ablehnt.
Es geht hierbei nicht um Schuldzuschreibungen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, dass Rassismus (analog zum Patriarchat in Bezug auf Geschlechterkonzeptionen) ein komplexes Netzwerk an Strukturen und Wissen hervorgebracht hat, das uns – im globalen Maßstab – sozialisiert und prägt. Dabei ist Wissen in meiner Lesart weder absolut noch wahr und unveränderbar, sondern historisch gewachsen, von Macht geformt sowie dynamisch und subjektiv.
Das Gewordensein, das gegenwärtige Wissen und das künftige Wirken von Weißsein als soziale Position im Rassismus stehen im Zentrum der Kritischen Weißseinsforschung. Weißsein wird hier, und zwar innerhalb von Rasse als Analysekategorie und komplementär zu Schwarzsein, zur kritischen Wissenskategorie. Sie findet Anwendung in der Analyse gesellschaftlicher und politischer Prozesse sowie deren sprachlicher, fiktionaler wie medialer Repräsentation. Im Kern geht es um die Frage: Wie haben Weißsein im Besonderen und Rassismus im Allgemeinen der europäischen Versklavung afrikanischer Menschen und dem Kolonialismus als ideologisches Schwert und Schild gedient? Wie haben Rassismus und sein Kerntheorem Weißsein im Kolonialismus und darüber hinaus die Welt geprägt – diskursiv und strukturell, in Vergangenheit, Gegenwart und für die Zukunft? Wie können diese Diskurse und Strukturen benannt, herausgefordert und gewendet werden?
Einige dieser Fragen möchte ich im Folgenden an ausgewählten historischen Fallbeispielen diskutieren und dadurch exemplarisch das Gewordensein der Kategorie »Rasse« aufzeigen.
Antike Bilder von versklavten Menschen
Als im ausgehenden 16. Jahrhundert das Konzept der »Rassen« aus dem Tier- und Pflanzenreich auf Menschen übertragen wurde, geschah dies in Rückgriff auf Theoreme, die bereits in der Antike ihren Anfang nahmen. Um Abgrenzungsprozesse zu legitimieren, und im Kontext von Eroberungskriegen und Sklaverei, kam es im vierten und fünften Jahrhundert vor Christus zur Konstruktion einer kulturellen Differenz zwischen »Griechen« und »Nicht-Griechen«, von ersteren zumeist als »Barbaren« bezeichnet. Um Kulturen geopolitisch zu verorten und zu hierarchisieren, spielten Klima-Theorien7 eine entscheidende Rolle.
Es ist dieses Paradigma, das die erste bekannte Theorie der Sklaverei rahmte, entwickelt im vierten Jh. v.Chr. von Aristoteles in seinem Werk »Politeia«. Aristoteles war als Lehrer und Politikberater Alexanders des Großen bestrebt, dessen Eroberungszüge sowie die griechische Ausgrenzungspraxis gegenüber den »Anderen« philosophisch zu untermauern. So argumentiert er etwa, dass Sklaverei naturgegeben und gerecht sei und Griech*innen dazu auserwählt seien, Nicht-Griech*innen zu versklaven. Zwar war »Hautfarbe« in diesem Zusammenhang nicht der primäre Marker von Differenz, doch schieden sich »Freie« und »Barbaren« eben auch an dieser Grenzziehung.
Das in der griechischen Antike akkumulierte Wissen – dass körperliche Unterschiede soziale, mentale und religiöse transportieren und Herrschaft und Sklaverei legitimieren –, stellte die theoretische Basis bereit, um in den nachfolgenden Jahrhunderten die Idee von »Rasse« zu formen und zum Instrumentarium der Klassifizierung von Menschen zu machen.
Koloniale Farbsymbolik
Mit dem Erstarken des Christentums erhielten die antiken Vorstellungen neue Bedeutung und Gewichtigkeit. Dabei kam es zwischen der christlichen Farbsymbolik und Theoremen von »Hautfarbe« zu komplexen Synergieeffekten. In der christlichen Religion gilt Weiß als Farbe des Göttlichen, des Himmlischen und seiner Transparenz, von Unschuld und Jungfräulichkeit. Schwarz verkörpert dagegen das Monströse des Teufels und die Untiefen der Hölle – und damit Sünde und Schande, Ungehorsam und Schuld. Analog dazu wird Weiß auch allgemein als schön, rein und tugendsam konzipiert, Schwarz als Farbe des Hässlichen, Bösen und Unheils.
Bereits im 15. und 16. Jahrhundert, als die europäische Versklavung und Verschleppung von Afrikaner*innen irreversibel strukturelle Gestalt und Gewalt annahm, war diese Farbsymbolik gängig (denken wir etwa nur an Michelangelo, da Vinci oder Raphael). Parallel zur Ästhetik zeitgenössischer Malerei formierte sich auch in Poesie und Dramatik ein literarischer Hype um diese Farbsymbolik und ihre Kolonialrhetorik. Besonders interessant ist dabei, dass Weißsein prominent auch über Seide, Perlen, Elfenbein, Silber, Diamanten und Marmor als kostbar inszeniert wird. Es werden also figurativ ausgerechnet jene Ressourcen aufgerufen, die die kolonialen Ambitionen Englands und ihre Legitimationsphilosophie um das Weißsein wesentlich motivierten.
Auf diese Weise ideologisch gerüstet, blühte die Sklaverei im 17. Jahrhundert auf und trug im 18. Jahrhundert volle Früchte. Sie ermöglichte die Industrielle Revolution und Europas Moderne, die im europäischen Wettlauf münden sollte, die Welt zu kolonisieren.
Vermessung des Körpers
Als immer mehr Zweifel an den seit der Antike gültigen Klima-Theorien und an »Hautfarbe« als überzeugendem Träger von »Rassentheorien« aufkamen, nahmen weiße Wissenschaftler*innen des 18. Jahrhunderts zunehmend andere angebliche Merkmale in den Blick. Dazu vermaßen sie zunächst Körperteile wie etwa den Schädel oder das Skelett, aber auch Sexualorgane. Noch heute lagern Relikte dieser biologistischen Forschung in ethnologischen Museen und Krankenhäusern in Europa.
Das hysterische Bemühen, »Rassen« als Fakt und die Überlegenheit der Weißen wissenschaftlich zu postulieren, fand in der Aufklärung einen Höhepunkt und prägte das Weltbild von Philosophen wie David Hume, Voltaire und Immanuel Kant. Die »Rassentheoretiker« drangen, dem allgemeinen Wissenschaftstrend ihrer Zeit folgend, nun immer tiefer in den Körper hinein: Bald dominierten auch »innere Merkmale«, wie Blut und Gene, die Theorien. Mit der Hinwendung zur Vererbung innerer Dispositionen kam es zu einem Anstieg identifizierbarer »Rassen« auf mehr als hundert. Diese stetig wachsende Anzahl vermeintlicher »Rassen« zeigt letztlich nur eines deutlich: Eindeutige Grenzziehungen lassen sich weder ermitteln noch begründen.
Ideologieprodukt »Arier«
Im 19. Jahrhundert propagierte der Sozialdarwinismus in einer Aneignung des Darwin’schen „survival of the fittest“, dass es legitim sei, jene auszurotten, die sich historisch als unterlegen erwiesen hätten. Die Eugenik und andere Theorien, auf die sich später der Nationalsozialismus stützte, nahmen in dieser Zeit ihren Anfang. Dazu gehören auch Arthur de Gobineaus apokalyptische Überlegungen, dass sich „höhere“ gegen „niedere Rassen“ zur Wehr setzen müssten und „die weiße Rasse“ unwiederbringlich durch andere „Rassen“ verdorben worden sei. Das einzige verbliebene Potenzial sah er in der „arischen Rasse“, einem reinen Ideologieprodukt, das Gobineau in England und Norddeutschland verortete.8
Nirgendwo erfuhren Gobineaus Buch und sein »Arier-Mythos« ab Ende des 19. Jahrhunderts eine solch starke Rezeption wie in Deutschland. Doch niemand hat ebendort den rassistischen »Arier-Mythos« als Chauvinismus- und Unterdrückungsideologie so wirkungsmächtig verbreitet wie der britisch-deutsche Schriftsteller Houston Stewart Chamberlain. Das Hauptziel seines 1899 erschienenen Pamphlets »Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts« war es, den »Ariern« ihren Platz in der Gegenwart und Zukunft zu verschaffen, den sie seiner Meinung nach als „Herrenrasse“ verdienten.9
Historische Kontinuitäten
Parallel zu dieser Radikalisierung des Rassismus trat auch der Kolonialismus in seine imperiale Phase über. Die europäische Gier nach Gütern, wie Elfenbein, Gummi, Diamanten und Gold, aber auch nach neuem Territorium, unterwarf Millionen von Menschen in Afrika, Australien sowie Teilen Asiens der Ausbeutung, der Folter und dem Genozid. Vom Rassismus flankiert wurden diese Gräueltaten als Recht und Pflicht zur Zivilisation verkauft. Abgepuffert durch die rassistische Rhetorik blieben koloniale Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa vergleichsweise unbeachtet. Der Rassismus wütete weiter, nicht nur in den Kolonien. In Deutschland mündete er in genozidaler Singularität in die Ermordung von Millionen von Juden und Jüdinnen sowie Hunderttausenden von Sinti und Roma.
Als die alliierten Armeen das NS-Regime besiegten, kämpften in ihnen Hunderttausende von Schwarzen Menschen. Die Siegermächte verweigerten ihnen dafür nicht nur die gebührende Anerkennung, sondern zeitgleich wurde in den Kolonien und über den Nationalsozialismus hinaus diktatorisch weitergeherrscht. Der karibische Schriftsteller und Politiker Aimé Césaire klagte nicht zuletzt deswegen bereits in den 1950er Jahren eine Erinnerungsarbeit ein, die die Kontinuität von Kolonialismus und Nationalsozialismus reflektiert.10 Das steht in der öffentlichen Erinnerungsarbeit bis heute aus.
Ganz Europa, insbesondere Deutschland, versank im Angesicht der Shoah in Angst und Scham. Wer es vermeiden konnte, sprach nicht über Rassismus. Doch auch jene Länder, die den Nationalsozialismus zerschlagen hatten, waren davon nicht ausgenommen, wie etwa die »Jim Crow«-Gesetzgebung11 in den USA oder das Fortbestehen von britischem und französischem Kolonialismus zeigen.
Rassismus verleugnen und Bildersprache
Das Nicht-Wahrnehmen von Rassismus stellt einen aktiven Prozess des Verleugnens dar, der durch das weiße Privileg, sich mit Rassismus nicht auseinandersetzen zu müssen, gleichermaßen ermöglicht wie abgesichert wird. Wo aber Rassismus verleugnet wird, bleibt sein Wissen im Umlauf. Gerade in der zeitgenössischen (Bilder-) Sprache finden sich dafür verstörende Belege.
Als Europa seine weiße Überlegenheit erfand, inszenierte es Schwarzsein und Afrika, als dessen symbolische Heimat, als Antithese zum weißen christlichen Europa/Westen. Die Dämonisierung des Kontinentes und seiner Bewohner*innen als Hort des Bösen sind nur die Spitze des Eisberges. In der Exotisierung steckt dieselbe Zutat: Afrika sei naturverbunden, will sagen ohne Mündigkeit, Entwicklung und Kultur (oft metonymisch visualisiert durch Mangel an Nahrung, Kleidung, Bildung), und damit bestenfalls ein Bindeglied zum (kultivierten) Menschsein. So wird Afrika in den Warteraum der Geschichte verbannt und damit über die Abwesenheit einer Zukunft definiert, die Europa verkörpert. Folgerichtig sei Europa in der Position, Afrika zu »entwickeln«. Was im Kolonialjargon »Bürde des weißen Mannes« hieß und Gewalt, Raub und Ausbeutung als »Zivilisierung« verkaufte, flüchtete sich in die zeitgenössische Erzählung der »Entwicklungshilfe«. Statt Verantwortung für den Kolonialismus zu übernehmen, der Afrika sozial und ökonomisch zerrüttete, wird alleinig der afrikanischen Kontinent verantwortlich für die verheerenden Spätfolgen des Kolonialismus gemacht, und es wird paternalistisch, ja zynisch, »Hilfe« angeboten.
Verstetigung des Rassismus
Durch solche verstetigende Wiederholungen schleichen sich Stereotype subtil in die individuelle Wahrnehmung ein und werden dann als gegeben, eindeutig und natürlich angenommen. Das erklärt die Veränderungsresistenz von Stereotypen. Nur partiell werden neue Inhalte und Grenzen ausgehandelt. Wenn Stereotype also in verschiedenen historischen Kontexten nur partielle Verschiebungen erfahren, heißt dies nicht, dass sie deswegen »natürlich« sind. Vielmehr zeigen sie, wie Glaubenssätze sich mit der Zeit mehr und mehr zu vermeintlichen »Wahrheiten« verfestigen. Deswegen befördern Bilder, die nackte, ungebildete, dienende Schwarze zeigen, nicht Verantwortung, ja nicht einmal Empathie, sondern im Gegenteil Aversionen, Überlegenheitsgefühle und fehlenden Respekt vor Afrikaner/innen und anderen Schwarzen.
Es bedarf eines zivilgesellschaftlichen Engagements, wie im Falle der Bebilderung von »Wissenschaft und Frieden« 1-2014 von Christoph Butenschön und Ulrich Wagner gezeigt, um verstörenden Bildern neue Weltsichten entgegenzustellen Mit ihrem Leserbrief haben sie sich, der Zeitschrift »Wissenschaft und Frieden« und ihren Leser*innen aufgezeigt, dass es keineswegs ausreichend ist, sich als antirassistisch zu positionieren. Dem Willen, sich Rassismus zu widersetzen, müssen Handlungen folgen, die wissen, worum es geht: Wissen darüber, wie Rassismus entstanden ist, wie er wirkt und auf welche Weise er unterwandert werden kann. Zu verstehen, wie Rassismus historisch gewachsen ist, ist eine bewährte Methode, um Rassismus im Jetzt beim Namen nennen zu können und ihm eine schwere Zukunft zu bescheren.
Rassismus in die Schranken weisen
Wer Rassismus in die Schranken weisen möchte, muss zunächst lernen, was der Rassismus mit uns allen angerichtet hat. In einem zweiten Schritt wird es darum gehen, feste Glaubensgrundsätze aufzugeben (auch den, schon immer antirassistisch gewesen zu sein), bereits Gelebtes selbstkritisch zu überprüfen (auch wenn es noch so gut und antirassistisch gemeint war) und Gelerntes zu verlernen (auch wenn es noch so unschuldig aussieht). In allem, was wir wissen, steckt ein Stück rassistische Wissensgeschichte. Ob Medien, Schulbücher, Straßennamen, Lebensmittel oder Gesetze: Rassismus hat sich überall eingenistet. Dies sind aber auch die Orte, von denen aus Rassismus in Sackgassen getrieben werden kann: neue Curricula oder lernwillige Lehrer*innen, geschulte Journalist*innen oder fragende Wissenschaftler*innen, wissbegierige Politiker*innen oder Theolog*innen – es gibt keinen Ort, an dem Bilder, ob durch Sprache oder Illustrationen erzählt, nicht die Welt verändern können.
Anmerkungen
1) Der Artikel basiert auf Forschungsergebnissen, die dargestellt sind in: Susan Arndt (2012): »Die 101 wichtigsten Fragen – Rassismus«. München: C.H. Beck; sowie: Susan Arndt: LiteraturWelten – Transkulturelle Anglistik und der »Racial Turn«. Antrittsvorlesung an der Universität Bayreuth am 24. Oktober 2012; vimeo.com/66145276.
2) Colette Guillaumin (1992): Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris: Côté-femmes, S.7.
3) Shankar Raman (1995): The Racial Turn: »Race«, Postkolonialität, Literaturwissenschaft. In: Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger u.a. (Hrsg.): Einführung in die Literaturwissenschaft. Stuttgart und Weimar: J.B. Metzler, S.241-255.
4) Deutsche Ausgabe (1994): Im Dunkeln spielen: weiße Kultur und literarische Imagination. Reinbek: rororo.
5) Vgl: Ruth Frankenberg (Hrsg.) (1997): Displacing Whiteness. Essays in Social and Cultural Criticism. Durham/North Carolina: Duke University, S.1-10.
6) Ursula Wachendorfer (2001): Weiß-Sein in Deutschland. Zur Unsichtbarkeit einer herrschenden Normalität. In: Susan Arndt (Hrsg.): AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland. Münster: Unrast, S.87-101.
7) Etwa die These, das heiße Klima habe Haar und Hirn von Schwarzen Menschen ausgetrocknet und sie seien deswegen mental und kulturell unterlegen.
8) Arthur de Gobineau (1853–55): Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris: Éditions Pierre Belfond, hier Ausgabe von 1967.
9) Houston Stewart Chamberlain (1899): Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. München: Bruckmann.
10) Aimé Césaire (1955): Discours sur le colonialisme. Paris: Editions Présence Africaine. Deutsche Ausgabe (1968): Über den Kolonialismus. Berlin: Wagenbach.
11) Der US-amerikanische Komiker Thomas D. Rice erfand im Rahmen von »Blackfacing«-Shows in den 1830er Jahren die Figur des Jim Crow, eines tanzenden, singenden, wenig intelligenten Schwarzen. Als »Jim Crow Laws« werden die Gesetze bezeichnet, die in den USA von 1876 bis 1964 die Rassentrennung festschrieben.
Susan Arndt ist Anglistin und Rassismusforscherin. Sie lehrt als Professorin an der Universität Bayreuth und ist Autorin des Buches »Die 101 wichtigsten Fragen: Rassismus« (München: C.H. Beck, 2012, 2. Aufl. 2015).