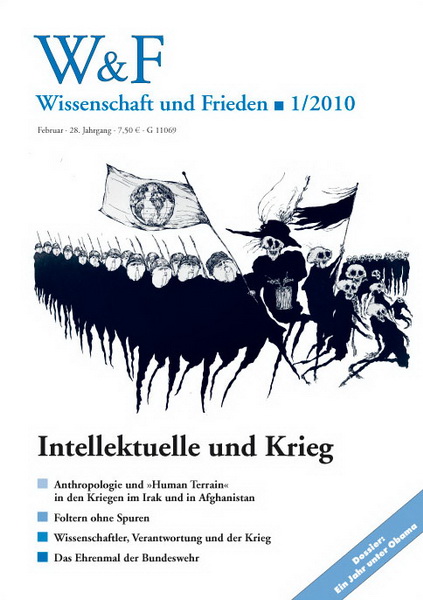Zeichen gegen den Krieg
Kritische Friedensforschung
von Ueli Mäder
Kriege sind leider aktuell und beständig. Aktuell, weil weltweit Kriege unzählige Menschen bedrohen; beständig, weil sich die Geschichte auch als eine Abfolge von Kriegen lesen lässt. Das bewog die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS) dazu, ihren internationalen Kongress vom September 2007 an der Universität Basel ausschliesslich dem Thema Krieg zu widmen. Aus diesem Kongress gehen mehrere Publikationen und weitere Aktivitäten hervor. Sie sind ein kleines intellektuelles Zeichen gegen den Krieg und werfen die Frage nach weiteren Perspektiven auf.
Kriege haben viele Facetten, nationalistische, ideologische, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle, ökologische. Kriege haben auch etwas mit der Knappheit und der Privatisierung wichtiger Ressourcen zu tun. Sie entzünden sich beispielsweise im Kampf um das Öl oder um das Wasser. Zu den vielfältigen Ursachen (und Folgen) von Kriegen gehören auch zahlreiche weitere Aspekte. Sie reichen von der forcierten Migration bis zur heroisierten Männlichkeit. Kriege sind komplex und lassen sich auf kein simples Machtkalkül reduzieren. Sie sind, in der soziologischen Tradition von Marcel Mauss formuliert, ein totales soziales Phänomen. Und so einigte sich der SGS-Vorstand anno 2006 darauf, den Krieg aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Der Entscheid fiel trotz der Einschätzung, dass das Thema weniger Interessierte ansprechen dürfte als etwa die Identität in der Postmoderne. Kriege seien zwar brisant, lautete ein Einwand, aber für die Wissenschaft nicht so relevant. Vierhundert Intellektuelle kamen dann gleichwohl an die Universität Basel. Das Programm bestand aus hundert Vorträgen und zahlreichen Workshops. Dabei interessierten vor allem drei Fragekomplexe. Erstens, welche Konfliktherde und Kriegsursachen am Anfang des 21. Jahrhunderts im Vordergrund stehen. Zweitens, welche (vielleicht ähnlichen) Erklärungsmuster sich bei der Vielzahl neuer Kriege (Bürger- und Umweltkriege, Staatszerfall, Terror) feststellen lassen. Und drittens, wie die Sicherheitspolitik auf die veränderten Problemlagen reagiert bzw. reagieren könnte. Die inhaltliche Palette war also relativ breit. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf vier Gesichtspunkte, die auch für die Frage bedeutend sind, wie sich Intellektuelle zum Krieg verhalten (könnten). Es geht dabei erstens um die sozialwissenschaftliche Tradition der Kriegsforschung, zweitens um ideologische Annahmen, drittens um mediale Diskurse und viertens um weiter führende Perspektiven der Konfliktforschung.
Tradition der Kriegsforschung
Wenn Du Frieden willst, so rüste zum Krieg. Mit diesen provokativen Worten eröffnete Christoph Maeder, der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS), den Kongress. Der bekannte Ausspruch schien sich zumindest während des Kalten Krieges zu bewahrheiten. Aufrüstung und Drohgebärden kennzeichneten das Verhalten der zivilisierten Blöcke. Kriege hinterließen aber auch in dieser Zeit viel Verheerung, Elend und Tote. Die blutige Spur führte von Vietnam und den schwelenden Konflikten in Südamerika über die Bürgerkriege in Nordirland und im Baskenland bis zu den militärisch geführten Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Ethnisch begründete Vertreibungen und Hegemonieansprüche im Balkan reaktivierten den Krieg ebenfalls in Europa. Die traurigen Ereignisse trübten die Gewissheit von einer friedlichen Welt. Und mit dem weltweiten Terrorismus kam ein neuer Feind auf. Er ersetzte der medial omnipräsenten Militärmaschinerie die ideologischen Gegensätze des Kalten Krieges, nach dessen Ende sich die Rüstungsausgaben nur vorübergehend senkten. Heute sind sie höher denn je. Und der Krieg gegen den Terrorismus hat mehr Tote zur Folge, als der Terrorismus selbst. Somit erweisen sich grosse Hoffnungen auf das staatliche Gewaltmonopol und internationale Vereinbarungen als trügerisch. Realistisch scheint hingegen die Vorstellung zu sein, mit Aufrüstung und präventiven Verteidigungskriegen den Frieden sichern zu können. Diese Illusion zeugt wohl von einer verkehrten Welt. Sie ist aber verbreitet und fordert die Friedensbewegung heraus. Ebenso alle Intellektuellen, die nicht nur schön reden und schreiben wollen, sondern auch willens sind, die aktuellen Geschehen kritisch zu analysieren und zu hinterfragen.
Der Krieg gilt laut Kurt Imhof, dem Vizepräsidenten der SGS, als Vater der Sozialwissenschaften. Thomas Hobbes fragte bereits, was eine friedliche soziale Ordnung angesichts egoistisch handelnder Naturrechtssubjekte religiös erweckter Glaubenskämpfer möglich macht. Diese Grundfragen der Sozialwissenschaften beschäftigten ihn aufgrund der Grausamkeiten religiöser Bürgerkriege. Die Kriegstreibenden wollten das Beste und brachten das Schlimmste hervor. Der Mensch erwies sich als Wolf. Hobbes postulierte deshalb den Leviathan als Herrscher und legitimierte so den Absolutismus. Die religiösen Überzeugungen verwies er auf das private Gewissen. Seine Auffassungen sind auch heute aktuell. Auch der Kampf um Werte hat wieder Auftrieb erhalten. Der Bürgerkrieg ist zurückgekehrt, obwohl man ihn schon für Geschichte hielt. Und mit dem Bürgerkrieg zieht der alte Leviathan neu legitimiert in die Moderne: Die friedenserzwingenden Interventionen von westlichen Zentrumsländern dokumentieren und reproduzieren ihn. Sie bekämpfen die so genannte »Achse des Bösen« und befördern den Krieg in Somalia, Afghanistan, im Irak und im Nahen Osten. Der Krieg gegen den Terrorismus ist weltweit präsent. Er bestimmt die Sicherheitspolitik der Nationalstaaten und unterläuft wichtige Grundlagen der Moderne. Fragen des Glaubens und Sinnentwürfe gelten als Privatangelegenheiten. Sie sind aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. Krieg beginnt nach dieser Überzeugung, wenn gemeinschaftlich verbundene Individuen die Gesellschaft in ihrem Sinne umgestalten wollen. Das führt zu ethnischer Säuberung, zu Vertreibung und auch zum Genozid. Der Mechanismus ist am Anfang des 21. Jahrhunderts so modern wie zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Es gilt, ihn weiter zu analysieren und sich dem Krieg und der dunklen Seite der sozialen Ordnung zu stellen. Dazu gehört auch, was Intellektuelle besonders interessieren sollte, nämlich die kritische Auseinandersetzung mit verfänglichen ideologischen Grundlagen. Konkrete Hinweise vermittelt der Diskurswandel in der Schweiz.
Totale Verteidigungsgesellschaft
Laut dem Sicherheitsbericht 2007 der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) Zürich halten heute nur noch 61% der Befragten die Schweizer Armee für sehr oder zumindest für eher notwendig. Die Armee ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wie Karl Haltiner, der Hauptautor der Studie, folgert. Die Armee steht offenbar nicht mehr im Zentrum der Gesellschaft. Aber vielleicht trügt der Schein, wie der Historiker Bernard Degen im Rahmen des Soziologiekongresses fragte. In seiner Botschaft gegen die Armee-Abschaffungsinitiative hielt der Bundesrat jedenfalls noch im Frühling 1988 fest: Das Wort, die Schweiz habe keine Armee, sie sei eine Armee, beschreibe eine Realität, die im Ausland immer wieder Bewunderung hervorrufe. In der Praxis ließen sich der autoritäre Charakter der Armee und der partizipative Charakter des politischen Systems nie klar trennen. Um die militärische Denkweise zu stärken, entstand sogar Mitte der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre die sogenannte Konzeption der Gesamtverteidigung. Sie zeigt, wie tief die Vorstellungen zur Landesverteidigung im Denken des Zweiten Weltkrieges verhaftet blieben. So motiviert und rückwärts orientiert reagierte die Gesamtverteidigung auf soziale Utopien einer besseren Gesellschaft. Karl Schmid, Professor für deutsche Literatur an der ETH schrieb schon 1960: „Wir sind im totalen Krieg, alle, auch die Neutralen. Der Umstand, dass er nur gelegentlich, an kleinen Fronten und fast verschämt, auch militärisch aufflackert, ist kein Indiz, dass Friede wäre; das jeweils rasche und gerade vom Osten her beflissene Ersticken der verräterischen Flamme hat vornehmlich den Sinn, uns in den Glauben einzulullen, es sei nicht Krieg, sondern wirklich Friede.“ Schmid zog daraus den Schluss: „Der totale Krieg verlangt ein totales militärisches Denken. Total ist es, indem es keine der aussermilitärischen Fronten auslässt, weder die wirtschaftliche noch die psychologische.“ Also galt es, dem totalen Krieg die totale Landesverteidigung entgegen zu halten.
Im Dezember 1964 liess der Bundesrat dann den abtretenden Generalstabschef Jakob Annasohn prüfen, wie sich eine wirksame Koordination aller Teile der totalen Landesverteidigung herbeiführen liesse. Annasohn argumentierte zwei Jahre später in seiner Studie, das Auftreten von Massenvernichtungsmitteln führe im totalen Krieg zum Ausweichen der Konfliktaustragung auf die politische, wirtschaftliche, psychologische, elektronische und subversive Ebene. Der totale Krieg umfasse nicht nur die Armee, sondern das ganze Land, seine ganze Wirtschaft und vor allem die Zivilbevölkerung in ihrer Gesamtheit. Die Gesamtverteidigung müsse sich daher nebst der militärischen Landesverteidigung vor allem auch auf die politische und zivile Verteidigung konzentrieren. Dazu gehörten die Aussenpolitik, der Staatsschutz, die psychologische Landesverteidigung, das Informationswesens, der Zivilschutz, die wirtschaftliche Landesverteidigung, die soziale Sicherung, der Kulturgüterschutz sowie zentrale Verwaltungsaufgaben. Als konkrete Massnahme führte Bernard Degen das Zivilverteidigungsbuch an, das Oberst Albert Bachmann und Georges Grosjean, von prominenten Professoren unterstützt, verfassten. Im Impressum des Handbuches finden sich auch renommierte Personen der Sozialdemokratie sowie die Präsidenten des Schweizerischen Schriftsteller-Verbandes und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Sämtliche Haushalte erhielten das Buch zugestellt, das darüber aufklärte, dass der Krieg bloss in der äusseren Form eines Friedenszustandes getarnt sei. Wachsam gelte es jene Intellektuelle und künstlerisch Schaffenden ins Visier zu nehmen, welche die Wehrkraft schwächen. So wurde denn auch die Personenüberwachung massiv ausgebaut. Das brachte im Jahr 1989 die Fichen-Affäre ans Licht. Dabei handelte es sich um eine prophylaktische Bespitzelung von Tausenden unbescholtener Bürgerinnen und Bürger, die im Verdacht standen, sich gesellschaftskritisch zu engagieren. Die Bundespolizei legte weit über die Hälfte der personenbezogenen Karteikarten zwischen 1966 und 1985 an. Zum Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik von 1973, der diesem Geist entsprach, gab es im Nationalrat nur fünf Gegenstimmen. Der Bericht zielte erfolgreich darauf ab, den Zivilschutz auszubauen, die Aufgaben auf Natur- und industrielle Katastrophen zu erweitern und die Frauen mehr in Verteidigungsaufgaben zu integrieren. Als Beispiel neuer Bedrohung diente auch die so genannte Überfremdung, die (in den 1960er Jahren noch von Gewerkschaften und) ab den 1970er Jahren vor allem von rechtspolitischen Kreisen angeprangert wurde.
Hitzige Debatten löste dann in den 1980er Jahren die »Initiative für eine Schweiz ohne Armee« aus. Die Provokation schien zunächst als Plebiszit für die Armee zu wirken, erhielt aber im November 1989 viel mehr Zustimmung als weithin erwartet. Nachhaltig wirkten laut Bernard Degen auch die Aufarbeitung der zwiespältigen schweizerischen Neutralitätspolitik (während des Zweiten Weltkrieges) und die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft. Die Transparenz über Zugeständnisse an das Naziregime schuf Distanz zur militärischen und politischen Elite. Im Zivilleben verdrängten zudem Werte wie individuelle Entfaltung, Autonomie und Mitbestimmung den militärischen Disziplinbegriff. Auch renommierte Ökonominnen und Ökonomen stellten den verschwenderischen Einsatz menschlicher Arbeitskraft in Armee und Zivilschutz zunehmend infrage. Forderungen nach wirtschaftlicher Effizienz und Flexibilität kontrastierten die bürokratisierte Gesamtverteidigung. So hob dann Ende 1998 der Schweizerische Bundesrat die Zentralstelle für Gesamtverteidigung auf. Die Schweiz sollte sich nun mehr der Friedensförderung widmen und sich dabei auch mit neuen Kommunikationstechnologien auseinander setzen. Diese lassen sich nämlich nicht nur für den Krieg nutzen, sondern auch für das (intellektuelle) Engagement gegen den Krieg, das in der Schweiz mit dazu beigetragen hat, die Rüstungsausgaben stark zu senken. Weiter ist nun etwa zu analysieren, wie sich militärisches Denken in neuen Formen sozialer Anpassung und Disziplinierung manifestiert. Das ist - gerade für Intellektuelle - eine überaus wichtige und interessante Herausforderung.
Medien und Krieg
Mit dem zentralen Thema Medien und Krieg setzten sich während des Schweizer Soziologiekongresses mehrere Beiträge auseinander. Als Referent wirkte auch Jörg Becker vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Marburg mit. Er publizierte mit Mira Beham (2006) zusammen eine Studie »Operation Balkan«, die sich mit der Werbung für Krieg und Tod befasst. Andreas Platthaus würdigte sie als Beleg dafür, wie Medienbeeinflussung im Krieg und gekaufte Propaganda zum Tragen kommen.1 So waren die medialen Sympathien in den Balkankriegen der 1990er Jahre im damaligen Westeuropa bald geklärt. Häufige Vergleiche der serbischen Kriegführung mit der nationalsozialistischen Judenvernichtung deuten darauf hin. Sie erhöhten die Akzeptanz des Nato-Einsatzes auf dem Balkan.
Bereits zu Beginn der Kämpfe in Bosnien-Herzegovina (1992) brachte die amerikanische Werbeagentur Ruder Finn (im Auftrag des unabhängig gewordenen Kroatien und der seinerzeit noch nicht autonomen Republik Kosova) die Fotos aus Gefangenenlagern in Bosnien in Zusammenhang mit deutschen Konzentrationslagern. „In der öffentlichen Meinung konnten wir auf einen Schlag die Serben mit den Nazis gleichsetzen“, stellte Agenturchef James Harff 1993 fest. Die emotionale Aufladung veränderte auch den Sprachgebrauch in den Medien. Zwischen 1991 bis 1993 erhielt Ruder Finn von Kroatien über 200.000 Dollar Honorar. Becker zeigt am Beispiel der westlichen Medienberichterstattung über die Balkankriege der 1990er Jahre, wie viele Medien ihre Aufgabe vernachlässigen, unabhängig zu berichten. Dazu tragen laut Becker auch zu Helden verklärte Nichtregierungsorganisationen bei, die ihre ideologischen Vorstellungen als volonté general kaschieren. Becker plädiert für eine Pflicht, politische Propagandaaufträge offen zu legen.
Beim Kongress referierte auch Johan Galtung über Medien und Krieg. Er bezeichnete die Medien als vielleicht mächtigstes Hilfsmittel, um künftige Konflikte zu lösen und Kriege zu vermeiden. Galtung postulierte einen Friedensjournalismus, der sich dem Kriegs- bzw. Gewaltjournalismus widersetzt. Medien können laut Galtung Frieden schaffen. Entscheidend ist, wie über Konflikte berichtet wird. Galtung, der auch Träger des alternativen Friedensnobelpreises ist, kritisierte gängige Kriegsberichte dafür, sich vornehmlich für glorifizierte technologische Aspekte und dafür zu interessieren, „ob die Truppen gut in Form sind und ob es Sturm gibt oder Sonnenschein“. Reportagen über den Krieg ähneln laut Galtung oft jenen über ein Fußballspiel. Die Berichte reduzieren Konflikte auf Parteien, die ihre Kräfte messen. Es geht um Sieg oder Niederlage. Hintergründe kommen zu kurz. Kriege erscheinen als natürliches Schicksal. Der Friedensjournalismus fragt indes, was den Konflikt verursacht und was hilfreich sein könnte. Der Friedensjournalismus spürt jenen nach, die sich, wie Waffenhändler, im Hintergrund aufhalten und vom Krieg profitieren. Der Friedensjournalismus kümmert sich um die Opfer des Krieges. Er zeigt, wer wie betroffen ist, und skizziert auch alternative Szenarien. Kritische Medienanalysen sind konkrete Möglichkeiten für Intellektuelle, sich gegen den Krieg und gegen das militärische Denken zu engagieren.
Kritische Friedensforschung
Ältere Ansätze der Konfliktforschung, wie sie etwa Johan Galtung oder Dieter Senghaas vertreten, betonen strukturelle Ursachen der Gewalt. Neuere Ansätze konzentrieren sich mehr darauf, Konfliktdynamiken zu dekonstruieren. Beim SGS-Kongress kritisierte der Kasseler Soziologe Werner Ruf, wie sich Teile der Friedensbewegung entpolitisieren. Sabine Fischer und Astrid Sahm (2005, S.49-73) beschreiben Veränderungen der normativen Grundlagen der Konfliktforschung. Nach ihrer Analyse tritt die Existenz normativer Grundlagen bei der jüngeren, systemtheoretisch orientierten Generation bei weitem nicht so explizit hervor wie bei der älteren Generation der Kritischen Friedensforschung. Während die ältere Generation vor allem für eine inhaltliche Ausgestaltung des Friedens eintritt, richtet die jüngere Generation ihre Aufmerksamkeit von diesem (als zu utopisch empfundenen) Ziel weg auf mehr pragmatische Aspekte der Gewalt. Sie entfernt sich dabei von einem Friedensbegriff im Sinne der Abwesenheit von (struktureller) Gewalt und von einer Verteilungsgerechtigkeit, die normativ aufgeladen sei. Zur Begründung dient oft ein radikal konstruktivistischer Ansatz, der den Relativismus stark betont. Während die Kritische Friedensforschung konkrete Wege der Veränderung aufzeigen will, tendiert der radikal konstruktivistische Ansatz dazu, diverse Akteure zu befähigen, sich aufgrund der Einsicht in die Bedingtheit der eigenen und fremden Wahrnehmungssysteme von festgefahrenen Positionen zu lösen (und damit auch kompromissfähiger zu werden).
Die Kritik der Kritischen Konfliktforschung versucht, die Begriffe zu dekonstruieren (und auch von emanzipatorischen Inhalten zu lösen). Sie interessiert sich mehr für die Dynamik der Konflikte, denn für die Ursachenforschung. Strömungen der neuen Konfliktforschung wollen möglichst politisch abstinent sein und sich Werten enthalten. Sie fokussieren die personale und situative Gewalt. Damit erhöht sich die Gefahr, dass herrschaftliche Strukturen und auch das soziale Engagement aus dem Blick geraten, das laut Pierre Bourdieu (1997, S.779-823) kein Widerspruch zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur Reflexivität zu sein braucht. Das Besondere eines Standpunktes besteht darin, ein Standpunkt in Bezug auf einen andern Standpunkt zu sein. Er erlaubt den Forschenden, den eigenen sozialen und intellektuellen Standpunkt im Forschungsfeld kritisch zu überprüfen. Ein sozial-reflexiver Konstruktivismus berücksichtigt diese Prägung, ohne sich damit radikal-konstruktivistisch von einer Praxis zu verabschieden, die permanent zu verändern ist.
Der SGS-Kongress zum Thema Krieg versuchte, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. Etliche Teilnehmende bezeichneten dieses Vorhaben, das eigentlich selbstverständlich sein müsste, als mutig. Einzelne Beiträge erschienen als Buch (Maeder 2009) und als Sonderausgabe der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (Bergman 2009). Das Institut für Soziologie der Universität Basel initiierte in Kooperation mit dem Departement Gesellschaftswissenschaften und Philosophie ferner ein Zentrum für Konfliktanalysen. Lehrangebote sind bereits im Bachelor- und Masterprogramm integriert. Zudem bietet das Institut für Soziologie seit 2007 ein Nachdiplomstudium in Konfliktanalysen und Konfliktbewältigung an. Der vierte Jahreskurs fängt im April 2010 an. Im Jahr 2010 beginnen an der Universität Basel zudem ein Weiterbildungsmaster der Peace Academy und ein Transcend-Seminar.2 Das sind kleine Zeichen gegen den Krieg. Weitere müssen folgen. Aber von wem? „Bleiben also noch die Intellektuellen, deren Schweigen allgemein beklagt wird, obwohl manche von ihnen pausenlos und oft zu früh das Wort ergreifen“, schreibt Pierre Bourdieu (1997, S.823). Und weiter: „Sie sagen Dinge, die keiner hören will und dies noch dazu in einer Sprache, die man nicht versteht.“ Das ist leider nicht ganz falsch. Aber Intellektuelle sollten lernfähig sein und sich über fundierte Analysen hinaus so - anschaulich, differenziert, der Wahrheit verpflichtet und transparent normativ - gegen den Krieg engagieren, dass sie Aufmerksamkeit erlangen und verstanden werden.
Literatur
Becker, Jörg & Beham, Mira (2006): Operation Balkan. Werbung für Krieg und Tod. Baden-Baden: Nomos Verlag.
Bergman, Max & Imbusch, Peter & Mäder, Ueli & Nollert, Michael (2009): Neue Kriege. Sonderausgabe der Schweizeischen Zeitschrift für Soziologie, Heft 2, Zürich: Seismo Verlag.
Bourdieu, Pierre (1997): Das Elend der Welt. Konstanz: UVK-Verlag.
Jahn, Egbert & Fischer, Sabine & Sahm, Astrid (2005): Die Zukunft des Friedens. Bd. 2, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Maeder, Christoph & Mäder, Ueli & Schilliger, Sarah (2009): Krieg. Zürich: Seismo Verlag.
Anmerkungen
1) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 54, 5. März 2007, S.37.
2) Alle Angebote finden sich unter: www.postgraduate-basel.ch
Ueli Mäder ist hauptamtlicher Ordinarius für Soziologie an der Universität Basel und Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit. Er leitet das Nachdiplomstudium Konfliktanalysen und Konfliktbewältigung.