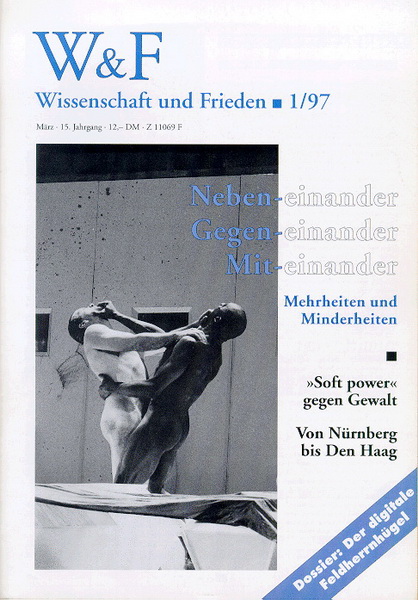Zur Integration ethnischer Minderheiten
Staatstheoretische Fragen
von Klaus Dicke
Die bereits von Platon aufgeworfene Frage nach der besten Verfassung hat mit den weltweiten Minderheitenkonflikten des ausgehenden 20. Jahrhunderts erneut an Aktualität gewonnen. Die Frage eines adäquaten Minderheitenschutzes war und ist eine der zentralen Fragen der Verfassungsdiskussionen in den neuen Demokratien Mittel- und Osteuropas ebenso wie internationaler Regelungsansätze auf bilateraler, regionaler und globaler Ebene (Dicke 1993). Sie stellt zugleich einen der Brennpunkte jüngerer Theoriediskussionen der politischen Philosophie wie insbesondere der sog. Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte dar (Oberndörfer 1997). Jenseits der eher rechtstechnischen Fragen nach möglichst wirksamen innerstaatlichen und internationalen Mechanismen des Minderheitenschutzes geht es dabei grundsätzlich um die Frage, ob der auf republikanischen und menschenrechtlichen Prinzipien beruhende freiheitliche Verfassungsstaat eine auch für multiethnische Gesellschaften angemessene politische Verfassung darstellt oder aber zumindest der Ergänzung durch gruppenrechtliche, dem Schutz und der Förderung ethnischer und kultureller »Identitäten« gewidmete Vorkehrungen bedarf.
Dieser Verfassungsfrage kommt deshalb eine weit über den Minderheitenschutz hinausweisende grundsätzliche Bedeutung zu, weil mit ihr zugleich eine Antwort auf die Integrationsprobleme politischer Gemeinschaften im ausgehenden 20. Jahrhundert gegeben werden muß, die aus drei weltweit zu beobachtenden Entwicklungen resultieren: erstens aus dem irreversiblen Prozeß der Regionalisierung und Internationalisierung von Hoheitsaufgaben, welche »nationalstaatliche« Konzepte politischer Integration als zumindest nicht mehr zureichend erscheinen lassen; zweitens aus der Krise des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, die einen der Stabiltätspfeiler des freiheitlichen Verfassungsstaates in Europa – und besonders in Deutschland – in Frage stellt, und drittens aus dem Wertewandel insbesondere »westlicher« Gesellschaften, in dessen Zuge individuelle Selbstentfaltung gesellschaftliche Bindungswerte in den Hintergrund zu drängen scheint. Gemeinsam ist diesen drei Entwicklungen, für die die »Euro-Debatte«, die Debatten um Steuer- und Rentenreform und die Diskussion um Aufnahme von Grundpflichten ins Grundgesetz in Deutschland als typisch gelten können, daß sie Anlaß geben, die verfassungsrechtliche Festlegung und staatliche Förderung identitätsstiftender Gemeinschaftswerte – Sprache, nationale Kultur i. S. einer »kulturellen Identität« u.a. – als therapeutische Antwort auf zeitgenössische Krisendiagnosen zu empfehlen. Verfassungsfragen des Minderheitenschutzes sind daher nur ein Aspekt der übergreifenden Frage, ob der freiheitliche Verfassungsstaat traditioneller Prägung angesichts vielfältiger Integrationsprobleme noch als »beste Verfassung« gelten und wie er eine herausforderungsreiche Zukunft bewältigen kann. Im Blick auf diese Grundsatzfrage soll im folgenden dem minderheitenpolitischen Aspekt des Problems nachgegangen werden.
Das Problem politischer Integration von Minderheiten im freiheitlichen Verfassungsstaat
Als »neuen Tribalismus« oder als »Rückkehr der Stämme« hat der amerikanische Theoretiker Michael Walzer zusammenfassend die minderheitenpolitischen Integrationsprobleme (1996: 115 ff.) beschrieben, welche nach dem Ende des Ost-West-Konflikts weltweit sichtbar geworden sind. Insgesamt lassen sich mindestens drei Problemlagen unterscheiden, vor die sich Staaten und Verfassungsdiskussionen in dieser Hinsicht heute gestellt sehen:
- Der Übergang von imperialer zu demokratischer Integration vor allem in den Staaten Mittel- und Ost-Europas und die dabei sichtbar werdende Gefahr wiederkehrender Nationalismen werfen die Frage auf, durch welche Ausgestaltung des Staatsbürgerschaftsrechts und des Minderheitenschutzes einerseits und der politischen Kultur andererseits ein Zusammenleben multiethnischer Gesellschaften auf Dauer gesichert werden kann.
- Zum Teil erhebliche Zuwanderungsbewegungen in »westliche« Demokratien, insbesondere auch nach Deutschland, haben dort eine »multikulturelle« Gesellschaft entstehen lassen, in der herkömmliche Regelungen staatlicher Integration wie vor allem der Zugang zur Staatsbürgerschaft mit dem faktischen Gesellschaftsbild nicht mehr kongruieren und der Staat sich entsprechenden Reformforderungen ausgesetzt sieht.
- Ethnisch bestimmte Konfliktlagen in nahezu allen Teilen der Welt vom Gesetzgebungskonflikt – z.B. über den Schutz der französischen Sprache in Quebec – über Verfassungskonflikte bis hin zu Separationsbestrebungen und Bürgerkriegen werfen die Frage auf, durch welche Reformen oder Vorkehrungen Staatsverfassungen ihre friedensstiftende und in diesem Sinne integrative Funktion künftig erfüllen können.
Nun hat der freiheitliche Verfassungsstaat, der in seiner Entwicklungsgeschichte immer wieder vor der Herausforderung der Integration von Minderheiten gestanden hat, eine Reihe von Elementen hervorgebracht, die heute als unverzichtbare und historisch bewährte Intrumente der Integration von Minderheiten in eine politische Gemeinschaft gelten können: rechtsstaatliche Verfahren, den Gruppenpluralismus und repräsentativ-demokratische Regierungsart.
Um den Schrecken des Bürgerkrieges zu entrinnen und zugleich einen den Zynismus des »cuius regio, eius religio« überwindenden Verfassungsentwurf vorzulegen, hatte Thomas Hobbes die Notwendigkeit dargetan, die Geltung staatlicher Gesetze nicht auf die Wahrheit einer bestimmten Weltanschauung, sondern auf die durch Vereinbarung der Gesellschaftsglieder künstliche geschaffene Rechtssicherungsmacht des Staates zu gründen. Hobbes hat damit den rechtsstaatlichen Grundsatz begründet, daß ein Staat in Ansehung der Geltung seiner Gesetze keine Ausnahmen und also auch keine Minderheiten dulden dürfe, sondern von der Gleichheit aller Bürger als dem Gesetz Unterworfene auszugehen habe. Sinn der Verfassung sei einzig, dem Bürger die Sicherheit zu bieten, seinen eigenen Lebensplänen nachgehen zu können. Der Staat der von Hobbes begründeten liberalen Vertragslehre ist formal; er verzichtet darauf, den Bürgern Vorschriften über ihre konkrete Lebensgestaltung zu machen mit der einzigen Ausnahme, daß die Grenze gesellschaftlicher Verträglichkeit nicht überschritten werden dürfe. Die liberale Vertragslehre hat damit den Raum der gesellschaftlichen Autonomie des Bürgers abgesteckt und die für den freiheitlichen Verfassungsstaat unverzichtbare, weil Pluralität ermöglichende Unterscheidung von Staat und Gesellschaft vorgedacht.
Eines der Probleme, die Hobbes übersehen hatte, war die Tatsache, daß der liberale, auf Vereinbarung gegründete Staat ein Minderheitenproblem neuer Art schuf. Mit der amerikanischen und Französischen Revolution hatte sich das Prinzip der Selbstbestimmung des Volkes Geltung verschafft und war neben der gesellschaftlichen auch die politisch-öffentliche Autonomie etabliert worden. Maßstab für die Geltung von Gesetzen war seither nicht mehr allein deren Funktion, öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch ihre Rückführbarkeit auf die Zustimmung der Bürger. Dazu erwies sich das Mehrheitsprinzip als unerläßliches Instrument. Mehrheitsentscheidungen aber schaffen per definitionem Minderheiten. Um deren Schutz gegen die nunmehr sichtbar werdende Gefahr einer »Tyrannei der Mehrheit« zu gewährleisten, wurden unterschiedliche Schutzvorkehrungen eingefügt: erstens wurde durch großräumige politische Organisation die Entstehung eines Interessen- und Gruppenpluralismus begünstigt. Diese in No. 10 der »Federalist Papers« dargelegte Lösung versprach sich minderheitenschützende Effekte von der gegenseitigen Machtkonkurrenz und -kontrolle unterschiedlicher Interessengruppen, die zur Erreichung eigener Ziele auf Kompromisse und damit auf »Mäßigung« angewiesen sind. Zweitens wurden spezielle Regeln zum Schutz von im demokratischen Prozeß unterlegenen Minderheiten eingeführt. Die wichtigsten sind die verwaltungsgerichtliche Überprüfung administrativer Entscheidungen, die wahl- und parteienrechtlichen Regelungen zur Ablösung regierender Mehrheiten und zur Rechtswahrung von Minderheitenpositionen sowie das Institut der Verfassungsbeschwerde. Drittens schließlich kann auch das Institut der repräsentativen Demokratie insofern als Instrument des Minderheitenschutzes angesehen werden, als in seinem Rahmen politische Entscheidungen nur dann als legitim gelten, wenn sie die Belange des ganzen Volkes, also nicht nur der Wahlbürger oder gar deren Mehrheit, berücksichtigen.
Daraus ist zunächst einmal die nicht unwichtige, weil in aktuellen Diskussionen gelegentlich übergangene Zwischenbilanz zu ziehen, daß der freiheitliche Verfassungsstaat in seiner Geschichte eine Fülle von Vorkehrungen und Institutionen hervorgebracht hat, die der Rechtswahrung und Integration von Minderheitenpositionen dienen. Das aktuelle Problem der Integration ethnischer Minderheiten ist dadurch jedoch insofern noch nicht gelöst, als die »Wiederkehr der Stämme« ein Integrationsproblem radikaler Art, nämlich die Frage nach dem Bestand des Staates überhaupt aufwirft.
Das Problem staatlicher Einheit
Diese Frage ist ein Erbe der höchst unterschiedlichen Entwicklung staatlicher Einheit auf der Welt. Der weltweite Siegeszug des Staates als politische Organisationsform schien spätestens mit der sog. »Entkolonialisierung« in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgeschlossen; doch hatte der Staat die Rechnung ohne die Völker gemacht. Wie die zahlreichen seit 1990 zu beobachtenden Sezessionsbewegungen und insbesondere die Bürgerkriege im zerfallenden Jugoslawien und in Ruanda zeigen, steht überall da, wo Staatsgebilde als Instrumente hegemonialer Integration empfunden wurden und werden, der Bestand des betreffenden Staates auf dem Spiel. Hier stellt sich in aller Schärfe die Frage, welche Faktoren eine Gesellschaft zu einem Staat formen und in einem Staat zusammenhalten können.
Auch dabei ist zunächst ein Blick in die politische Ideengeschichte nützlich. Die wichtigsten Antworten auf die Frage, was eine Gesellschaft zu einem politischen Staat formt, geben die Begriffe »Volk« und »Nation«. Beide sind jedoch in der Geschichte in sehr unterschiedlicher Weise gedeutet worden. Schon Cicero sah sich im Zusammenhang seiner Definition der Republik als »Sache des Volkes« veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß ein Volk nicht eine irgendwie zusammengesetzte Herde („non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus“), sondern eine durch gemeinsame Rechtsüberzeugung und Nutzenübereinstimmung geformte Gemeinschaft sei. In der Folge der Französischen Revolution hat der Abbé de Sieyès als Grundlage der nunmehr demokratisch verfaßten französischen Nation das Bekenntnis der Bürger zur Republik und ihre Mitwirkung am allgemeinen Wohlergehen formuliert (Euchner in Renan 1996: 60). Und das Selbstverständnis der Einwanderungsnation par excellence, der Vereinigten Staaten von Amerika, versteht die Republik als politische Struktur, in der eine Nation politisch erst geformt wird: „e pluribus unum“.
Diesem offenen, auf den Willen zur Teilnahme abzielenden Begriffen von Volk und Nation sind jedoch im 18. und 19. Jahrhundert geschlossene Konzeptionen der Nation und des Volkes entgegengesetzt worden, in denen objektive Bestimmungsgründe im Vordergrund stehen. Die Gemeinschaft der Sprache und der aus Mythen, Sagen und Traditionen historisch erschließbare Humus, auf dem eine individuelle Kultur wachse, wurden unter dem Einfluß Herders und der Romantik als das einigende Band einer Nation und Kennzeichen ihrer nach außen abgrenzbaren Identität gesehen. Und die Individualität eines Volkes wurde in biologischen Kriterien wie homogener Abstammung oder gar der Reinheit der Rasse zu begründen gesucht. Funktion dieser objektiven Bestimmungen von Volk und Nation war jeweils die Stabilisierung einer orientierungslosen Gesellschaft oder die Unterstützung der Herbeiführung nationaler Einheit.
Für eine politische Kultur der Republik
Der alleweil zu Nationalismen und in multiethnischen Staaten zum Kampf kultureller Identitäten, wenn nicht zu Bürgerkrieg führende Rückgriff auf geschlossene, auf objektiven Kriterien beruhende Integrationsmuster kann nur durch die bewußte Gestaltung einer politischen Kultur der »offenen Republik« (Oberndörfer 1991) verhindert werden. Dazu sind in Bezug auf multiethnische Gesellschaften mindestens folgende Schritte erforderlich: erstens eine Verfassung, die auf der Basis der »Gleichursprünglichkeit« politischer und privater – besser: gesellschaftlicher – Autonomie (Habermas, in: Taylor 1992: 153 ff.) jedem Staatsbürger und damit auch Minderheiten politische Mitwirkungsmöglichkeiten einräumt. Dazu können im Einzelfall auch privilegierende Autonomierechte wie im Fall der dänischen Minderheit in Südschleswig im Rahmen föderaler Lösungen gehören. Diese müssen jedoch auf dem Teilhabewillen und auf einer politischen Integrationsbereitschaft der betreffenden Minderheit beruhen. Eine republikanische politische Kultur fordert also zweitens eine politische Assimilation bzw. Integration insofern, als auch ethnischen Minderheiten Loyalität zur Verfassung und ihren Institutionen und damit eine Teilhabe am »Verfassungspatriotismus« abzuverlangen ist.
Eine politische Kultur der »offenen Republik« verlangt aber drittens eine bewußte Abkehr von statischen und eine Wiedergewinnung von dynamisch-geschichtlichen Konzeptionen von Politik und auch von Kultur. Ein statisches Politikverständnis liegt etwa bei Walzer vor, wenn er „die multinationale Einwanderungsgesellschaft“ der USA als eine „vergängliche Schöpfung“ ansieht, „die schließlich durch einen einheitlichen Nationalstaat ersetzt werden soll“ (1996: 108). Er übersieht, daß das »e pluribus unum« und das Konzept des »Schmelztiegels« die unabschließbare und zukunftsoffene Aufgabe einer von Generation zu Generation neu zu erarbeitenden Identifizierung der Bürger mit ihrem Gemeinwesen und seinen Institutionen bezeichnet. Gerade die republikanische politische Kultur der USA hat sich auf diesem Wege immer wieder erneuert. Ein statisches Politikverständnis kommt auch im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht zum Ausdruck, das als Deutsche immer noch die Nachfahren deutscher Ahnen und nicht die Bürger Deutschlands gelten läßt, die gewillt sind, im Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland zu leben und sich in den politischen Institutionen des Grundgesetzes zum Wohl des ganzen zu engagieren.
Statisch ist aber auch das dauernde Reden von der kulturellen oder ethnischen »Identität«, das Völker, Nationen oder Minderheiten auf Momentaufnahmen objektiver Kriterien reduziert und den gerade für die Geschichte Europas so wichtigen Sachverhalt übersieht, daß eine Kultur nur im dauernden Werden, in beständiger Tradition und Aneignung und dabei eben auch in der Auseinandersetzung mit dem »Fremden« am Leben erhalten werden – oder aber auch untergehen kann.
Daß es in der Politik nicht um musealen Schutz klar abgrenzbarer »Identitäten«, sondern um die je menschliche Gestaltung kulturellen und gesellschaftlichen Wandels geht, hat in der so nationalistisch geprägten Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts der französische Gelehrte Ernest Renan in seiner berühmt gewordenen Rede vor der Sorbonne vom 11. März 1882 zum Ausdruck gebracht. „Beim Menschen gibt es etwas“ – schreibt er – was der Sprache übergeordnet ist: den Willen“ (1996: 27), und: „Ehe es die französische, deutsche, italienische Kultur gibt, gibt es die menschliche Kultur“ (29). Walter Euchner weist zurecht darauf hin, daß Renans berühmtes Diktum über die Nation – „Das Dasein einer Nation ist … ein Plebiszit Tag für Tag“ – der „Rhetorik der Republik“ entstammt (55). In dieser Rhetorik die Notwendigkeit der Ergänzung des freiheitlichen Verfassungsstaates durch eine lebendige republikanische politische Kultur zu erkennen, ist die Herausforderung, vor welche das Problem der Integration ethnischer Minderheiten weltweit stellt.
Literatur
Dicke, Klaus (1993): Die Verrechtlichung des internationalen Minderheitenschutzes, in: Klaus-Dieter Wolf (Hrsg.), Internationale Verrechtlichung, Pfaffenweiler, S. 109 – 126.
Dicke, Klaus (1994): „Festung Europa“ oder weltoffen-republikanische Europäische Union? Zum Leitbild europäischer Ausländer- und Minderheitenpolitik, in: COMPARATIV 4, S. 48 – 59.
Oberndörfer, Dieter (1991): Die offene Republik. Zur Zukunft Deutschlands und Europas, Freiburg i. Br.
Oberndörfer, Dieter (1997): Zwischen „political correctness“ und kommunitaristischer „Gemeinschaft“ – Der Fall Amerika, in: Georgios Chatzimarkakis/Holger Hinte (Hrsg.), Freiheit und Gemeinsinn. Vertragen sich Liberalismus und Kommunitarismus?, Bonn, S. 47 – 64.
Renan, Ernest (1996): Was ist eine Nation? Rede am 11. März 1882 an der Sorbonne. Mit einem Essay von Walter Euchner, Hamburg.
Taylor, Charles (1993): Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt a.M.
Walzer, Michael (1996): Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie. Aus dem Amerikanischen von Christiane Goldmann. Hrsg. und mit einer Einleitung von Otto Kallscheuer, Frankfurt a.M.
Klaus Dicke ist Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Friedrich Schiller-Universität Jena. Er ist Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, der Deutschen UNESCO-Kommission und Vorsitzender von deren Arbeitskreises »Kultur des Friedens«.