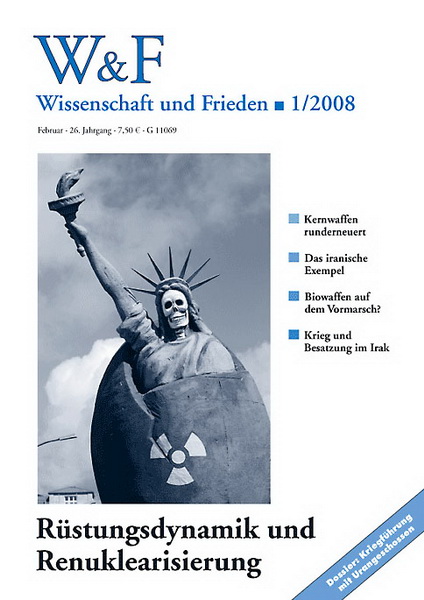Zur künftigen Politik der Naturwissenschaft- lerInnen-Initiative
von Wolfgang Neef
Die folgenden Ausführungen wurden von Wolfgang Neef im Rahmen der Beiratssitzung der NaturwissenschaftlerInnen-Initiative im März 2007 zur Diskussion gestellt.
Unsere Initiative hat im letzten Jahr nach vielen, ziemlich kontroversen Debatten ein Memorandum zur Energie- und Klimapolitik veröffentlicht (vgl. W&F 3/2006). Dieses Memorandum hat, obgleich wir uns darum sehr bemüht haben, keine weitere Verbreitung gefunden. In den letzten Monaten allerdings sind viele der dort angesprochenen Punkte und Ideen in der Debatte um den Klimawandel-Bericht der Vereinten Nationen auch auf der Ebene der »großen« Politik zum Thema geworden. Die erstaunlichste Parallele war ein taz-Interview am 20. Februar 2007 mit Michael Müller, Staatssekretär im Umweltministerium. Müller konstatiert dort: „Die kapitalistische Philosophie des ‚mehr, schneller und weiter' ist am Ende“. Diese These, eine der zentralen Aussagen unseres Memorandums, war bei uns bis zuletzt kontrovers: Der Kapitalismus ist systembedingt nicht in der Lage, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten.
Nun ist das Mantra »mehr, höher, schneller, weiter« stark von Naturwissenschaft und Technik geprägt. Wir erzeugen und verantworten als Naturwissenschaftler/innen und Ingenieur/innen den »technischen Fortschritt«. Wir verdienen gut daran. Wir sind im Rahmen der herrschenden kapitalistischen Ökonomie (die übrigens nur eine von vielen möglichen ist!) diejenigen, die die Wachstumslogik der Ökonomen in Artefakte umsetzen, und diese Artefakte belasten den Planeten inzwischen um rund 25% über seine Tragfähigkeit hinaus.
Im Einzelnen verantworten wir damit folgende Paradigmen:
Der Sinn menschlicher Arbeit wird darin gesehen, immer mehr materielle Güter (in Form von Waren) zu ersinnen und zu produzieren, um Menschen durch Konsum glücklich zu machen.
Menschliche Arbeit wird durch Einsatz von Maschinerie und (bislang fossiler) Energie wegrationalisiert (Steigerung der Produktivkraft) und verbilligt. Für die Natur ist dieser »Königsweg« der Industriegesellschaft aber zunehmend »teuer«, weil sie nur als Ressource wahrgenommen und über die natürlichen Grenzen hinaus ausgebeutet wird.
Diese betriebswirtschaftliche Leitlinie von Naturwissenschaft und Technik ist aber auch für die Gesellschaft »teuer«. Sie führt unter der herrschenden Ökonomie zu Arbeitslosigkeit, existenzieller Unsicherheit, Arbeit zu Hungerlöhnen und Verelendung wachsender Teile der Erdbevölkerung und damit auch zur Zerstörung der sozialen Lebensgrundlagen.
Das Wachstums-Mantra führt zu einem sinn- und hirnlosen »Hamsterrad«, das durch Geld geschmiert und beschleunigt wird und inzwischen (wie z.B. die Klima-Daten zeigen) heißgelaufen ist: Wir sollen arbeiten, um mehr Waren zu konsumieren, und sollen mehr Waren konsumieren, um Arbeit zu haben.
Als Naturwissenschaftler/innen und Ingenieur/innen neigen wir dazu, die Technik, die all das möglich macht, immer wieder zu überschätzen - und uns als »Kamele, auf denen die Kaufleute und Politiker reiten« bereitwillig darauf einzulassen, immer wieder neue »Heilsversprechen« abzugeben. Wenn wir die Versprechungen und Prognosen Revue passieren lassen, die das 20. Jahrhundert und den Technik-Optimismus unserer Industriegesellschaft geprägt haben, wären wir heute längst im »Reich der Freiheit« angelangt, das Karl Marx erwartete, wenn man die Produktivkräfte von ihren Fesseln befreit:
Wir hätten Energie im Überfluss durch Kernspaltung, Wiederaufarbeitung im »Schnellen Brüter« bzw. durch Kernfusion.
Wir hätten durch »Künstliche Intelligenz« ein perfektes Natur-Management (wie es Hubert Markl 1995 im »Spiegel« unter der Parole »Pflicht zur Widernatürlichkeit« propagierte).
Wir hätten durch bemannte Raumfahrt die Möglichkeit, andere Planeten zu besiedeln und dort Rohstoffe herzuholen.
Kleinere Segnungen wären das unsinkbare Schiff, das papierlose Büro, die »Entmaterialisierung« durch IT-Technik, der Überschallflug für Passagiere, das hybride Verkehrssystem oder der Klein-Hubschrauber als Ersatz fürs Auto etc. etc.
All diese Voraussagen sind nicht etwa Hirngespinste von science-fiction-Autor/innen, sondern waren Konzepte, die auf der Basis seriöser Einschätzungen der Naturwissenschaftler/innen- und Techniker/innenzunft mit sehr viel Geld (meist aus staatlichen Töpfen) gefördert wurden. Für eine Naturwissenschaftler/innen-Initiative, die »Zukunftsfähigkeit« auf ihre Fahnen geschrieben hat, ist es deshalb an der Zeit, sich zu fragen, wie sich diese Fehlprognosen zu unseren professionellen Grundsätzen verhalten:
Realistische Analyse der Problemlage, der Erfahrungen, Fakten und Daten;
Arbeiten auf der ‚sicheren Seite', keine Traumtänzerei, sondern auf der Basis von ‚Murphy's Gesetzen' (»Was schief gehen kann, geht schief« etc.) Annahme des ‚worst case' bei der Auslegung einer Konstruktion;
Erfolgsprüfung durch Praxis, Konsequenzen aus Misserfolgen.
Zur Analyse der Problemlage als erster Ebene unserer Arbeit ist in den letzten Monaten sehr viel gesagt und geschrieben worden. Allerdings hat sich die Hauptdiskussion auf die Klimaproblematik beschränkt. Aufgrund von Forschungen und Berechnungen verschiedener naturwissenschaftlicher Disziplinen gibt es andere Problemfelder, die die Lage noch verschärfen:
Die Bio-Reproduktivität ist durch Überlastung und Zerstörung natürlicher Kreisläufe erheblich gefährdet: Schon jetzt beanspruchen wir die natürlichen Ressourcen zu 125%, verzehren also die Substanz, die zu Reproduktion erforderlich ist (wwf-Studie Living Planet Report 2006).
Es wird exponentiell gesteigert Müll »produziert«, z.B. Elektronikschrott oder Chemieabfälle, die zum großen Teil irgendwo in der »Dritten Welt« abgeladen und dort unter z.T. unsäglichen ökologischen und sozialen Bedingungen »entsorgt« werden.
Die Menge der in Verkehr gebrachten neuen chemischen und pharmazeutischen Produkte nimmt ständig weiter zu, ohne dass wir ihre Wirkung auf Organismen einschätzen können. Insbesondere die systemischen Auswirkungen sind unbekannt. Erste gefährliche Resultate kennen wir allerdings schon, z.B. die resistenten Keime in Krankenhäusern und zunehmende Allergien.
Generell beachten wir nicht, dass wir mit jeder Innovation die möglichen Probleme vervielfachen, weil wir sie additiv und nicht substituierend einsetzen: Wir haben, unabhängig von der Gefährlichkeit der Substanzen, ein Mengenproblem. Es ist die erste wichtige Aufgabe unserer Initiative, diese Problembereiche zusammen zu sehen und darauf hinzuweisen, dass sich die daraus resultierenden Gefahren möglicherweise nicht nur addieren, sondern potenzieren. Ich sehe derzeit kaum eine Organisation, die eine solche Sichtweise praktiziert - allerdings auch die Schwierigkeiten dieser Aufgabe, die im Zusammenhang zu erledigen viele naturwissenschaftliche Disziplinen und interdisziplinäre Arbeit erfordert.
Als zweites Element auf der Ebene der Analyse sollten wir den Zusammenhang zwischen dem zentralen Mantra der herrschenden Ökonomie und Politik - dem Wachstum - und der Zerstörung der Lebensgrundlagen thematisieren. Die Debatten über die Ökonomie und z.B. zur Klimafrage werden immer noch weitgehend voneinander getrennt geführt, selbst oder gerade bei denjenigen gesellschaftlichen Kräften, die im Prinzip Kritik an der neoliberalen Ideologie üben, aber noch optimistische Vorstellungen über die Machbarkeit technischer Problemlösungen haben, z.B. Gewerkschaften. »Wachstum« und »Innovation« sind auch bei der keynesianischen Variante der kapitalistischen Ökonomie das Ziel und werden als Lösung des sozialen bzw. des Verteilungsproblems angesehen. Es ist seltsam, dass die einfache Tatsache, dass Wachstum in einer begrenzten Welt physikalische Grenzen hat, trotz der inzwischen klaren Datenlage immer noch verdrängt wird. Die Idee des »qualitativen Wachstums«, modern als »nachhaltiges Wachstum« formuliert, hat sich aufgrund der Entwicklung der letzten 50 Jahre als schlicht unrealistisch herausgestellt. Insbesondere der Nachholbedarf der »Schwellenländer« ist ein rein materieller. Auch die Steigerung der Energieeffizienz durch technische Verbesserungen hat nicht zu einer Verringerung oder Stagnation des Energieverbrauchs geführt: Das Mengenwachstum hat hier alle Fortschritte aufgezehrt, unterm Strich stiegen die CO²-Emmisionen weiter. Seit Mitte der 60er Jahre haben wir in Europa unseren Energieverbrauch auf das Vierfache gesteigert.
Natürlich ist es weiterhin Aufgabe der Naturwissenschaftler/innen und Techniker/innen, die Ressourceneffizienz zu erhöhen - statt aber nur an den Symptomen zu kurieren, sollten wir klar aussprechen, dass der Wachstumsimperativ des Kapitalismus die Wurzel der Probleme darstellt. Hier sehe ich unsere zweite wichtige Aufgabe: Konsequente Wachstumskritik mit naturwissenschaftlich-technischen Argumenten, Bewusstmachen, dass nur ein globales stofflich-energetisches »Nullsummenspiel« die weitere Zerstörung unserer Lebensgrundlagen verhindern kann. Nullsummenspiel aber heißt für die Industrieländer: konsequente Abrüstung des heißgelaufenen Industriesystems auf einen Bruchteil der bisherigen Energie- und Stoffumsätze, etwa auf den Lebensstandard eines Schweizers im Jahr 1967.
Da kommt der dritte Punkt ins Spiel: Die Überschreitung unserer Grenzen als naturwissenschaftlich-technische »Fachleute«. Es gibt zunächst keinen der Naturwissenschaft und Technik inhärenten Drang zum stofflichen »Mehr«. Eine Technik, die alles daransetzt, die Ressourcen-Produktivität zu steigern, braucht, um nützlich und attraktiv zu sein und angemessen honoriert zu werden, nicht ständig gesteigerte Mengen von Waren. Ein inhärentes »Mehr« gibt es bei uns allenfalls im »Mehr« an Erkenntnis. Anders die kapitalistische Ökonomie: um bei gesteigerter Arbeitsproduktivität noch Profit zu machen, braucht sie das »Mehr« zum Überleben der einzelnen Kapitale im Wettbewerb. Auch deshalb stießen alle bisherigen und aktuellen Ansätze z.B. zum Klimaschutz auf den erbitterten Widerstand »der Wirtschaft«. Ganz ohne Marx zu bemühen, lässt sich also an der Empirie der kapitalistischen Globalisierung der letzten Jahrzehnte und den Daten zum Zustand des Planeten schlagend zeigen, dass der Verschleiß an Menschen und Natur systembedingt ist. Das heißt für uns als Naturwissenschaftler/innen und Ingenieur/innen, dass wir ohne Blick über den Tellerrand unserer Disziplinen keine Erfolg versprechende professionelle oder politische Strategie entwickeln können. Konkret: Wir sollten drittens unsere traditionelle Auseinandersetzung mit der Ökonomie wieder aufnehmen und je nach den technischen, sozialen, ökologischen Verhältnissen und Notwendigkeiten jeweils angepasste Ökonomien fordern und selbst mit unseren naturwissenschaftlich-technischen Konzepten entwickeln - Ökonomien also, die sich nicht den scheinbaren Zwängen der herrschenden Ökonomie unterwerfen. Ganz entschieden sollten wir uns gegen den grassierenden Unsinn wehren, die »Gesetzmäßigkeiten« dieser Ökonomie (die weder mit der Wirklichkeit kompatibel sind noch sie erklären können) mit naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten auf eine Stufe zu stellen.
Diese Aufgaben sind mit unserer Tradition der Friedensarbeit eng verbunden - setzen jedoch die Priorität bei der Arbeit zur Beseitigung der Kriegsursachen, die heute im wesentlichen bei den Auseinandersetzungen um Zugang zu energetischen und stofflichen Ressourcen liegen. Bisher haben wir unsere naturwissenschaftlich-technische Kompetenz hauptsächlich zur Analyse von Waffensystemen und deren Wirkungen eingesetzt. Die »zivile« Naturwissenschaft und Technik war - aus historischen Gründen - weitgehend unbezweifelt, selbst gesellschaftlich umstrittene Techniken wie Gen- und Biotechnologie. Insofern plädiere ich nicht nur für eine erweiterte Sicht auf unsere Wissenschaft und ihre Wirkungen, sondern für einen Wechsel unserer Politik hin zur Wissenschafts- und Technikkritik. Dreißig Jahre Erfahrung mit solch einem Ansatz haben mich gelehrt, dass er gerade unserer eigenen Profession gegenüber besonders wirksam, wenn auch nicht sehr bequem ist, weil er Selbstkritik erfordert. Dann ergibt sich unser Engagement für den Frieden auf gänzlich neue Weise aus dem Kern unserer professionellen Arbeit - da diese immer auf die Praxis gerichtet ist, jedenfalls in vielen Bereichen der Naturwissenschaft und bei der gesamten Technik, heißt das auch »praktische Kritik« durch alternative und gegen den kapitalistisch induzierten Mainstream entwickelte Konzepte und Projekte.
Damit verlasse ich die Ebene der Analyse und komme zur zweiten Ebene unserer Arbeit als Initiative: zur Praxis in Naturwissenschaft und Technik. Zunächst ist diese gekennzeichnet von einer Rückkehr zu den bereits erwähnten alten Tugenden der Techniker/innen: Arbeiten auf der sicheren Seite, keine Traumtänzerei. Wir sollten die Konsequenzen ziehen aus manchen von unserer Zunft in den letzten 100 Jahren abgegebenen Einschätzungen, Prognosen und Versprechen, die meistens im Eigeninteresse (Mittel für Forschung und Technik) gegeben wurden, sich dann aber als unrealistisch oder nicht durchführbar erwiesen haben. Dabei spielten sowohl technikimmanente Faktoren eine Rolle (besonders bei der sicheren Beherrschung sehr komplexer Technologien) als auch manchmal sehr simple gesellschaftliche oder natürliche Fakten, die wir in unserer Begeisterung für eine tolle Technik verdrängt haben (Beispiel aus meiner eigenen Profession: Senkrecht startende und landende Flugzeuge für den zivilen Flugverkehr in Ballungsgebieten). Naturwissenschaft und Technik entwickeln sich nicht aus immanenten Gesetzen, sondern im natürlichen und gesellschaftlichen Kontext. Dieser Kontext muss Teil unseres professionellen Horizontes, teilweise sogar des professionellen Kerns unserer Arbeit sein.
Unsere erste Aufgabe in diesem Zusammenhang ist deshalb die ehrliche und realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen technischer Lösungen. Wir sollten deshalb zum einen all unsere Fähigkeiten mobilisieren, um technische Lösungen der Probleme zu entwickeln. So ist es z.B. unbezweifelt, dass auf dem Energiesektor mit allem verfügbaren Potential die erneuerbare Energiewandlung vorangetrieben werden muss, und zwar sehr schnell. Bei aller Begeisterung dafür sollten wir uns aber vor zwei Versuchungen hüten:
Das Lied vom Vorrang technischer Lösungen mitzusingen, auch wenn uns das als Profession große Vorteile bringt, und
nicht einhaltbare Versprechungen zu machen.
Die herrschende Ökonomie lebt davon, dass wir als Naturwissenschaftler/innen und Techniker/innen ihre Ziele von der ständigen Steigerung der Produktivkraft und neuen Produkten in technische Artefakte umsetzen. Sie behauptet, dass eventuell dadurch geschaffene Probleme wiederum technisch lösbar seien und macht damit weiter Profit. Statt uns wider besseres Wissen als „erfinderische Zwerge, die man für alles mieten kann“ (Brecht) dafür herzugeben, sollten wir deutlich sagen, was geht - aber auch, was nicht geht.
Hier möchte ich auf die Kritik von Gerhard Knies an der These in unserem Memorandum eingehen, dass die Erneuerbaren Energien den durch weiteres Wachstum entstehenden Energiebedarf nicht werden decken können (vgl. W&F 4/2006). Knies rechnet vor, dass die Sonneneinstrahlung in den Wüsten ein Mehrfaches der auch in Zukunft benötigten Energie beträgt und schließt daraus und aus einigen groben Abschätzungen des technischen Aufwandes, dass bei Konzentration auf die Entwicklung der Erneuerbaren Energiewandlung „90% der Erdbevölkerung“ auf diese Weise aus den Wüsten mit Strom versorgt werden können.
Für einen Naturwissenschaftler ist die Versuchung groß, aus solchen Berechnungen und der Verfügbarkeit von Techniken zur solaren Energiewandlung abzuleiten, dass wir bezüglich der energetischen Versorgung auch bei weiterem Wachstum keine Sorgen haben müssten: Wieder wird Naturwissenschaft und Technik das Problem lösen. Als Ingenieur sehe ich das anders. Denn diese Berufsgruppe muss das alles stofflich und energetisch umsetzen.
Vorab gibt es zwei Argumente aus naturwissenschaftlicher und politischer Sicht, die unabhängig vom ingenieursmäßigen Erfolg schon zur Vorsicht raten: Die Berechnungen von H.P. Dürr bzw. Ziegler über die Grenzen der energetischen Tragfähigkeit des Biosystems, heute schon um rd. 25% überschritten (»Die 1,5 kW-Gesellschaft«), die auch für die Wandlung von Sonnenenergie in großen, zentralen EE-Systemen gelten; und die erheblichen Probleme mit der Ausbeutung von Ressourcen in anderen Ländern, heute Kriegsursache Nr. 1 - warum das für die Erneuerbaren in Wüsten anders sein soll, müsste mindestens diskutiert werden.
Aus meiner Sicht wäre - mit Bezug zu den »Murphyschen Gesetzen« - zu bedenken, wenn wir in den nächsten 40 Jahren das »Wüsten-Konzept« realisieren wollten:
Es kommt in der Praxis immer anders, als man denkt.
Die Hindernisse, die man nicht erwartet, sind die entscheidenden.
Der energetisch-stoffliche Aufwand für eine solare Wandlungstechnik, die „90% der Weltbevölkerung“ mit Strom versorgt, ist gewaltig. Welche energetische Bilanz hat das? Welcher »ökologische Fußabdruck« wird damit erzeugt? In welchen Zeiträumen ist das realisierbar?
Braucht man wirklich nur „Glas und Eisen in größeren Mengen“, wie Knies meint?
All diese Fragen müssten geklärt werden, bevor ein solches gigantisches Projekt begonnen wird, um nicht wieder ein »Großexperiment« mit Natur und Menschen in Gang zu setzen, das so endet wie bisherige »Großvisionen« von Technikern.
Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht allerdings ist, dass wir durch solcherart Handel mit ungedeckten Schecks die Illusion verstärken, durch Lösung des Energieproblems so weitermachen zu können wie bisher. Denn es bleiben bzw. verschärfen sich die anderen, oben genannten Probleme: Wasserversorgung, Müll, Gefährdung der Bioreproduktivität, systemische Wirkung chemischer Stoffe etc.
Um zuzuspitzen: Unsere Aufgabe als Initiative für Zukunftsfähigkeit ist es, unnachsichtig realistisch die Voraussetzungen und Folgen technischer Lösungen und Innovationen herauszuarbeiten und dabei die Erfahrungen von 200 Jahren technischer Entwicklung im Industriesystem einzubeziehen. So unangenehm das sein mag: Dass wir inzwischen die Überlebensfrage der gesamten Menschheit zu diskutieren haben, ist kein Erfolg, aber das Resultat von Naturwissenschaft und Technik, und es gehört zur professionellen Konsequenz, den bisherigen Weg des naturwissenschaftlichen und technischen Optimismus zu hinterfragen und andere Wege aufzuzeigen.
Dieses Aufzeigen anderer Wege halte ich für genauso wichtig für unsere Initiative wie die Analyse. Wir können auf verschiedenen Gebieten an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten, wenn wir unseren Horizont erweitern und Technik, Soziales/Kulturelles, Ökologisches und die zugehörenden ökonomischen Lösungen integrativ entwickeln. Wir können solche Lösungen gegen den Mainstream öffentlich präsentieren und dadurch auch diejenigen Menschen gewinnen, die immer noch die TINA-Formel von der Alternativlosigkeit des kapitalistischen Wachstumsweges glauben. Insbesondere können wir dadurch die jungen Kolleginnen und Kollegen unserer Profession gewinnen, die ihre Zukunft noch vor sich haben und sich zunehmend fragen, wie es ihnen in 50 Jahren gehen wird, wenn sich nichts ändert. Dabei sind wir nicht allein - der Kapitalismus wird weltweit von weitaus mehr Menschen infrage gestellt und abgelehnt als unterstützt, im Wesentlichen aus sozialen Gründen. Dass das »gute Leben« aber nur dann möglich ist, wenn wir mit den natürlichen Ressourcen grundlegend anders umgehen als bisher, ist weniger bewusst.
Projekte, die grundlegend andere Wege gehen, gibt es bereits. In den Workshops auf der Beiratssitzung wurden sie exemplarisch vorgestellt. Als Naturwissenschaftler/innen-Initiative sind wir nur dann attraktiv für neue und junge Mitglieder, die wir dringend brauchen, wenn wir für diese Möglichkeiten bieten, sich konstruktiv einzubringen. Hier sollte der zweite neue Schwerpunkt unserer Arbeit liegen.
Ich möchte abschließend noch einmal betonen, dass diese neuen Ansätze nicht mit dem bisherigen Schwerpunkt auf der Friedensarbeit kollidieren, denn es ist aus meiner Sicht heute so klar wie nie, dass wir am Scheideweg stehen: Entweder wir machen weiter so, auch als Naturwissenschaftler/innen und Techniker/innen, zivil und militärisch als »erfinderische Zwerge«, dann werden wir bald bis an die Zähne bewaffnet alle gegen alle um die letzten Ressourcen kämpfen. Oder wir finden heute radikal andere Lösungen auch in Naturwissenschaft und Technik, um den laufenden Wahnsinn zu stoppen: in Produktion und Verkehr abzurüsten, auf Verlangsamung und Rückbau zu setzen, andere Wege zu gehen statt nur das Bisherige anders zu machen. »Zurück zur Natur« ist heute eine sehr moderne Parole. Gerade Naturwissenschaftler/innen und Ingenieur/innen könnten sie mit Leben füllen.
Wolfgang Neef ist langjähriger Vorsitzender der Naturwissenschaftler-Initiative für Frieden und Zukunftsfähigkeit und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von attac.