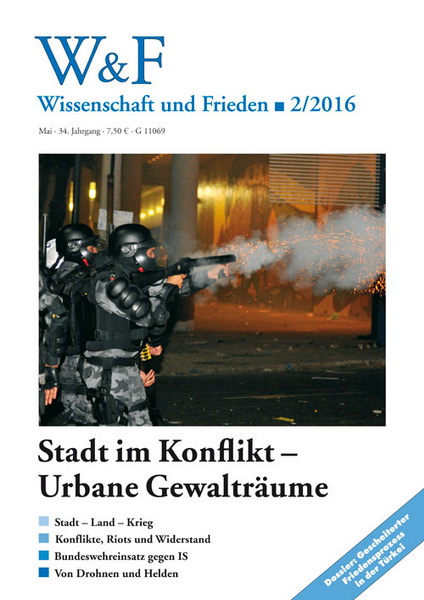Zurück voran?
Die Idee eines Mächtekonzerts für das 21. Jahrhundert
von Lothar Brock und Hendrik Simon
Dass die Welt aus den Fugen gerät, ist eine inzwischen weit verbreitete Einschätzung der weltpolitischen Lage. Aber was tun, um sie doch noch zusammenzuhalten und auf einen besseren Kurs zu bringen? Noch bevor Russland und der Westen sich so richtig entzweiten, bemühte sich eine Forschergruppe aus Frankfurt zusammen mit Kollegen aus Russland und den USA darum, Licht in das Halbdunkel dieser Frage zu bringen. Ein Ergebnis ihrer Beratungen war der Vorschlag, nach dem historischen Vorbild des frühen 19. Jahrhunderts ein »Konzert der (Groß-) Mächte« einzurichten. Läuft der Rückgriff auf frühere Kooperationsansätze auf einen Rückfall hinter die Bemühungen der vergangenen 25 Jahre hinaus, das Gebot der kollektiven Friedenssicherung gegen einen hegemonialen Unilateralismus zu verteidigen? Bietet das 19. Jahrhundert in dieser Hinsicht Anlass zu (verhaltenem) Optimismus? Oder sprechen die historischen Erfahrungen eher gegen den Versuch, die vorhandenen Kakophonien unter Leitung der Großmächte in einem globalen Konzert zusammenzuführen?
In einem viel zitierten Aufsatz prophezeite John Mearsheimer, Exponent des Neorealismus in der Lehre von den internationalen Beziehungen (IB), Anfang der 1990er Jahre, die internationale Politik würde sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts „zurück in die Zukunft“ entwickeln. Gemeint war damit, dass sich die Zukunft der internationalen Politik nach dem Intermezzo des Ost-West-Konflikts wieder ihrer Vergangenheit annähern, die Staatenpolitik also zu den alten Agenden machtgestützter Interessendurchsetzung zurückkehren würde. Das verursachte einen Aufschrei all jener, die von der Möglichkeit eines substantiellen Fortschritts in den internationalen Beziehungen ausgingen und gerade im friedlichen Ende des Ost-West-Konflikts den Beleg für diese Möglichkeit sahen. Die Hoffnungen, die daran geknüpft wurden, blieben angesichts immer neuer kriegerischer Gewalt stets prekär. Heute sind sie einer Belastungsprobe ausgesetzt, die alle Zweifel der vergangenen Jahre in den Schatten stellt.
Wenn Mearsheimer Recht hat, bewegt sich die Weltpolitik in strukturell vorgegebenen Bahnen, die man nur um den Preis der Selbstaufgabe verlassen kann, denn jedes Land wird mit Machtverlust bestraft, wenn es die Verhaltenszwänge, die sich aus der Struktur des internationalen Systems ergeben, ignoriert. Aus dieser Perspektive muss man sich also um der eigenen Zukunft willen den Lehren der Vergangenheit stellen und sich den durch sie vermittelten strukturellen Gegebenheiten des internationalen Systems unterwerfen.
Nagelt uns die Geschichte wirklich auf eine solche Weltsicht fest? Oder bietet gerade die historische Erfahrung Anhaltspunkte für die Möglichkeit, Staatenwelt und Weltgesellschaft in ein neues, konstruktives Verhältnis zu bringen und zumindest die Gefahr großer Kriege zu bannen, wenn es schon nicht gelingen sollte, alle »kleinen« zu beenden? Könnte zu diesem Zweck ausgerechnet ein Blick in das 19. Jahrhundert weiterhelfen, obwohl es als Projektionsfläche für unsere Vorstellungen von klassischer Staatenpolitik und klassischen Staatenkriegen dient? Oder riskieren wir, auf diesem Wege zwischenzeitliche Fortschritte der internationalen Politik (namentlich in Gestalt des Völkerrechts und der Vereinten Nationen) noch weiter zu gefährden, als das gegenwärtig ohnehin schon geschieht?
Blaupause für ein neues »Konzert der Mächte«
Harald Müller, Konstanze Jüngling, Daniel Müller und Carsten Rauch (alle Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung/HSFK in Frankfurt) sind im Rahmen eines international ausgerichteten Forschungsprogramms der Frage nachgegangen, ob ein Rückgriff auf die Geschichte des 19. Jahrhunderts neue (Denk-) Möglichkeiten für einen konstruktiven Umgang mit den Krisen und Konflikten des 21. Jahrhunderts eröffnen kann (Müller et al. 2014; Müller und Rauch 2015). Es handelt sich um den Entwurf einer „Blaupause für eine von Großmächten getragene multilaterale Sicherheitsinstitution“, der sich in Gegenwart und Zukunft die Aufgabe stelle, den Machtübergang von der US-amerikanischen Hegemonie zu einer multipolaren Ordnung in friedliche Bahnen zu lenken.
Eine zentrale Annahme der Überlegungen besteht darin, dass sich im Zeichen der Globalisierung zwar die allgemeine Interdependenz zwischen den Staaten verstärke, diese Entwicklung aber nicht mit einem Abbau bestehender internationaler Machtdisparitäten einhergehe; vielmehr würden die Großmächte weiterhin eine dominierende Rolle im internationalen System spielen. Unter dieser Annahme liegt es nahe, die Chancen der Kooperation von Großmächten auf dem Gebiet der kollektiven Friedenssicherung in den Blick zu nehmen und dabei – soweit möglich – die Geschichte selbst gegen Vorstellungen von der Wiederkehr des ewig Gleichen zu mobilisieren, wie sie der in der Politikwissenschaft so genannte Realismus1 vetritt. Zu diesem Zweck bezieht sich das Autorenteam auf das »Konzert der Großmächte« des 19. Jahrhunderts als Referenzrahmen für eine Neustrukturierung der kollektiven Friedenssicherung im 21. Jahrhundert2
Dieses Unterfangen verdient eine gründliche Auseinandersetzung. Hier wollen wir auf zwei Aspekte eingehen: die Brauchbarkeit des historischen Konzerts als Bezugspunkt für eine Neustrukturierung der kollektiven Friedenssicherung und die Bedeutung einer von Großmächten getragenen Sicherheitsinstitution für die Zukunft der Vereinten Nationen und das Völkerrecht.
Der historische Referenzrahmen: Wofür steht das »Konzert der Mächte«?
Der Autorengruppe der HSFK geht es nicht darum, das Zustandekommen des Konzerts zu erklären, sondern jene Faktoren zu identifizieren, die dazu beigetrugen, einen Krieg zwischen den Großmächten für mehr als eine Generation zu verhindern. Als zentraler Aspekt wird die friedensstiftende Wirkung gemeinsam geteilter Normen herausgearbeitet (Müller und Rauch 2015, S.36). Ausgehend vom Wiener Kongress 1814/15 zur Neuordnung Europas nach den napoleonischen Kriegen habe sich „eine permanente Praxis“ (ebenda, S.63) der Konsultation und Gleichbehandlung etabliert. Konflikten seien die Großmächte im Sinne der militärischen Zurückhaltung, der Akzeptanz des geopolitischen Status quo und der gegenseitigen Nichteinmischung begegnet (ebenda, S.55f).
Diese Einschätzung wird von großen Teilen der jüngeren Forschung geteilt (Schulz 2009). Mehr noch: Den europäischen Großmächten sei es demnach gelungen, zwischen 1815 und 1914 einen gesamteuropäischen Krieg zu verhindern (Schulz 2009, S.4f.). Diese optimistische Interpretation stützt auch die These, das 19. Jahrhundert sei das „friedlichste Jahrhundert der Neuzeit“ gewesen (Levy 1983, S.90f). Insofern könnte das Konzert der Großmächte im 19. Jahrhundert nicht nur als „historisches Vorbild“ (Müller und Rauch 2014, S.36), sondern geradezu als „Prototyp“ der institutionalisierten Zusammenarbeit von Großmächten zur gemeinsamen Gestaltung und Wahrung der internationalen Ordnung angesehen werden (Müller et. al. 2014, S.7).
In der Tat steht das Europäische Konzert für ein Krisenmanagement durch Konferenzdiplomatie. Außerdem waren die Kongresse und Konferenzen der »Wiener Ordnung« politische Katalysatoren für eine Institutionalisierung und Verrechtlichung der internationalen Beziehungen (Koskenniemi 2002). Die kollektive Handlungsfähigkeit der Großmächte im Rahmen des Konzerts stieß jedoch dort an ihre Grenzen, wo es um die Einschränkung eigenmächtiger Gewaltanwendung durch die Großmächte selbst ging. In dieser Hinsicht blieben die direkten Verrechtlichungseffekte des Konzerts begrenzt. Dass die Staatenwelt gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein völkerrechtliches Kriegs- und Gewaltverbot zu diskutieren begann, was sich auch in der Einberufung der Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 niederschlug, war nicht unmittelbarer Ausfluss der zuvor praktizierten Konferenzdiplomatie, sondern Folge der Schwächen dieser Diplomatie mit ihren informellen Verfahrensweisen, die darauf ausgerichtet waren, Konflikte zu managen, ohne die Handlungsfreiheit der Großmächte einzuschränken (Simon 2016).
Das »Doppelantlitz« des Konzerts
So gelang es zunächst nur, Regeln für den Krieg (ius in bello), nicht aber Regeln gegen den Krieg zu formulieren; Der 1899 eingerichtete und 1907 modifizierte Haager Schiedsgerichtshofs konnte lediglich als administrative Verfahrensform der friedlichen Schlichtung, nicht aber als obligatorische, völkerrechtlich bindende Autorität institutionalisiert werden (Dülffer 1981). Diese mangelnde normative Einhegung einzelstaatlicher Handlungsfreiheit drückte sich nicht nur in zahlreichen »kleinen Kriegen«, sondern auch in Kriegen zwischen Großmächten aus: Am Krimkrieg 1853-56 nahmen mit England, Russland und Frankreich gleich drei Großmächte teil. Preußen setzte sich in drei (Einigungs-) Kriegen gegen Dänemark 1864, Österreich 1866 und Frankreich 1870/71 über nahezu alle Konzertnormen der Zurückhaltung und Bewahrung des Status quo (Müller und Rauch 2015, S.63) hinweg.
Das Konzert entfaltete sich unter den Bedingungen eines Gleichgewichts zwischen den Großmächten, konnte aber nicht verhindern, dass das Deutsche Reich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die bestehende Ordnung in Frage stellte (Zamoyski 2007, S.556f). Damit war eine „bilaterale Duell-Situation“, die das Konzert gerade verhindern sollte (Müller und Rauch 2015, S.63), wahrscheinlicher geworden (Wette 2014, S.60). Eine Zivilisierung der Machtpolitik im Rahmen des Konzerts gelang also nur dort, wo keine als essentiell eingestuften Interessen der Großmächte dem entgegenstanden (Schulz 2015, S.97).
Einer der gravierendsten Konstruktionsfehler des Konzerts lag in der mangelnden Normierung des Interventionsrechts (Schulz 2009, S.74-76; Vec 2010). Man kann diese Problematik zwar zur Entlastung des Konzerts überwiegend der »Heiligen Allianz« zuschreiben, zu der sich Russland, Preußen und Österreich nach dem Sieg über Napoleon zusammenschlossen, um die monarchischen Herrschaftsansprüche gegen die neuen national-liberalen Strömungen des frühen 19. Jahrhunderts zu verteidigen. (Der Allianz trat nach der Restauration der Monarchie auch Frankreich bei). Aber die unzulängliche normative Einhegung unilateraler Interventionen wirkte auf das Konzert zurück. Die militärische Intervention stellte das gewaltsame Mittel der Großmächte dar, um die im Wiener Frieden zugrunde gelegte Trennung von Außen- und Innenpolitik (Müller und Rauch 2015, S.56) im Bedarfsfall aufzuheben (Osterhammel 2001, S.168). Militärisches Vorgehen gegen Aufstände und Revolutionen konnte der Stabilität der Großmächteordnung durchaus dienlich sein, erhöhte aber letztlich das Konfliktpotential zwischen ihnen, wie sich mit Beginn des Ersten Weltkrieges zeigte.
In der Gleichzeitigkeit von (teilweisem) Frieden zwischen den Großmächten und ausgeübtem Zwang durch die Großmächte zeigt sich das „Doppelantlitz der internationalen Beziehungen“ im 19. Jahrhundert (Schlichte 2010, S.161): Dem Fortschritt des modernen Statebuilding und des Handels in den europäischen Hauptstädten standen Krieg, Intervention, Überwachung, informeller Imperialismus und Kolonialerwerb gegenüber (Zamoyski 2007, S.568 f.). Mittlere bzw. kleine Mächte in Europa sowie „un-“ bzw. „halb-civilisirte“ Staaten oder politische Ordnungen in Europa, in Übersee und in Afrika wurden unter Einsatz und Androhung von militärischer Gewalt zur „Verfügungsmasse der Großmächte“ degradiert (Langewiesche 1993, S.12).
Die Marginalisierung und aktive Bekämpfung progressiver Stimmen war Nährboden für gesellschaftliche Unzufriedenheit in Europa, für politische Opposition, aber auch für internationale Geheimbünde, Aufstände und politisch motivierte Attentate, die die Krisenmanagementkapazitäten der Großmächte (in Gestalt des Konzerts) tendenziell überforderten. Die Logik der exklusiven Großmächtediplomatie und seine Orthodoxie in der Behandlung soziopolitischer Entwicklungen in Europa säten damit selbst „Keime seiner Selbstzerstörung“ (Zamoyski 2007, S.569).
Der Befund ist also gemischt: Einerseits gelang es dem Konzert, auf der Grundlage gemeinsam geteilter Normen eine Kommunikationspraxis zu entwickeln, die die Konflikte zwischen den Großmächten für eine gewisse Zeit einhegte. Realistische Erklärungsangebote zum Konzert greifen also zu kurz (Müller und Rauch 2015, S.43), denn sie erfassen die Komplexität der Verbindung zwischen Normen und Macht nicht. Das herauszuarbeiten, ist eines der Verdienste des Frankfurter Autorenteams. Andererseits standen dem angestrebten „Machtübergangsmanagement“ der Großmächte (ebenda, S.36) nicht nur zwischen- und innerstaatliche Krisen und Kriege, sondern auch ein Missmanagement der sozialen Konflikte in den europäischen Staaten gegenüber. Nationalismus und Chauvinismus bestimmten das politische Klima in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts.
Aber nicht nur diese Dimension des Krisenmanagements durch das Konzert gilt es zu berücksichtigen, sondern auch das gesellschaftliche Konfliktpotential innerhalb der Großmächte selbst – sowohl bezogen auf die politischen Eliten als auch auf die jeweiligen sozialen Auseinandersetzungen, die etwa in Russland nach dem Dritten Pariser Frieden von 1856 oder in der Julikrise von 1914 kriegsfördernd wirkten (Wette 2014). Das Mächtekonzert steht für beides, Frieden und Zwang. Es offenbart die möglichen negativen Folgen eines exklusiven Großmächtekonzerts, die ihrerseits auf die Funktionsfähigkeit des Konzerts zurückwirken. So hatte sich unter dem Konzert ein enormes Konfliktpotential angesammelt, das sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts Bahn brach.
Konstruktive Blaupause oder Aushöhlung der internationalen Rechtsordnung?
Die Frankfurter Forschergruppe ist sich bewusst, dass ein Konzert der Großmächte heute in einem vollkommen anderen institutionellen Umfeld operieren würde als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu diesem anderen Umfeld gehört ein dichtes Netz internationaler Einrichtungen und völkerrechtlicher Regelungen, die heute fast jeden Aspekt des kollektiven Handelns erfassen. Wie soll das Konzert in diesem Geflecht von Institutionen und rechtlichen Regelungen verortet werden?
Aus sicherheitspolitischer Perspektive besteht ein zentrales Problem des heutigen Multilateralismus in der institutionellen Schwäche des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen als höchstem Organ der kollektiven Friedenssicherung. Die Forschergruppe der HSFK geht von der Möglichkeit aus, die Entscheidungsprozesse im Sicherheitsrat zu verbessern, ohne die Privilegien der fünf Ständigen Mitglieder und Vetomächte als Vorbedingung für eine neue Verfahrensweise aufgeben zu müssen. Das angedachte Konzert könnte sozusagen als eine dem Sicherheitsrat vorgelagerte Instanz zur Konsensfindung fungieren und helfen, die Bedeutung des Vetos im Sicherheitsrat abzuschwächen, indem die Vetomächte sich außerhalb des Sicherheitsrates mit anderen Großmächten beraten oder Vetostaaten von anderen Mitgliedern des Konzerts durch »naming and shaming« unter Druck gesetzt werden, auf Obstruktion zu verzichten (Müller et al. 2014, S.23; Müller und Rauch 2015, S.62).
Es geht so gesehen also nicht um die Ausschaltung der Vereinten Nationen, sondern um eine Verbesserung ihrer Funktionsweise. Dementsprechend grenzt sich die Frankfurter Forschergruppe auch dezidiert gegenüber der Vorstellung ab, eine »Liga von Demokratien« könne als Alternative zu den Vereinten Nationen den sich vollziehenden Machtübergang von der hegemonialen zu einer pluralen Weltordnung bewerkstelligen. Eine solche Liga, so wird überzeugend argumentiert, würde zur Bildung von Gegenallianzen führen, so dass sich im Ergebnis die Probleme des Machtübergangs verschärfen würden (ebenda, S.48). In diesem Sinne kann man die »Blaupause« der Forschergruppe als ein Angebot für die Bearbeitung gegenwärtiger Weltordnungsprobleme verstehen, das im Gegensatz zu der Idee der Liga die Einheit des Völkerrechts wahrt und das System der Vereinten Nationen respektiert.
Insofern soll das Konzert mit der bestehenden Völkerrechtsordnung und den Vereinten Nationen kompatibel sein. Ob diese Kompatibilität aber gewahrt bleibt, hängt nach dem Urteil der Frankfurter Autoren davon ab, ob „das Konzert Selbstbeschränkung“ übt (Müller et al. 2014, S.23). Hier stellt sich jedoch die Frage, weshalb eine solche Selbstbeschränkung im Konzert besser funktionieren soll als im Sicherheitsrat, zumal den Entscheidungen im Sicherheitsrat ohnehin Konsultationen zwischen den Großmächten (und zwar auf verschiedenen Ebenen) vorgelagert sind. Eine Form der Selbstbeschränkung wäre natürlich der Ausschluss missliebiger Mitglieder (wie bei der G7/G8), aber gerade das gälte es ja zu vermeiden, soll das Konzert als solches nicht ad absurdum geführt werden.
Eine weitere Frage ergibt sich aus Folgendem: Für das 19. Jahrhundert kann man nur dann von einer Selbstbeschränkung des Konzerts sprechen, wenn man es zu heuristischen (analytischen) Zwecken von der Heiligen Allianz trennt, wie es die Autoren tun. In der Praxis hat es diese Trennung aber insofern nicht gegeben, als die Interventionspolitik der »Heiligen Allianz« auf das Konzert zurückwirkte (s.o.). Auch für die heutige Zeit wäre davon auszugehen, dass ein Großmächte-Konzert immer auch als Herrschaftsallianz fungieren würde, und zwar im doppelten Sinne: zur Kontrolle kleinerer Staaten und zur Kontrolle missliebiger sozialer Bewegungen im Namen der internationalen Sicherheit. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wie sich heute in beklagenswerter Weise zeigt, ist nicht alles, was sich im Widerspruch zum etablierten Staatensystem auf innerstaatlicher oder transnationaler Ebene tut, als emanzipatorisch zu werten. Das Gegenteil kann der Fall sein (und das ist es im Falle des Terrorismus auch). Aber Selbstbeschränkung und Selbstermächtigung liegen eng beieinander und dürften sich, wie die historische Erfahrung zeigt, in der Praxis immer wieder in die Quere kommen.
Könnte das Konzert über die Kompatibilität mit der bestehenden Völkerrechtordnung in Gestalt der Vereinten Nationen hinaus zu deren Stärkung und Weiterentwicklung beitragen (Müller et al. 2014, S.23)? Bekanntlich hat Jürgen Habermas 1999 räsoniert, die unilaterale Intervention der NATO im Kosovo könnte sich unter bestimmten Bedingungen als Vorgriff auf eine angemessen institutionalisierte Weltordnung erweisen (Habermas 1999). Man hat heute nicht den Eindruck, dass es sich bei der Kosovo-Intervention tatsächlich um einen solchen Vorgriff gehandelt hat, sonst müsste man jetzt nicht über Alternativen wie die hier diskutierte nachdenken.
Andererseits hat sich die Verhandlungspolitik als Mittel des Krisenmanagements inzwischen weiterentwickelt, nicht trotz, sondern wegen der Zuspitzung gefährlicher Konflikte (Iran, Ukraine, Syrien). Würde Verhandlungspolitik zur Routine, wäre das durchaus ein gewisser Fortschritt im Umgang mit laufenden und kommenden Krisen und Konflikten (Staack 2015, 250). Das gedachte Konzert könnte in diesem Sinne den Raum für einen konstruktiven Umgang mit dem sich vollziehen Machtwechsel erweitern. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Weiterentwicklung der bestehenden Völkerrechtsordnung.
Es besteht die Gefahr, dass eine solche Weiterentwicklung durch die Fixierung auf eine konzertante Großmächtepolitik gänzlich von der Tagesordnung der Weltordnungspolitik verschwinden würde. Es waren, wie bereits gesagt, die Funktionsschwächen des historischen Konzerts, die zu dem Unterfangen führten, die Entscheidung über Krieg und Frieden dem Ermessen der Einzelstaaten zu entziehen und in ein System positiv-rechtlicher Regelungen zu überführen (Völkerbund, Vereinte Nationen). Die Fokussierung auf ein Konzert könnte diese Entwicklung umdrehen und wieder verstärkt auf die informelle Kooperation von Großmächten setzen. An Stelle einer rechtlichen Einschränkung einzelstaatlicher Handlungsfreiheit träte dann wieder die kluge Politik, von der schon Kant wusste, dass sie sich nicht von alleine einstellt, sondern unbedingt der positivrechtlichen Begleitung bedarf. Ohne eine solche Politik der Klugheit geht es nicht. Gefragt ist also eine Balance zwischen formellen und informellen Verfahren (Daase 2009), die durch die Einrichtung des Konzerts noch weiter zugunsten des Informellen verschoben würde und damit das völkerrechtliche Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten als Wendepunkt der Völkerrechtsentwicklung (Art. 2, Ziff. 1 UN-Charta) noch weiter aushöhlen würde (Fassbender 2004).
Fazit
Die Lehren des 19. Jahrhunderts für die kollektive Friedenssicherung sind gemischt. Einerseits zeigt die damalige Entwicklung, dass es Chancen einer multilateralen Kooperation zur Vermeidung großer Kriege gibt, die so von den Realisten nicht erkannt werden (können). Auf diese Chancen kann und muss man bauen. Andererseits zeigt sich im historischen Konzert ein Ineinandergreifen von Kriegsverhütung im Großen und Kriegstreiberei im Kleinen, die das Konzert von innen zerstörte. Die Errichtung einer positiv-rechtlichen Ordnung, die das freie einzelstaatliche Ermessen bei der Anwendung von Gewalt aufhebt, soll dem entgegenwirken. Ohne Ausbau des Völkerrechts kann man sich Mearsheimers Logik einer strukturell vorgegebenen Machtpolitik schwer entziehen.
Das Motto für alle Konzert-Partituren muss also lauten: „Zurück zum Völkerrecht!“ (Brock 2016) Denn eine grundlegende Verschiebung der Gewichte von der formellen auf die informelle Ebene der internationalen Politik (von der kollektiven Friedenssicherung zum »gerechten Krieg«) würde letztlich ins 19. Jahrhundert zurückführen. Aus dem »Zurück voran« würde dann doch ein »Voran zurück«, wenn auch nicht im Sinne Mearsheimers.
Anmerkungen
1) Politikwissenschaftliche »Realisten« stehen einem Fortschritt internationaler Ordnung durch Bindung einzelstaatlicher Handlungsfreiheiten an Rechtsnormen skeptisch gegenüber. Zentraler Fokus ist hingegen (wenn auch nicht ausschließlich) Politik als »ewiger« Streit um Macht und Sicherheit.
2) Beim »Konzert der Mächte« handelt es sich um eine mehr oder minder stark institutionalisierte, »konzertierte« Kooperation zwischen den europäischen Großmächten zur Gestaltung der europäischen Friedensordnung, die zunächst als Defensivbündnis gegen das revolutionäre Frankreich mit dem Vertrag von Chaumont am 1. März 1814 gegründet worden war und sich durch unregelmäßige diplomatische Treffen während des 19. Jahrhunderts verstetigte. Frankreich wurde nach dem endgültigen Sieg über Napoleon in das »Konzert« aufgenommen.
Literatur
Lothar Brock (2016): Zurück zum Völkerrecht – Friedensarchitekturen in kriegerischer Zeit. Blätter für deutsche und internationale Politik, 61(1), S.47-58.
Christopher Daase (2009): Die Informalisierung internationaler Politik – Beobachtungen zum Stand der internationalen Organisation. In: Klaus Dingwerth (Hrsg.): Die organisierte Welt – Internationale Beziehungen und Organisationsforschung. Baden-Baden: Nomos, S.290-308.
Jost Dülffer (1981): Regeln gegen den Krieg? Die Haager Friedenskonferenzen 1899 und 1907 in der internationalen Politik. Frankfurt am Main: Ullstein.
Bardo Fassbender (2004): Die souveräne Gleichheit der Staaten – ein angefochtenes Grundprinzip des Völkerrechts. Aus Politik und Zeitgeschichte, 15.10.2004.
Jürgen Habermas (1999): Bestialität und Humanität – Ein Krieg an der Grenze zwischen Recht und Moral. DIE ZEIT, 29. April 1999.
Michael Jonas, Ulrich Lappenküper und Bernd Wegner (Hrsg.) (2015): Stabilität durch Gleichgewicht – Balance of Power im internationalen System der Neuzeit. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Martti Koskenniemi (2002): The Gentle Civilizer of Nations – The Rise and Fall of International Law 1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press.
Dieter Langewiesche (1993): Europa zwischen Restauration und Revolution – 1815-1849. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 3. Aufl.
Ulrich Lappenküper und Reiner Marcowitz (Hrsg.) (2010): Macht und Recht – Völkerrecht in den internationalen Beziehungen. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
John J. Mearsheimer (1990): Back to the future – Instability in Europe after the Cold War. International Security, 15(1), S.5-56.
Harald Müller et. al. (2014):, Ein Mächtekonzert für das 21. Jahrhundert – Blaupause für eine von Großmächten getragene multilaterale Sicherheitsinstitution. HSFK-Report Nr. 1/2014.
Harald Müller und Carsten Rauch (2015): Machtübergangsmanagement durch ein Mächtekonzert – Plädoyer für ein neues Instrument zur multilateralen Sicherheitskooperation. Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung, 4(1), S.36-73.
Jürgen Osterhammel (2001): Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats – Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Bonn: Vandenhoeck & Ruprecht.
Klaus Schlichte (2010): Das formierende Säkulum – Macht und Recht in der internationalen Politik des 19. Jahrhunderts. In: Lappenküper und Marcowitz 2010, op.cit., S.161-177.
Matthias Schulz (2009): Normen und Praxis – Das Europäische Konzert der Großmächte als Sicherheitsrat – 1815-1860. München: De Gruyter Oldenbourg.
Matthias Schulz (2015): Mächterivalität, Rechtsordnung, Überlebenskampf – Gleichgewichtsverständnis und Gleichgewichtspolitik im 19. Jahrhundert. In: Jonas et. al. 2015, op.cit., S.81-99.
Hendrik Simon (2016): The Myth of Liberum Ius Ad Bellum in 19th Century International Legal Discourse. Manuskript.
Michael Staack (2015): Von der »Pax Americana« zur multipolaren Konstellation – Perspektiven einer neuen Weltordnung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Jonas et. al. 2015, op.cit., S.225-254.
Miloš Vec (2010): Intervention/Nichtintervention – Verrechtlichung der Politik und Politisierung des Völkerrechts im 19. Jahrhundert. In: Lappenküper/Marcowitz 2010, op.cit., S.135-160.
Wolfram Wette (2014): Der Erste Weltkrieg – nur noch Geschichte? In: Bruno Schoch et al. (Hrsg.): Friedensgutachten 2014. Münster: LIT, S.59-71.
Adam Zamoyski (2007): Rites of Peace – The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna. New York: HarperCollins; deutsche Ausgabe 2014 erschienen unter dem Titel »1815: Napoleons Sturz und der Wiener Kongress« bei C.H. Beck.
Lothar Brock ist Seniorprofessor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität und Gastforscher am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, beide Frankfurt am Main.
Hendrik Simon, Dipl.-Pol. und M.A., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main und promoviert zur Rechtfertigung von Gewalt und Frieden in den internationalen Beziehungen.