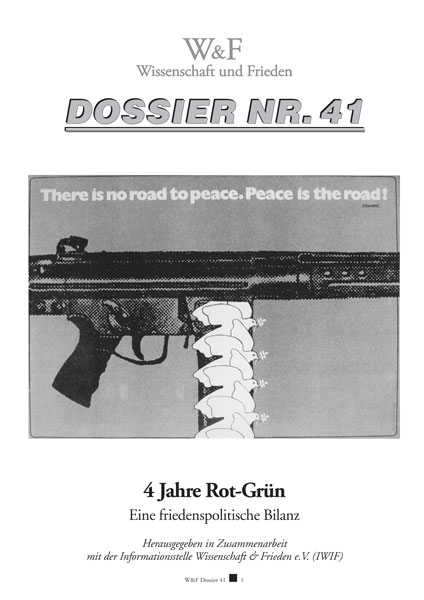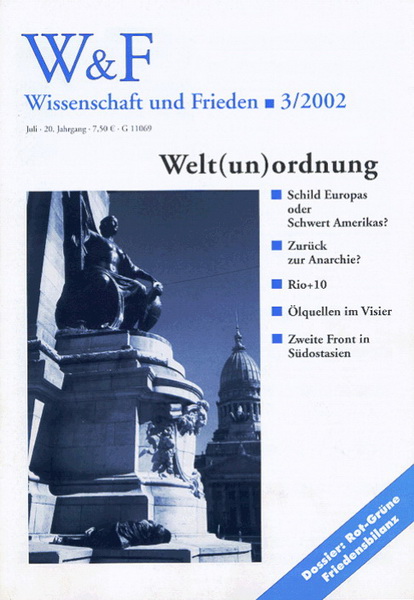Eine friedenspolitische Bilanz
4 Jahre Rot-Grün
von Michael Brzoska / Heiner Busch / Regina Hagen / Jakob Knab / Otfried Nassauer / Jürgen Nieth / Tobias Pflüger / Kathrin Vogler
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Informationsstelle Wissenschaft & Frieden e.V. (IWIF)
zum AnfangIn der Gewaltlogik gefangen
Unter Rot-Grün wuchs die Bedeutung des Militärischen
von Jürgen Nieth
„Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik“. Mit diesen Worten beginnt Kapitel XI (»Europäische Einigung, internationale Partnerschaft, Sicherheit und Frieden«) der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom Oktober 1998. Und weiter heißt es: „Die neue Bundesregierung wird die Grundlinien bisheriger deutscher Außenpolitik weiterentwickeln: die friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbarn, die Pflege der transatlantischen Beziehungen, die Vertiefung und Erweiterung der europäischen Union… die besondere Verantwortung für Demokratie und Stabilität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa… Grundlagen sind dabei die Beachtung des Völkerrechts und das Eintreten für Menschenrechte, Dialogbereitschaft, Gewaltverzicht und Vertrauensbildung. Die Bundesregierung begreift die internationale Zusammenarbeit als Politik der globalen Zukunftssicherung.“
Wenngleich das Friedensthema nicht gerade an herausragender Stelle dieses ersten Rot-Grünen-Dokuments steht – danach folgt nur noch der Punkt »Kooperation der Parteien« – waren die Hoffnungen in großen Teilen der Bevölkerung, vor allem bei den friedenspolitisch Engagierten, groß, schließlich war der eine Koalitionspartner aus der Umwelt- und Friedensbewegung hervorgegangen, waren Teile der Regierungsmannschaft selbst aktiv in der Friedensbewegung der 80er Jahre. Auch die Regierungsvereinbarung selbst weckte Erwartungen. Zum Beispiel wenn es da heißt:
- Die Bundesregierung wird „sich mit aller Kraft um die Entwicklung und Anwendung von wirksamen Strategien und Instrumenten der Krisenprävention und der friedlichen Konfliktregelung bemühen. Sie wird sich dabei von der Verpflichtung zur weiteren Zivilisierung und Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, zu einem ökonomischen, ökologischen und sozial gerechten Interessenausgleich der Weltregionen und zur weltweiten Einhaltung der Menschenrechte leiten lassen.“
- „Die neue Bundesregierung wird im Rahmen der anstehenden NATO-Reform darauf hinwirken, die Aufgaben der NATO jenseits der Bündnisverpflichtung an die Normen und Standards der VN und der OSZE zu binden.“
- „Die kontrollierte Abrüstung von atomaren, chemischen und bakteriologischen Massenvernichtungswaffen bleibt eine der wichtigsten Aufgaben globaler Friedenssicherung. Die neue Bundesregierung hält an dem Ziel der vollständigen Abschaffung aller Massenvernichtungswaffen fest.“
- Oder wenn sich die neue Bundesregierung dazu bekennt, dass „die Rüstungsobergrenzen deutlich unter das heutige Niveau zu senken sind“, dass unter Umständen auch ein „einseitiger Abrüstungsschritt… eine sinnvolle Abrüstungsdynamik in Gang setzen“ kann; dass der deutsche Rüstungsexport außerhalb der NATO und EU „restriktiv gehandhabt“ werden soll.1
Hoffnungsvolle Signale waren auch die Ankündigungen, dass die unter der Kohl-Regierung fast bis auf Null zurückgefahrene Förderung der Friedensforschung wieder aufgenommen wird, dass der Zivile Friedensdienst endlich ernst genommen und unterstützt wird.
Die Ernüchterung
Die Ernüchterung kam schneller als erwartet: Die Regierung war noch kein halbes Jahr im Amt, da beteiligten sich deutsche Soldaten zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder an einem Angriffskrieg, von Ende März bis fast Mitte Juni 1999 bombardierten u.a. ECR-Tornados der Bundeswehr unter Bruch des Völkerrechts die Republik Jugoslawien. An die Stelle des versprochenen Einsatzes für „Krisenprävention und… friedliche Konfliktregelung“ rückte das Streben nach militärischer Mitsprache und Machtdemonstration auch außerhalb des NATO-Gebietes. Statt die „NATO… an die Normen und Standards der VN und der OSZE zu binden“, wurden VN und OSZE vor der Bombardierung Jugoslawiens nicht einmal gefragt und damit entscheidend geschwächt. Statt beizutragen zu einer „weiteren Zivilisierung und Verrechtlichung der internationalen Beziehungen,“ wurde der Krieg wieder zur Fortführung der Politik mit anderen Mitteln, wurde internationales Recht gebrochen.
Sicher gab es damals in dieser Region aufgrund der dauernden Menschenrechtsverletzungen internationalen Handlungsdruck, doch Kenner der Situation, wie das langjährige Mitglied der OSZE-Mission, der Ex-Bundeswehr-General Heinz Loquai, sprechen bis heute von einem „vermeidbaren Krieg“ und bringen dafür zahlreiche Belege.2 Zwischen den internen Lageberichten des Auswärtigen Amtes und der Regierungspropaganda lagen Welten. Während intern noch zehn Tage vor Beginn der Bombardierungen lediglich von „Zusammenstößen zwischen UCK und Sicherheitskräften“ gesprochen wurde, die „bislang nicht die Intensität der Kämpfe vom Frühjahr/Sommer 1998 erreicht haben“,3wurden in der Öffentlichkeit zur Legitimation des Krieges Fakten verschwiegen, verdreht und notfalls auch erfunden. So der sogenannte »Hufeisenplan«, der zum Beleg für die geplante Vertreibung der Kosovaren durch jugoslawisches Militär herhalten musste und den es so wohl nie gab. „Diese Grafiken sind entstanden im deutschen Verteidigungsministerium.“ 4 Oder z.B. die Gräuelmärchen des Verteidigungsministers vom „Konzentrationslager im Stadion“, von Serben, die Schwangeren Frauen „die Bäuche aufgeschlitzt und die Föten gegrillt“ hätten.5 Es gibt viele Beispiele, bei denen sich die Frage stellt, ob die Regierenden wussten, dass es sich um Lügen handelt, ob diese bewusst in Umlauf gebracht wurden, um den Krieg in der deutschen Öffentlichkeit zu rechtfertigen oder ob die Herren Minister »nur« ihnen untergeschobene Falschinformationen ungeprüft weiterverbreitet haben. Im jedem Fall wäre später eine Aufarbeitung und Korrektur notwendig gewesen. Sie blieb aus, wie insgesamt die eigentlich unbedingt notwendige und „die vielfach von offizieller Seite vor und während des Krieges versprochene breite und intensive Diskussion der Konsequenzen und Lehren aus dem militärischen Eingreifen der NATO bis heute nicht stattgefunden hat.“6 Die Aufarbeitung des »Weges in den Krieg« und eine Untersuchung möglicher alternativer Strategien blieb aus; statt auf die Entwicklung ziviler Konfliktlösungsvarianten richtete sich in der Folgezeit das Denken und Handeln auf die Steigerung der militärischen Leistungsfähigkeit. Der Krieg gegen Jugoslawien wurde so zum Wendepunkt in der deutschen Außen- und Militärpolitik.
Der Krieg als »Normalfall«
Die folgenden Monate wurden von einer Debatte um Strukturveränderungen der Bundeswehr dominiert. Und ob Weizsäcker-Kommission, Kirbach-Papier oder das Eckpunkte-Papier Scharpings, die Kernaussagen gleichen sich: Es geht um die Verkleinerung der Bundeswehr bei gleichzeitiger Effektivierung. Und unter Effektivierung wird vor allem eine Umorientierung verstanden: Weg von der Verteidigungsarmee, die nur im Falle eines Angriffs auf das Bündnis einsatzbereit sein muss, hin zur Interventionsarmee, die jederzeit weltweit einsatzfähig ist und dementsprechend auch hochgerüstet werden muss. Die Weizsäcker-Kommission empfahl „die deutschen Streitkräfte auf eine schnelle Reaktion in zwei gleichzeitigen Krisen hin auszurichten“ und sich darauf zu konzentrieren „Kräfte für multinational geführte Einsätze und gemeinsame europäische Kontingente bereitzustellen“ .7 Der damalige Generalinspekteur Kirbach sprach davon, dass das Einsatzgebiet der Bundeswehr „künftig vorrangig außerhalb der Grenzen Deutschlands“ liegen wird und es darum geht „eine große Operation über einen mittleren Zeitraum… oder zwei mittlere Operationen mit sehr langer Einsatzdauer… sowie mehrere kleinere Operationen von sehr kurzer bis zu sehr langer Einsatzdauer… gleichzeitig durchführen zu können.“8
Auch für den Verteidigungsminister ging es darum, an mehreren Orten gleichzeitig intervenieren zu können. Deshalb hatte für ihn „die Verbesserung der strategischen Verlegefähigkeit… erste Priorität“9
Als der Bundeskanzler im September 2001 dem US-Präsidenten die Bundeswehr für den Krieg gegen den Terrorismus anbot, mag das zum Teil aus der aktuellen Situation heraus geschehen sein, in jedem Fall aber lag es in der Kontinuität der letzten drei Jahre, in denen Krisenbewältigung fast ausschließlich militärisch gedacht wurde; drei Jahre, in denen Kriegsführungsfähigkeit mit Normalität verwechselt wurde, anstatt den Frieden und die Vermittlungsfähigkeit als das Normale und das Erstrebenswerte zu sehen.
Fazit
Sicher soll nicht verkannt werden, dass es unter Rot-Grün in einigen Bereichen friedenspolitische Maßnahmen gab, die sich positiv von der Vorregierung abhoben. Die Einrichtung einer Deutschen Stiftung Friedensforschung zählt dazu genauso wie die Förderung des Zivilen Friedensdienstes oder die Initiativen für eine Einschränkung des Handels mit Kleinwaffen. Weitere Beispiele finden sich in den Einzelbilanzen dieses Dossiers. Und doch fällt mir bei aller Wertschätzung einzelner Maßnahmen und Initiativen und auch angesichts der Tatsache, dass von Schwarz-Gelb sicher nicht mehr zu erwarten gewesen wäre, an diesem Punkte Kurt Tucholsky ein, der vor 80 Jahren textete: „Gut, das ist der Pfennig aber wo ist die Mark?“ Tucholsky fortgesetzt müsste es heute weiter heißen: Die Mark ist Milliarden und milliardenfach ins deutsche Militär geflossen. Aus der 1998 versprochenen deutlichen Absenkung der „Rüstungsobergrenzen … unter das heutige Niveau“ wurde nichts.
Und die Ökonomie sagt Entscheidendes über den Stellenwert: Nicht die Förderung des einen oder anderen Friedensprojekts, nicht der eine oder andere friedenspolitische Ansatz bestimmen die Bilanz der rot-grünen Regierung. Dominierend ist, dass sich in diesen vier Jahren Deutschland erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder an zwei Angriffskriegen beteiligt hat, dass sich heute wieder wie selbstverständlich deutsche Soldaten in Afghanistan an Kampfeinsätzen beteiligen, dass 2002 mehr Bundeswehrsoldaten außerhalb des NATO-Gebietes stationiert sind als jemals zuvor. Bestimmend ist, dass das Trio Schröder – Scharping – Fischer offensichtlich dem Irrglauben anhängt, politische Lösungen ließen sich mit militätischen Mitteln erzwingen. Da bleibt dann kaum Raum für das Versprechen der Koalitionsvereinbarung, sich mit aller Kraft „um die Entwicklung und Anwendung von wirksamen Strategien und Instrumenten der Krisenprävention und der friedlichen Konfliktregelung (zu) bemühen“ und beizutragen „zur weiteren Zivilisierung und Verrechtlichung der internationalen Beziehungen.“
Anmerkungen
1) Alle vorstehenden Zitate: Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Frankfurter Rundschau, 22.10.1998.
2) Heinz Loquai: Der Kosovo Konflikt. Wege in einen vermeidbaren Krieg. Nomos Verlag, Baden-Baden, 2000.
3) Lageberichte des Auswärtigen Amtes, vor Gericht verwertet zur Ablehnung von Flüchtlingen aus dem Kosovo. AZ:514-516.80/33841, siehe auch W&F 2/99, S. 8.
4) Heinz Loquai in der Panorama-Sendung der ARD vom 18.05.2000, zitiert nach W&F, 3/2000, S. 66.
5) Der Spiegel, 26.04.99, S. 26, Interview mit Rudolf Scharping.
6) Dieter S. Lutz und Reinhard Mutz: Für die politische Zukunft des Kosovos hat der Westen kein Konzept. Offener Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. FR 24.03.01.
7) Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr, Berlin, 2000, S. 53
8) Eckwerte für die konzeptionelle und planerische Weiterentwicklung der Streitkräfte, S. 12
9) Die Bundeswehr – sicher ins 21. Jahrhundert – Eckpfeiler für eine Erneuerung von Grund auf, Berlin, Juni 2000
Jürgen Nieth, verantwortlicher Redakteur von W&F
zum AnfangRüstungskontrolle: Kaum Widerstand gegen Bush´s Kahlschlagpolitik
von Otfried Nassauer
„Eine wesentliche Aufgabe sieht die neue Bundesregierung in der präventiven Rüstungskontrolle.
Sie ergreift Initiativen, um im Rahmen der KSE-Verhandlungen die Rüstungsobergrenzen deutlich unter das heutige Niveau zu senken. Sie macht ihren Einfluss geltend, um den internationalen Regimes zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen Geltung zu verschaffen, besonders grausame Waffen wie Landminen weltweit zu verbieten und die weitere Reduktion strategischer Atomwaffen zu befördern. Zur Umsetzung der Verpflichtungen zur atomaren Abrüstung aus dem Atomwaffensperrvertrag wird sich die neue Bundesregierung für die Absenkung des Alarmstatus der Atomwaffen, sowie für den Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen einsetzen.
Die neue Bundesregierung unterstützt Bemühungen zur Schaffung atomwaffenfreier Zonen. Sie wird eine Initiative zur Kontrolle und Begrenzung von Kleinwaffen ergreifen.“
(Aus Kapitel XI.6 Abrüstung und Rüstungskontrolle der rot-grünen Koalitionsvereinbarung vom 20.10.1998)
Kaum Außenminister, löckte Joschka Fischer den Stachel: Washington, so der Minister, möge – zumindest im Blick auf die NATO – einen Verzicht auf den Ersteinsatz nuklearer Waffen bedenken. Trotz Fischers gleichzeitigem deutlichen Bekenntniss zur Kontinuität in der Außen- und Sicherheitspolitik unter Rot-Grün wurde er daraufhin politisch regelrecht »zusammengefaltet«. Binnen Tagen war klar: Alles bleibt wie es ist; die Initiative – aus amerikanischer Sicht ein Frontalangriff auf die US-Nuklearstrategie – war mausetot. Danach kamen in der Rüstungskontroll- und Nichtverbreitungspolitik aus Berlin – wenn überhaupt – nur leise Töne:
- Initiativen im Rahmen der Verhandlungen über das zweite Abkommen über konventionelle Stabilität in Europa (KSE-2), um der Stabilität Priorität gegenüber den amerikanischen Wünschen nach mehr Flexibilität zu verleihen (weitgehend gescheitert);
- Versuche, im Rahmen einer informellen Gruppe der nichtnuklearen Fünf der NATO, die Rolle nuklearer Waffen im Kontext der NATO-Strategie zurückzudrängen zugunsten einer Stärkung des nuklearen Nichtverbreitungsregimes (partiell erfolgreich);
- Unterstützung für ein weitgehendes nukleares Teststoppabkommen (bedingt erfolgreich);
- Unterstützung für ein Abkommen über ein Verbot der Produktion waffenfähiger Kernmaterialien und für ein Verifikationsverfahren zur Absicherung der B-Waffen-Konvention aus dem Jahre 1972 (beides gescheitert);
- Bemühen um eine substantielle Grundlage für die erste Konferenz der Vereinten Nationen, die sich mit der Begrenzung des illegalen (aber nicht des legalen) Handels mit Kleinwaffen beschäftigen sollte (gescheitert).
Die Herausforderungen des George W. Bush
Die Zeit spielte wie so oft in der Diplomatie eine entscheidende Rolle. Vieles, was unter der Clinton-Administration in Washington auf den Weg gebracht werden konnte, gelang erst in deren letzten Monaten und bot der Bush-Administration Optionen zum Rückzug, die diese nur zu gerne nutzte.
Richard Haass, Direktor für Politische Planung im US-Außenministerium: Die neue Regierung betreibe »Multilateralismus a la carte«. „Wir werden uns jedes Abkommen einzeln anschauen und eine Entscheidung treffen.“ Das Ergebnis der bisherigen Einzelfallentscheidungen ist bildlich gesprochen eine Schneise der Verwüstung in der Rüstungskontroll-Landschaft (Daran ändert es nichts, dass die Regierung Bush erstmals einen Rüstungskontrollvertrag mit Rußland unterzeichnete. In ihm steht nichts, was die Interessen Washingtons beeinträchtigt, aber vieles, das für einen weiteren Abbau rüstungskontrollpolitischer Regeln genutzt werden kann).
Nach nur achtzehnmonatiger Amtszeit hat die neue US-Administration deutliche Zeichen gesetzt:
- Der ABM-Vertrag wurde gekündigt und mit ihm entfallen auch viele Begrenzungen für eine künftige Militarisierung des Weltraums.
- Die Unterschrift der USA unter die römische Konvention des Internationalen Strafgerichtshofs ist zurückgezogen worden.
- Abgelehnt wurde das Protokoll für ein Verifikationsabkommen, mit dem das Verbotsabkommen für biologische Waffen wirksamer gemacht werden sollte; eigene Vorschläge für ein solches Protokoll präsentierte Washington nicht.
- Verhindert wurde, dass im Juli 2001 bei der ersten UN-Konferenz über den illegalen Handel mit Kleinwaffen ein zwar nur sehr begrenztes, trotzdem aber doch sinnvolles Aktionsprogramm zur Begrenzung des Kleinwaffenhandels verabschiedet werden konnte.
- Zurückgezogen wurde die Zusage der Regierung Clinton, bis zum Jahr 2006 auf Antipersonenminen zu verzichten und dem Ottawa-Vertrag über ein Verbot dieser Waffen beizutreten.
Die nächsten Schritte sind absehbar:
- Auf Wunsch des Pentagons wird überprüft, ob die USA auch ihre Unterschrift unter den CTBT, den Teststopp-Vertrag, zurückziehen soll. Im Verteidigungsministerium ist man der Auffassung, der Vertrag behindere die Entwicklung einer neuen Generation nuklearer Waffen. Im Energieministerium wird z. Zt. die Vorbereitungszeit für die Wiederaufnahme nuklearer Tests signifikant verringert.
- Auf mittlere Sicht ist damit zu rechnen, dass auch der Weltraumvertrag in Frage gestellt werden wird. Er behindert die Weltraumrüstungspläne der US-Administration.
- Konservative Hardliner und Militärs ziehen in Zweifel, ob der INF-Vertrag, mit dem einst die nuklearen Mittelstreckenraketen in Ost und West abgebaut wurden, noch im Interesse Washingtons ist, denn er verbietet nur Washington und Moskau den Bau und Besitz auch konventioneller Mittelstreckenraketen.
Besonders problematisch aber ist, dass die Haltung der Washingtoner Administration, weit über die Rüstungskontrolle hinaus, auch in anderen Bereichen dazu beiträgt, die internationalen Beziehungen zu deregulieren. Manche in den Washingtoner Amtsstuben würden gar am liebsten die Wiener Konvention über internationale Verträge – wie viele völkerrechtliche Rechtsakte von Washington zwar unterzeichnet jedoch nie ratifiziert – durch einen Widerruf der US-Unterschrift aus dem Verkehr ziehen. Diese Konvention fordert von den Signatarstaaten eines Abkommens, das noch nicht ratifiziert ist, sich so zu verhalten als sei der Vertrag bereits in Kraft. Es darf also nicht gegen den Geist der unterzeichneten Vereinbarung verstoßen werden. Obwohl z.B. der SALT2- und der START2-Vertrag nie in Kraft getreten sind, haben sich alle Beteiligten an deren Regelungen gebunden gefühlt.
Würden die USA ihre Unterschrift unter die Wiener Konvention zurückziehen, so stünde auf einen Schlag eine Vielzahl internationaler Rüstungskontrollabkommen vor dem Aus: Allen voran das Abkommen über einen umfassenden Atomteststopp – CTBT, Verträge wie der KSE2-Vertrag über Konventionelle Stabilität in Europa oder auch die Zusatzprotokolle der Genfer Konvention, das wichtigste internationale Dokument zur Begrenzung inhumaner Kriegführung.
Beredtes Schweigen im deutschen Walde?
Dieser rasanten Entwicklung wusste die Bundesregierung wenig entgegenzusetzen. Ihre Haltung in den ersten Monaten der neuen US-Administration erweckte den Eindruck, Berlin schwanke zwischen ungläubigem Staunen, Nichtverstehen und der Hoffnung, nichts werde so heiß gegessen wie es gekocht wurde. Mantraartige Beschwörungen der Bedeutung des Multilateralismus, der fundamentalen Bedeutung von Rüstungskontrolle und Abrüstung sowie rituell wiederholte Mahnungen, es gelte das rüstungskontrollpolitisch Erreichte zu erhalten, prägten die Folgezeit, in der aber schnell die Erkenntnis unvermeidlich wurde, dass es der Regierung Bush mit dem Ausstieg zumindest aus dem ABM-Vertrag Ernst war. Hoffnungen, Russland werde mehr als nur hinhaltenden Widerstand leisten, erwiesen sich bald als illusionär. Die Mahnungen wurden zur faktischen Bitte: Washington möge das rüstungskontrollpolitische Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Auch hier wurde schnell deutlich, dass dieser Bitte nicht entsprochen werden würde.
In Reaktion auf die Terroranschläge des 11. Septembers machte George W. Bush mit seiner Rede zur Lage der Nation im Januar deutlich: Terrorismus und Proliferation sind künftig wichtige Interventionsgründe; rüstungskontrollpolitische Mittel zur Proliferationsverhinderung und -verlangsamung sind vielleicht nützlich, aber nicht länger prioritär. Seither – und vor allem angesichts der rüstungskontrollpolitischen Deregulierungspolitik der US-Regierung – sucht die Bundesregierung nach probaten Mitteln zur Schadensbegrenzung. Substantielle Initiativen, um alleine oder im Kontext der Europäischen Union zu Politikkonzepten zu kommen, die Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie Proliferationsverhinderung durch Nichtverbreitungsinitiativen befördern, blieben jedoch aus. Dies blieb auch in Washington nicht verborgen. Schon Anfang dieses Jahres wusste der deutsche Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, zu berichten, dass er gefragt wurde, wo denn die deutschen und europäischen Initiativen zur Stärkung der Nichtverbreitung bleiben würden.
Berlin tut sich in der Tat schwer, in dem neuen, der Rüstungskontrolle so wenig zugetanen Umfeld in Washington zu agieren. Dies ist drei Faktoren geschuldet:
- Zum einen will die Bundesregierung nicht offen gegen den amerikanischen Partner agieren, mit Washington aber ist wenig möglich. Sie befürchtet, dass Initiativen gemeinsam mit der EU oder gar Russland seitens der USA als Affront gewertet würden.
- Zum zweiten ahnt Berlin, dass die Regierung Bush die allermeisten – auch gutgemeinten Vorschläge – ablehnen würde, weil sie diese entweder für weniger effizient als das Mittel militärischer Intervention erachtet oder weil sie glaubt, dass neue Regeln die Handlungsfreiheit der USA beschränken.
- Zum dritten gibt es neuartige, sehr ernstzunehmende Probleme, denen sich Rüstungskontroll- und Nichtverbreitungspolitik künftig stellen müssen. Für diese fehlen weltweit noch die Antworten. Das wichtigste: Rüstungskontrollpolitik und Nichtverbreitung sind bislang Mittel in den zwischenstaatlichen Beziehungen; zurzeit gibt es keine überzeugende Antwort auf die Frage, wie diese Mittel gegenüber nichtstaatlichen Akteuren – z.B. transnationalen Terrorgruppen auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen – griffig gemacht werden könnten.
Erstaunlich aber bleibt, dass auch jenseits der objektiven Probleme, da wo Initiativen möglich wären, fast schon Agonie zu herrschen scheint:
- Weder Berlin noch Brüssel verfolgten ernsthaft die bereits ergriffene Initiative weiter, Nordkorea – gegebenenfalls gemeinsam mit Rußland und China – mittels wirtschaftlicher Zugeständnisse zur Aufgabe seiner Raketenprogramme und -proliferation zu bewegen.
- Weder Berlin noch Brüssel ergriffen die Initiative, notfalls auch ohne die USA zu einer Verifikationsregelung für die B-Waffenkonvention zu kommen.
- Weder Berlin noch Brüssel arbeiten daran, ein schlüssiges Konzept zur Stärkung von Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung zu entwickeln. Dabei wäre das ein notwendiger Schritt hin zu einer asymmetrischen, an den Stärken der eigenen Handlungsmöglichkeiten orientierten Politik Europas.
Last Waltz?
Ach ja, da war noch etwas: So gering die Rolle der Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik im praktischen Handeln der Bundesregierung in den vergangenen drei Jahren war, so dramatisch wird in den letzten Sitzungswochen des alten Bundestages nun aufs Tempo gedrückt. Als gelte es ein rhetorisches, rüstungskontrollpolitisches Vermächtnis zu formulieren, arbeiten die Koalitionsfraktionen nun gleich an drei Entschließungsanträgen zum Thema. Einer befasst sich mit der Notwendigkeit eines weitergehenden Verbotes von Landminen, ein zweiter mit Initiativen, um doch noch zu einem Verifikationsprotokoll für B-Waffen zu kommen und schließlich gibt es noch einen Antrag zum Thema nukleare Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.
Die ersten Entwürfe der Anträge lassen sich in substantiellen Teilen gut an. Zwar fehlen weitgehend innovative Ideen im Hinblick auf die künftig neuen rüstungskontrollpolitischen Fragestellungen. Auch zeigt sich nur punktuell, nicht aber strukturell der politische Wille, der Deregulierungspolitik der Bush-Administration konzeptionell eigenes entgegenzusetzen. Aber der größte Mangel ist ein anderer: Der neuen Dynamik zu abrüstungspolitischen Rhetorik wird kaum eine neue Dynamik abrüstungspolitischen Handelns folgen. Wie sollte sie auch? Bis zum Wahltag sind Wahlkampf und Sommerpause. Und danach werden die Karten neu gemischt.
Otfried Nassauer ist freier Journalist und leitet das Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit. Weitere Informationen: www.bits.de
zum AnfangDie neue Triade: Atomwaffen, Raketenabwehr, Weltraumrüstung
Deutschland schweigt – und mischt mit
von Regina Hagen
„In der Koalitionsvereinbarung verpflichten sich die unterzeichnenden Parteien auf die Eckpunkte ihrer künftigen Regierungspolitik. … Auf der Ebene politischer Bekenntnisse wird die Koalitionsvereinbarung für viele Pazifisten und Friedensbewegte teilweise unerträglich sein.“ Diese Vermutung des Arbeitskreises Frieden der Grünen trog nicht.1 Die Vereinbarungen der rot-grünen Bundesregierung vom 20. Oktober 1998 blieben bezüglich der nuklearen Abrüstung tatsächlich hinter den Forderungen des grünen Wahlprogramms für die Bundestagswahl 1998 zurück. Dabei kristallisierte sich bereits heraus, welcher der beiden Koalitionspartner im weiteren Verlauf der Legislaturperiode bei sicherheitspolitischen Fragen den Ton angeben würde.2
Andererseits – im Vergleich zur Politik der Kohl-Regierung gaben die Absichtserklärungen der neuen Koalitionäre Anlass zur vorsichtigen Hoffnung. Die Regierung hält, so der Text, „an dem Ziel der vollständigen Abschaffung aller Massenvernichtungswaffen fest und wird sich in Zusammenarbeit mit den Partnern und Verbündeten Deutschlands an Initiativen zur Umsetzung dieses Ziels beteiligen.“ Die neue Regierung werde Initiativen ergreifen, um „die weitere Reduktion strategischer Atomwaffen zu befördern“ und sich „für eine Absenkung des Alarmstatus der Atomwaffen, sowie für den Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen einsetzen.“ Des weiteren „[unterstützt] die neue Bundesregierung Bemühungen zur Schaffung atomwaffenfreier Zonen.“3
Ersteinsatz und nukleare Teilhabe
Mit dem Beschluss vom Herbst 1998, der Teilnahme der Bundeswehr an einem Angriff gegen Rest-Jugoslawien ohne UN-Mandat zuzustimmen, wurde das Versprechen „Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik“ bereits zu Beginn der Legislaturperiode ad absurdum geführt. Kurz danach schlug Außenminister Fischer auf einer Tagung der NATO-Außenminister überraschend vor, in der neuen Bündnisstrategie auf den Ersteinsatz von Kernwaffen zu verzichten. Mit seinem unkoordinierten Vorstoß fing er sich aus den USA einen derben Rüffel ein. Seine US-amerikanische Kollegin Madeleine Albright ließ keinen Zweifel, dass derart ungebührliche Äußerungen nicht tolerierbar seien.
Damit war die Chance zu einer Diskussion über die Rolle von Atomwaffen und die damit verbundenen Einsatzstrategien vertan. Fast widerstandslos schwimmt Rot-Grün seither im Strom der Entscheidungen mit, ein eigener Gestaltungswille ist nicht zu erkennen.
Wenige Monate später, im April 1999, verabschiedete die NATO mit Billigung der deutschen Regierung ihr neues Strategisches Konzept. Darin wurde für die Bündnispolitik des 21. Jahrhunderts ausdrücklich festgeschrieben: „Nukleare Streitkräfte werden weiterhin eine wesentliche Rolle spielen. … Die strategischen Nuklearstreitkräfte des Bündnisses, vor allem diejenigen der Vereinigten Staaten, bieten die oberste Garantie für die Sicherheit der Verbündeten. … Das Bündnis wird daher angemessene nukleare Streitkräfte in Europa beibehalten.“4
Nach Angaben des Berlin Information-center for Transatlantic Studies (BITS) lagern in Büchel und Ramstein nach wie vor 11 bzw. 54 freifallende Atombomben des Typs B61-11 der USA.5 Die Bomben werden von der US Air Force gewartet. Zum Einsatz kämen sie im Ernstfall, der von deutschen Soldaten unter Verletzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen regelmäßig geübt wird, von deutschen Tornados. Gemäß Artikel II des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages von 1968 ist Deutschland verpflichtet, „Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt darüber von niemandem unmittelbar oder mittelbar anzunehmen.“
Nukleare Abrüstung? Fehlmeldung. Ersteinsatz? Bleibt Politik des 21. Jahrhunderts. Absenkung des Alarmstatus? Ach was. Aufkündigung der nuklearen Teilhabe? Keine Rede. Diskussion über den Status der britischen und französischen Atomwaffen im militärisch zusammenwachsenden Europa? Schon gar nicht.
Raketenabwehr – mit EADS zu MEADS und darüber hinaus
Mit der Aufrechterhaltung einer einheitlichen Sicherheitszone begründete Bundeskanzler Schröder im Februar 2001 auch die Forderung nach Einbeziehung Europas in US-amerikanische Raketenabwehrpläne. Nationale Raketenabwehr für die USA, so Schröder, ließe Europa ungeschützt und führe zu einer Abkopplung auf sicherheitspolitischem, technologischem und wirtschaftlichem Gebiet.
Damit vollzog der Bundeskanzler scheinbar einen Schwenk – hatte sich Außenminister Fischer doch zuvor unter Verweis auf die destabilisierende Wirkung wiederholt gegen den Aufbau von Abwehrsystemen durch die USA gewandt. Bei näherer Betrachtung jedoch predigte die Bundesregierung zwar Zurückhaltung, versucht(e) aber selbst, nach Kräften mitzumischen.
Da ist zum einen die Einbindung Deutschlands in die Abwehrpläne der NATO. Unter dem Überbau von C³I (Command, Control, Communication, Intelligence) sollen sich die Pfeiler Gegenproliferation, (nukleare) Abschreckung und erweiterte integrierte Luftverteidigung zur »totalen Verteidigung« zusammenfügen.Hinter dem Stichwort der »erweiterten« Luftverteidigung verbergen sich Systeme zur Abwehr gegen das gesamte Spektrum angreifender Flugkörper, von Flugzeugen über Marschflugkörper bis zu ballistischen Mittelstreckenraketen. Die Vorbereitungsphase für das NATO-System läuft, was vor allem den daran beteiligten europäischen Luft-, Raumfahrt und Rüstungskonzern EADS freut. EADS ist gleichfalls beteiligt an der Entwicklung eines zweiten europäischen Raketenabwehrsystems: An Medium Extended Air Defense System (MEADS) beteiligen sich die USA, Italien – und Deutschland.
Anstatt ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen und die skeptische Beurteilung der Folgen von Raketenabwehr auf die internationale Sicherheit und Stabilität nach außen zu vertreten, ließ sich Rot-Grün widerstandslos in den Sog der Stationierungsbeschlüsse hineinziehen. „Teilhabe an der Technologie“ (Bundeskanzler Gerhard Schröder) wurde eingefordert, herausgekommen ist die Kündigung des Raketenabwehrvertrags und damit der Wegfall eines der wichtigsten Pfeiler des internationalen Rüstungskontrollgebäudes.
Die militärische Dimension Weltraum
Das US-Weltraumkommando strebt unverhohlen die Bewaffnung des Weltraums an. Vergleichsweise bescheiden muten im Vergleich die europäischen oder deutschen Vorhaben an.
„Die Koalition unterstützt aktiv die Bemühungen um den Zusammenschluss der Europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie,“ postuliert der rot-grüne Koalitionsvertrag. In den vergangenen Jahren konnten dabei beträchtliche Fortschritte erzielt werden.
Zur EADS schlossen sich die französische Aerospatiale Matra, die spanische Casa und die deutsche DaimlerChrysler Aerospace (DASA) zusammen.
Auch am zweiten großen Zusammenschluss in Europa ist DaimlerChrysler beteiligt. DASA formte mit der französischen Matra Marconi Space und der britischen BAE Systems den neuen Giganten Astrium.
Und das dritte Konsortium, MBDA, hat sich 2001 durch die Fusion von EADS, BAE Systems und Finmeccanica (Italien) zum zweitgrößten Raketenhersteller gemausert. Meteor, Aster, Exocet, Kormoran, Roland, Milan, Trigat LR, Mistral, Mica, Patriot, Stinger, Otomat, Scalp lauten die Namen der MBDA-Raketentypen. Darüber hinaus baut die Firma Komponenten wie Gefechtsköpfe, Antriebssysteme, Lenkvorrichtungen und Startsysteme für Raketen. Tochterfirmen von MBDA bauen die neue seegestützte Mittelstreckenrakete sowie das auf U-Booten stationierten Langstreckenmodell für die nukleare Force de Frappe in Frankreich.6
Von der deutschen Regierung mit Wohlwollen betrachtet ist in der Tat eine europäische Raumfahrtindustrie entstanden.
Die europäische Raumfahrt ist aber nicht nur industriell zusammengerückt. Im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität sind zunehmend militärische Weltraumkapazitäten gefragt. Die Europäische Union will (militärischen) Zugriff auf Systeme und Fähigkeiten der zivilen European Space Agency (ESA), die laut Satzung „für ausschließlich friedliche Zwecke auf dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen“ gegründet wurde.
Unter der Präsidentschaft der deutschen Forschungsministerin Edelgard Bulmahn beschloss der ESA-Ministerrat, „die Fähigkeiten der ESA auch für die Entwicklung der eher sicherheitsorientierten Aspekte der europäischen Weltraumpolitik einzusetzen,“ wie dies bereits in einem Bericht an das ESA-Direktorium von 1999 gefordert wurde. Vor allem zwei Programme versprechen militärischen (Neben-) Nutzen: das Satellitennavigationssystem GALILEO und das Erdbeobachtungsprogramm GMES (Global Monitoring for Environment and Security).7
Daneben will Deutschland aber auch eigenständig Satellitenaufklärung betreiben. Der licht- und wetterunabhängige Radarsatellit SAR-Lupe, gebaut unter Beteiligung von EADS von der Bremer Firma OHB, soll die vorhandenen optischen Aufklärungssysteme Frankreichs ergänzen, die unter dem Namen Helios bekannt sind. Das länderübergreifende System soll zumindest eine begrenzte Unabhängigkeit von den Daten des US-Militärs herstellen.
Einer ungebremsten Militarisierung wird damit Vorschub geleistet. Ganz richtig erkannte das grüne Wahlprogramm von 1998: „Deutschland soll ferner eine Initiative für die internationale Kontrolle militärischer Fernaufklärungsmittel starten. Diese sind in den Dienst der UNO, der Konfliktprävention und Abrüstungskontrolle zu stellen.“ Das Gegenteil geschieht. In Berlin ist man sich des Problems bewusst, verweist aber darauf, dass Deutschland angesichts der aggressiven Weltraumrüstungspläne der USA nicht untätig bleiben könne, da ansonsten ein uneinholbarer Rückstand entstehe. Diplomatische Initiativen, um den Trend aufzuhalten, sind aus Deutschland nicht bekannt.
Schulter an Schulter ins nukleare 21. Jahrhundert
Lang ist die Liste von Versäumnissen und verpassten Chancen unter Rot-Grün, die sich in das bislang beschriebene Grundraster einfügen. Exemplarisch nur vier Beispiele:
- In den Abstimmungen zu UNO-Resolutionen, die sich mit den Themen Atomwaffen, Raketenabwehr, negative Sicherheitsgarantien usw. befassen, hat sich Deutschland häufig enthalten oder mit »nein« gestimmt. Die offene Unterstützung entsprechender Initiativen lehnt Deutschland ab, glaubt seinen Einfluss vielmehr durch vertrauliche Diplomatie geltend machen zu können. Diese Strategie wurde von Deutschland auch bei der UN-Konferenz zum nuklearen Nichtverbreitungsvertrag im Frühjahr 2002 verfolgt.
- Die dritte und damit entscheidende Betriebsgenehmigung für den Garchinger Forschungsreaktor München II (FRM-II) wurde vom Bundesumweltministerium bislang verweigert. Dass die Planung nach 1998 auf der Basis von hochangereichertem Uran weiter voranschritt, weist auf mangelnden Durchsetzungswillen. Das grüne Wahlprogramm von 1998 hatte noch postuliert: „Der Einsatz von waffenfähigem Uran in Forschungsreaktoren ist hoch problematisch und außenpolitisch bedenklich. Deshalb wird die neue Bundesregierung überprüfen, ob Möglichkeiten einer Umrüstung des Forschungsreaktors München II vom Betrieb mit hochangereichertem auf niedrigangereichertes Uran bestehen.“ Die Möglichkeit hat bestanden – und wurde verschenkt.
- Im August 2000 stellte Siemens einen Antrag auf Überprüfung laut Außenwirtschaftsgesetz, um die Optionen für einen Export der Hanauer MOX-Brennelementefabrik nach Russland auszuloten. Die Bundesregierung hat keine außen- und sicherheitspolitischen Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht. Experten hatten darauf hingewiesen, dass waffentaugliches Plutonium durch die Verarbeitung zu Brennstäben nicht vor Missbrauch zu Waffenzwecken geschützt sei. Der Handel scheiterte nicht an politischem Widerstand, sondern an Geldmangel.
- Deutschland hat nach wie vor keine vollständige Bilanz der atomwaffenfähigen Materialien aufgestellt. Waffenfähiges Uran fehlt in der Aufstellung ganz. Plutonium ist nur insofern berücksichtigt, als es in Deutschland gelagert ist. Damit sind beträchtliche Bestände, die bei der Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernelemente in England und Frankreich anfallen und vor Ort gelagert werden, nicht berücksichtigt.
Durch diese und ähnliche Fehlleistungen werden die wenigen positiven Entscheidungen, beispielsweise die Unterzeichnung des vollständigen Atomteststopp-Vertrags, deutlich überlagert.
Verschärft hat sich die Lage zudem, als sich die deutsche Regierung als Antwort auf die Terrorattacken des 11.September für „bedingungslose Solidarität“ mit dem US-amerikanischen Bündnispartner entschied.
- Eine offizielle Ablehnung der neuen US-amerikanischen Atomwaffendoktrin blieb aus. Die »Nuclear Posture Review« vom Januar 2002 schreibt die Aufrechterhaltung des Nuklearpotentials der USA in weite Zukunft fort, fordert die Bereitschaft zur Wiederaufnahme von Atomwaffentests, empfiehlt die Entwicklung einer neuen, kleineren Atomwaffengeneration, benennt die verlängerte »Achse des Bösen« und erweitert die Einsatzempfehlungen gegen Nicht-Atomwaffenstaaten. Kritik durch die Bundesregierung blieb aus.
- Das Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland, das die Präsidenten Bush und Putin im Mai 2002 unterzeichneten, gesteht beiden Seiten maximal 2.200 strategische Atomwaffen zu. Der Vertrag erhält beiden Ländern die Option auf den mehrfachen Overkill, sieht keine Überprüfungsmechanismen vor, muss erst 2012 erfüllt werden, lässt aber den Ausstieg mit dreimonatiger Kündigungsfrist zu. Die Bundesregierung hat diese Mogelpackung ausdrücklich begrüßt und in ihrer „historischen Bedeutung“ gewürdigt.
- Die NATO erklärte am 6. Juni 2002 die Bereitschaft, ihre Strukturen und Verteidigungsfähigkeiten „zur Durchführung des vollen Spektrums ihrer Aufträge“ an die neuen „asymmetrischen Bedrohungen“ anzupassen. In diesem Zusammenhang maß die nukleare Planungsgruppe der NATO „den in Europa stationierten und der NATO zur Verfügung stehenden Nuklearkräften … weiter großen Wert bei. … Die NATO muss“ nach Ansicht der Verteidigungsminister „für ihre Aufträge über Streitkräfte verfügen, die schnell überall dorthin verlegt werden können, wo sie gebraucht werden.“ Eine Beschränkung der Einsätze auf das Bündnisgebiet ist endgültig nicht mehr vorgesehen. NATO-Generalsekretär George Robertson bestätigte gegenüber Journalisten ausdrücklich, dass die NATO „mit ihrer Konzentration auf den Kampf gegen Terror einen wichtigen Richtungswechsel vollzogen“ hat. Dieser Umformulierung des Bündnisauftrags stimmte die deutsche Regierung ohne öffentliche Debatte oder Befragung des Parlaments ganz nebenbei zu.
Die wenigen Beispiele zeigen: Deutschland ist außen- und sicherheitspolitisch kein eigenständiger Akteur mehr. Entscheidungen werden von den USA oder im Rahmen von EU und NATO getroffen. Ein politischer Wille der Bundesregierung mit anderer Zielrichtung ist nicht in Sicht.
Fazit
In einem Interview kurz nach Amtsantritt meinte Außenminister Fischer: „Die Frage, wozu ein Grüner Außenminister ist, beantwortet sich innerhalb von vier Jahren.“8 Im Bereich Atomwaffen, Raketenabwehr und Weltraumbewaffnung ist er diese Antwort schuldig geblieben.
Die rot-grüne Bundesregierung hat binnen kürzester Zeit jegliche Chance vertan, auf eine Änderung der Atomwaffenpolitik in der NATO, wenn nicht sogar der USA, einzuwirken. Die Rolle von Kernwaffen und die Ersteinsatzdoktrin werden nicht mehr hinterfragt, die Bündnispartner wehren sich nicht gegen die Verschärfung der Atomwaffenpolitik der USA. Dasselbe Bild bei der Raketenabwehr, die zumindest in den Plänen der USA die Bewaffnung des Weltraums mit einschließt. Die deutsche Regierung hat versäumt, eine grundsätzliche Diskussion über dieses aufwendige Rüstungsprogramm zu führen. Anstatt im Bündnis behutsam und klug, aber hartnäckig um Unterstützung zu werben und Einfluss geltend zu machen, tappt das Trio Schröder, Fischer, Scharping blindlings hinter der Führungsmacht her und beteiligt sich selbst an unsinnigen, teuren und destabilisierenden Programmen zur Raketenabwehr.
So verwundert es dann auch nicht, dass aus friedenspolitischer Sicht die Aussagen in den Wahlprogrammen 2002 der beiden Koalitionäre noch hinter der Koalitionsvereinbarung von 1998 zurückbleiben.9 Die Begriffe »Atomwaffen« oder »Raketenabwehr« sucht man dort vergeblich. Im Vergleich dazu klang das Koalitionsvorhaben vor vier Jahren fast schon konkret.Anmerkungen
1) Angelika Beer, Winfried Nachtwei, Christian Sterzig: Friedenspolitischer Aufbruch oder Kapitulation? Zum außen- und friedenspolitischen Teil der Koalitionsvereinbarungen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Arbeitsgruppe Frieden, Abrüstung, Verteidigung, 23. Oktober 1998.
2) Der entsprechende Abschnitt im Bundestagswahlprogramm 1998 von Bündnis 90/Die Grünen, lautet: „Deutschland muss für eine radikale Abrüstung der NATO eintreten: - für Abrüstungsschritte im konventionellen Bereich in Fortführung des KSE-Vertrags; - für den Verzicht auf Atomwaffen; - für den sofortigen Abzug aller Atomwaffen vom Gebiet von Nicht-Kernwaffenstaaten. Deutschland soll eine Entnuklearisierung des deutschen Gebietes beschließen und sich für eine Verschrottung aller Atomwaffen einsetzen; - für die Einbeziehung der nuklearen Potentiale Großbritanniens und Frankreichs in die START-Verhandlungen. Eine Vergemeinschaftung von Atomwaffen, indem z.B. die Verfügungsgewalt über französische und britische Atomwaffen mit anderen EU-Staaten geteilt wird, lehnen wir ab; - für die Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone in Europa unter Beteiligung Deutschlands und eine Festschreibung des Verzichts auf atomare Waffen im Grundgesetz.“ Die SPD begnügte sich dagegen in ihrem Wahlprogramm 1998 mit dem Hinweis, dass „die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung Initiativen … zu einer weltweiten Reduzierung von Massenvernichtungswaffen mit dem Ziel ihrer Abschaffung ergreifen [wird.]“
3) Aufbruch und Erneuerung. Deutschlands Weg in das 21. Jahrhundert, Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD und B’90/Die Grünen, Bonn, 20. Oktober 1998.
4) Das strategische Konzept des Bündnisses, Kommuniqué der North Atlantic Treaty Organisation, 24. April 1999.
5) Otfried Nassauer: NATO’s Nuclear Posture Review. Should Europe end nuclear sharing?, BITS Policy Note 02.1, April 2002,
6) Ausführliche Informationen zu den Geschäftsfeldern von EADS, Astrium und MBDA finden sich in: Group of Ethical Shareholders of EADS, ENAAT (European Network Against Arms Trade), Forum voor Vredesactie und Campagne tegen Wapenhandel, Europe‘s Absolutely Deadly Systems. EADS Ethical Shareholders‘ Report 2002, May 2002.
7) Regina Hagen und Jürgen Scheffran: Weltraum – ein Instrument europäischer Macht?, Wissenschaft & Frieden 3/2001.
8) Fischer: Man kann die Welt nicht nach eigenen Prinzipien gestalten, Interview mit der Frankfurter Rundschau, 25.11.1998.
9) „Wir wollen eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen, denn ihr Einsatz ist durch nichts und in keiner denkbaren Situation ethisch und politisch zu rechtfertigen. Deswegen sind wir für einen bedingungslosen Verzicht auf den Einsatz dieser Waffen und für einseitige Abrüstungsmaßnahmen. Wir treten für eine Stärkung des internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsregimes ein und wenden uns gegen jegliche weitere Aufrüstung mit Massenvernichtungswaffen auf der Erde und im Weltraum. … Für uns als Nichtatomwaffenstaat bleibt die Verhinderung der Weiterverbreitung und die nukleare Abrüstung … ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Politik.“ Grundsatzprogramm von B’90/DIE GRÜNEN, vom März 2002. „Die Fortsetzung einer Politik der Abrüstung und Rüstungskontrolle leistet Beiträge zu einer vorausschauenden Friedenspolitik. Zu einer Weiterentwicklung der vertragsgestützten Abrüstungspolitik gibt es keine Alternative. Das Ziel der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen steht bei uns weiter an erster Stelle. Die Verträge zur Non-Proliferation, das Chemiewaffenübereinkommen, das B-Waffen-Übereinkommen und das Regime der Nichtverbreitung von Trägerwaffentechnologie (MTCR) sind zu stärken. Der START-Prozess muss fortgesetzt und der Atomteststopp-Vertrag (CTBT) ratifiziert werden.“ Regierungsprogramm der SPD 2002-2006.
Regina Hagen ist Koordinatorin von INESAP und aktiv im deutschen Trägerkreis »Atomwaffen Abschaffen – Bei uns anfangen!«.
zum AnfangRestriktivere Rüstungsexportpolitik wäre möglich gewesen
von Michael Brzoska
Noch in der Opposition war für Bündnisgrüne und Sozialdemokraten die Rüstungsexportpolitik der Regierung Kohl ein gefundenes Fressen: Fast jede zweite Woche wurde im Durchschnitt eine Anfrage in diesem Politikbereich eingereicht und immer wieder wurden einzelne Geschäfte, etwa Lieferungen in die Türkei, kritisiert. In den Wahlprogrammen beider Parteien wurde Besserung versprochen. Nach bekannt werden der Koalitionsvereinbarung vom Herbst 1998 machte sich deshalb Enttäuschung breit. SPD und B90/Grüne hatten sich nur auf relativ schwache Aussagen zum Rüstungsexport geeinigt. Keine der beiden Parteien hatte dem Thema besonderes Gewicht beigemessen. Das machte sich schon darin bemerkbar, dass Rüstungsexporte gemeinsam mit der Bundeswehr in einem gemeinsamen Unterkapitel behandelt wurden.
Welche ihrer eher bescheidenen Ankündigungen hat die Bundesregierung nach knapp vier Jahren umgesetzt?
- Das erste Vorhaben der Bundesregierung betraf den im Mai 1998 beschlossenen EU-Verhaltenskodex zum Rüstungsexport. Diesen wollte die Bundesregierung für die transnationale europäische Rüstungsindustrie verbindlich machen.
Dieses Ziel hat die Bundesregierung nicht erreicht, nicht erreichen können. Denn nur einstimmig könnten die Mitgliedsstaaten aus der politischen Absichtserklärung vom Mai 1998, ihre Rüstungsexportpolitik entlang von acht Kriterien stärker zu harmonisieren, ein rechtlich verbindliches Dokument machen. Eine Reihe von ihnen, wie Frankreich und Großbritannien, sind dazu (noch) nicht bereit.
Mit dem Scheitern dieser Ankündigung erübrigte sich auch der Plan der Bundesregierung, für Transparenz und Beachtung der Menschenrechte in den verbindlichen Richtlinien zu sorgen. Aber auch ohne neue Richtlinien hätte sie hier für stärkere Verbesserungen in der EU-Rüstungsexportpolitik sorgen können, was sie jedoch nicht tat. Zentrales Beispiel sind die jährlichen Berichte zum Verhaltenskodex, die nach wie vor wenig transparent sind.
Keine Erwähnung fand in der Koalitionsvereinbarung der »Letter-of-Intent«-Prozess. Im Juli 1998 hatten sich die Regierungen der wichtigsten Rüstungsherstellerländer in der EU (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden, Spanien) verabredet, bei kooperativ hergestellten Waffen einheitliche Rüstungsexportrichtlinien anzuwenden. Das auf dieser Grundlage ausgehandelte »Rahmenabkommen« stellt einen Forschritt gegenüber der vorhergehenden Praxis dar. Unter dem Rahmenabkommen hat jedes Teilnehmerland ein Veto-Recht gegenüber einzelnen Empfängerländern, während früher de facto das Recht des Landes in Anwendung kam, aus dem die Waffe letztendlich ausgeführt wurde. Allerdings ist bisher unklar, wie transparent für Parlamente und die breite Öffentlichkeit die Zusammenarbeit der Regierungen sein wird.
- In einer zweiten Ankündigung versprach die Bundesregierung den deutschen Rüstungsexport außerhalb der NATO und der EU restriktiv zu handhaben. Dies wurde allgemein so verstanden, dass weniger Rüstungswaren ausgeführt werden sollten als in den Jahren zuvor. Ob dieses Ziel umgesetzt wurde, lässt sich schwer beurteilen. Für eine exakte Einschätzung fehlen die grundlegenden Informationen, zum Beispiel zu Ablehnungen von einzelnen Geschäften oder auch wichtige Details zu Genehmigungen. Folgende Informationssplitter liefern ein durchwachsenes Bild:
- In Geldwerten gerechnet ist das Volumen des deutschen Rüstungsexportes in etwa gleichgeblieben. Das aber liegt vor allem am Export von Kriegsschiffen, deren Ausfuhr sowohl vor als auch nach dem Regierungswechsel besonders leicht genehmigt wurde.
- Größter und umstrittenster Importeur deutscher Rüstung blieb die Türkei, ein Nato-Mitgliedsstaat.
- Der deutsche Anteil am weltweiten Rüstungshandel ist leicht gesunken.
- In einige Krisenregionen, insbesondere nach Afrika, sind kaum Exporte genehmigt worden.
- Der Handel mit Kleinwaffen wurde deutlich geringer.
- Besondere Beachtung fand in der Koalitionsvereinbarung die Frage der Menschenrechte, insbesondere auch beim Thema Rüstungsexporte. Der Menschenrechtsstatus sollte als neues Kriterium der Rüstungsexportpolitik eingeführt werden. Dieses Versprechen hat die Bundesregierung in neuen politischen Grundsätzen zum Rüstungsexport umgesetzt, die Anfang 2000 in Kraft gesetzt wurden. Die Regelungen in den neuen Grundsätzen sind stark an die Formulierungen des EU-Verhaltenskodex angelehnt. Danach sind Lieferungen von regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen eingesetztem Gerät an Staaten, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorkommen, nicht genehmigungsfähig. Bei Lieferungen anderer Rüstungswaren in solche Staaten werden „strenge Maßstäbe“ angewandt. Die Interpretationsbreite dieser neuen Bestimmungen zeigte sich mehrfach am Beispiel Türkei. So wurden einzelne Exporte, wie zum Beispiel von Leopard II-Panzern, auch innerhalb der rot-grünen Koalition heftig diskutiert. Eine Entscheidung wurde der Regierung letztlich abgenommen, weil die Türkei die Beschaffung von Panzern angesichts der schlechten Wirtschaftslage im Jahr 2001 aussetzte.
- Ein weiteres Vorhaben war die Vorlage eines jährlichen Rüstungsexportberichtes. Auch diesen Plan hat die Bundesregierung umgesetzt. Ende 2000 wurde der erste Bericht vom Wirtschaftsministerium vorgelegt, Ende 2001 der zweite. In den Berichten legt die Bundesregierung Grundzüge der rechtlichen Lage und ihrer politischen Linie dar. Beide Berichte enthalten auch viele Zahlen, zum Beispiel die Werte der Genehmigungen von Rüstungsexporten und der tatsächlichen Ausfuhr von Kriegswaffen. Bei den Genehmigungen der Rüstungsgüter werden auch die wichtigsten Warenkategorien angegeben. Die Abgrenzung ist jedoch zu grob um wirklich schlussfolgern zu können, um was für Rüstungswaren es sich handelt. Dies ist durchaus beabsichtigt, denn die Bundesregierung sieht sich auf Grund der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Betriebsgeheimnissen außer Stande genauere Angaben zu veröffentlichen. Allerdings interpretiert sie ihren Spielraum sehr eng. Der zweite Bericht enthielt einige neue Zahlen, zum Beispiel zu Kleinwaffen und Exporten gebrauchter Waffen. Aber der Weg zu einer Transparenz der Rüstungsexporte, die eine faktisch fundierte politische Bewertung erlauben würde, ist weit. Letztendlich müsste hierfür das entsprechende Gesetz (Verwaltungsverfahrensgesetz) geändert werden. Aber auch ohne eine solche Änderung könnten die Rüstungsexportberichte informativer werden.
- Indirekt, in ihrem Kapitel über die Entwicklungspolitik, hatte die Bundesregierung eine weitere relevante Ankündigung gemacht: Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sollte Mitglied im Bundessicherheitsrat werden, in dem über strittige Rüstungsexporte entschieden wird. Das Ministerium mit Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul an der Spitze hat diese Stellung rasch zu nutzen gewusst, um neue Gesichtspunkte in die Bewertung von Rüstungsexporten einzubringen. So argumentierte das Ministerium zum Beispiel im Fall der Lieferung von Kriegsschiffen nach Südafrika gegen eine Genehmigung, weil damit Ziele der Entwicklungspolitik gefährdet würden. Allerdings fehlt dem Ministerium der Unterbau, um ähnlich umfassend wie Wirtschaftsministerium oder Auswärtiges Amt über mögliche Empfängerländer informiert zu sein. Es gelang dem Ministerium in den Verhandlungen über die neuen politischen Grundsätze auch nicht, entwicklungspolitische Kriterien wirkungsmächtig zu verankern. Sie sind lediglich zu berücksichtigen, mehr aber auch nicht.
Diese gemischte Bilanz wird oft schlechter bewertet, als sie tatsächlich ist. Denn häufig werden als Maßstab des Erreichten nicht die Koalitionsvereinbarungen, die weitgehend umgesetzt wurden, sondern weitergehende Äußerungen führender Koalitionspolitiker aus ihrer Oppositionszeit benutzt. Auch wurde während der Regierungsperiode von einzelnen Koalitionspolitikern immer wieder der Eindruck erweckt, man werde die Rüstungsexporte drastisch einschränken. Tatsächlich aber blieb die Rüstungsexportpolitik auch innerhalb der Regierung heftig umstritten. Besonders deutlich wurde dies im erwähnten Fall Türkei. Große Teile der SPD hielten daran fest, dass einem NATO-Mitgliedsstaat die Genehmigung für die Lieferung von Panzern nicht verwehrt werden könnte. Bündnisgrüne und eine Minderheit in der SPD hingegen argumentierten, dass die Türkei Menschenrechte verletze, den Nordteil Zyperns völkerrechtswidrig besetzt habe und das Militär nicht unter demokratische zivile Kontrolle stelle. Der Kompromiss war bekanntlich, einen Testpanzer liefern zu lassen, und die Entscheidung über die Lieferung weiterer Panzer erst später zu fällen. Sehr deutlich wurden die Differenzen auch bei der Formulierung der neuen politischen Grundsätze in der zweiten Hälfte des Jahres 1999. Wirtschafts- und Verteidigungsministerium, die keine Modifizierungen wünschten, standen dem Auswärtigen Amt und dem Entwicklungshilfeministerium gegenüber, die grundlegende Änderungen wünschten. Das Kanzleramt agierte als Schiedsrichter und vermittelte einen Kompromiss. Interessant war, dass in diesen Verhandlungen, in die auch Parlamentarier der Koalitionsfraktionen eingebunden waren, die Trennungslinien nicht hauptsächlich entlang der Parteigrenzen verliefen, sondern eher entlang der von Ministerien vertretenen Teilinteressen. Auch bei Einzelentscheidungen war es oft – soweit dies aus dem geheim tagenden Bundessicherheitsrat bekannt wurde – das sozialdemokratisch geleitete Entwicklungsministerium, das am heftigsten für Restriktivität stritt.
Wäre eine restriktivere Rüstungsexportpolitik möglich gewesen? Diese Frage kann eindeutig bejaht werden. In der Koalition waren beispielsweise die Lieferungen von Kriegsschiffen nach Südafrika, Panzern in die Türkei und Panzerbauteilen nach Israel durchaus umstritten. Aber gemessen an den Vorgängerregierungen wurde die Rüstungsexportpolitik restriktiver.
Fazit: Enttäuscht wurden in den letzten vier Jahren vor allem die Hoffnungen derjenigen, die trotz Koalitionsvereinbarung auf eine restriktivere Rüstungsexportpolitik gesetzt hatten.
Dr. Michael Brzoska ist stellvertretender Direktor des Bonner Konversionszentrums (BICC)
zum AnfangVon deklarierter Friedenspolitik zu Kriegseinsätzen
von Tobias Pflüger
Es gibt nur wenige Politikbereiche, in denen es unter Rot-Grün substanzielle Änderungen gegenüber der Vorgängerregierung gab, und dazu gehört interessanterweise die Bundeswehr, die sich von einer Armee mit Hauptaufgabe Landesverteidigung und gelegentlichen Auslandseinsätzen zu einer „Armee im Einsatz“ , so der heutige Generalinspekteur Harald Kujat, entwickelte. Heute, im Sommer 2002, sind über 10.000 Soldaten der Bundeswehr im ständigen Auslandseinsatz. Das Spektrum reicht von sogenannten humanitären Aktionen bis hin zu Kampfeinsätzen (Kommando Spezialkräfte in Afghanistan).
Entscheidend für die Veränderung der Bundeswehr war die Beteiligung am NATO-Angriffskrieg auf Jugoslawien.1 Diese Kriegsteilnahme muss als Grundsatzentscheidung gewertet werden. Es sieht so aus, als wäre auch für die deutsche Armee seitdem der Krieg wieder „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“ An eine Armee, die zur Interessenvertretung auch außerhalb des NATO-Gebietes und u. U. auch noch gleichzeitig an mehreren Orten einsatzbereit sein soll, gibt es aber andere Anforderungen, als an eine Armee, die nur zur Verteidigung des eigenen Territoriums und dem der Verbündeten dient.Trotzdem blieb die Struktur der Bundeswehr nach dem Jugoslawien-Krieg vorerst erhalten, es kam damals nur zu kleinen Veränderungen: Die Gesamtzahl der Bundeswehrangehörigen wurde von 340.000 auf 324.000 korrigiert, die Anzahl der Soldaten der Krisenreaktionskräfte, die als einziges für Kampf- und Kriegseinsätze genutzt werden können und dürfen, wurde von 53.600 auf etwas über 60.000 erhöht.
Später, im Jahr 2001, wurde – so das verbindliche Ressortkonzept – die Zielgröße der Bundeswehr auf 280.000 Männer und Frauen und die Anzahl der neu so benannten Einsatzkräfte auf 150.000 festgeschrieben. Quantitativ wurde also in zwei Phasen reduziert, qualitativ aber aufgerüstet.
Bundeswehr im Auslandseinsatz: Vom Balkan bis zum Hindukusch
„Zugegeben, man verliert schon ein bisschen den Überblick, wo deutsche Soldaten im Kampf gegen den Terrorismus überall im Einsatz sind“, so Andreas Cichowitz am 28.02.2002 in den Tagesthemen der ARD. Deutsche Soldaten befinden sich derzeit in Georgien, Bosnien, Jugoslawien (Kosovo), Mazedonien, Usbekistan, in der Türkei, am Horn von Afrika (vor Somalia), in der arabischen See, im Mittelmeer, in Kuwait, in Bahrein, in Djibouti, in Kenia und in den USA (Florida) – und nicht zu vergessen in Afghanistan (im Rahmen von ISAF und in Kampfeinsätzen).
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr können in drei Kategorien eingeordnet werden: Da sind einerseits die »europäischen« Bundeswehreinsätze in Bosnien (SFOR = Stabilization Force), im Kosovo (KFOR = Kosovo Forces) und in Mazedonien (Fox). Zum zweiten gibt es die Beteiligung der Bundeswehr an der »Schutztruppe« in Kabul und näherer Umgebung (ISAF = International Security Assistance Force). Die dritte Kategorie der Bundeswehreinsätze sind alle Auslandseinsätze im Rahmen von »Enduring Freedom«, dem sogenannten Antiterroreinsatz.
Die »europäischen« Bundeswehreinsätze
Auf dem europäischen Kontinent hat die Bundeswehr derzeit am meisten Bundeswehrsoldaten stationiert.
- Die SFOR-Einheiten sollten als Nachfolgeoperation der NATO-geführten IFOR (Implementation Force) ursprünglich nur von 1996 bis 1998 in Bosnien stationiert bleiben. Stattdessen entwickelte sich dort das erste NATO-Protektorat und damit der erste langfristige NATO-Einsatz. 2002 sind von den ursprünglich 3.000 noch 1.693 Bundeswehr-Soldaten an SFOR in Bosnien beteiligt. Der Großteil der Soldaten sitzt im Lager Rajlovac, dem Sitz des Deutschen Heereskontingentes SFOR, weitere Soldaten finden sich im Außenlager Filipovici, beim Stab in Mostar oder beim SFOR-Hauptquartier in Butmir bei Sarajevo. Das deutsche Kontingent ist Teil der Multinationalen Division Süd-Ost (MND-SE) mit Sitz in Mostar mit Kontingenten aus Frankreich, Italien, Marokko und Spanien. Das Ganze steht unter französischer Führung. An SFOR sind NATO-Staaten und 16 Nicht-NATO-Staaten beteiligt, davon 14 sogenannte PfP-Staaten, also Staaten, die am NATO-Programm »Partnership for Peace« teilnehmen, einschließlich Russland und der Ukraine.
- Als Folge des NATO-Angriffskrieges gegen Jugoslawien wurden im Bereich Kosovo, das formal noch zu Jugoslawien gehört, aber de facto unabhängig bzw. NATO-Protektorat ist, ab dem 12.06.1999 Einheiten der KFOR stationiert. Bis zu 8.500 Bundeswehrsoldaten können bei diesem zweiten langfristigen Einsatz der Bundeswehr auf dem Balkan stationiert werden. Gegenwärtig sind 4.732 deutsche Soldaten im Kosovo.
- Der Einsatz Fox in Mazedonien ist der Folgeeinsatz der Operation »Amber Fox«, der auf den Einsatz »Essential Harvest« folgte, dem NATO-Militäreinsatz, bei dem es offiziell darum ging, 3.000 Waffen von der auch in Mazedonien militärisch agierenden UCK einzusammeln. Im Rahmen von Task Force Fox sind derzeit 615 Soldaten der Bundeswehr in Mazedonien.
Der Einsatz in Afghanistan
Die Bundeswehr hat ca. 1.200 Soldaten im Rahmen von ISAF (International Security Assistance Force) im Einsatz, der »Schutztruppe« für den Großraum Kabul. Seit März 2002 hat sie dort auch die taktische Führung der Multinationalen Brigade Kabul übernommen. Damit stehen circa 4.700 Soldaten aus 18 Staaten unter dem Kommando eines deutschen Brigadegenerals. Der Einsatzradius der ISAF-Truppen ist ausdrücklich auf den Großraum Kabul beschränkt.
Der Einsatz im Rahmen von »Enduring Freedom«
Nach den brutalen Terroranschlägen des 11. September erklärte Gerhard Schröder für die Bundesregierung die „uneingeschränkte Solidarität“ mit den USA im »Krieg gegen den Terror«. Da US-Präsident George W. Bush den »Krieg gegen den Terror« solange führen will, bis alle Terroristen »ausgeräuchert« sind, droht Deutschland mit dieser Zusage in einen permanenten lang anhaltenden Krieg einbezogen zu werden.
Der Bundestag hat dieser »Ermächtigung« zum Einsatz der Bundeswehr am 16. November 2001 unter dem Druck der Vertrauensfrage (für Gerhard Schröder) zugestimmt. Wörtlich heißt es: „Im Rahmen der Operation ENDURING FREEDOM werden bis zu 3.900 Soldaten mit entsprechender Ausrüstung bereitgestellt: ABC-Abwehrkräfte, ca. 800 Soldaten / Sanitätskräfte, ca. 250 Soldaten / Spezialkräfte, ca. 100 Soldaten / Lufttransportkräfte, ca. 500 Soldaten / Seestreitkräfte einschließlich Seeluftstreitkräfte, ca. 1800 Soldaten / erforderliche Unterstützungskräfte, ca. 450 Soldaten… Die Beteiligung mit deutschen Streitkräften an der Operation ENDURING FREEDOM ist zunächst auf zwölf Monate begrenzt… Einsatzgebiet ist das Gebiet gemäß Art. 6 des Nordatlantikvertrags, die arabische Halbinsel, Mittel- und Zentralasien und Nord-Ost-Afrika sowie die angrenzenden Seegebiete… Deutsche Kräfte werden sich an etwaigen Einsätzen gegen den internationalen Terrorismus in anderen Staaten als Afghanistan nur mit Zustimmung der jeweiligen Regierung beteiligen.“
Der Beschluss bedeutet u.a.:
- Eine Aushebelung des »Parlamentsheers«, d.h. der Festlegung, das jeder einzelne Einsatz durch das Parlament beschlossen wird,
- die mögliche Ausdehnung des Einsatzgebietes auf ein Drittel des Globus’
- und der mögliche Rückgriff auf alle Einsatzarten – von sogenannten humanitären Einsätzen bis hin zu Kampfeinsätzen.
Diese »Kriegsermächtigung« wurde Stück für Stück umgesetzt: Heute im Sommer 2002 befinden sich Bundeswehrsoldaten im Rahmen von »Enduring Freedom« an folgenden Orten: Luftwaffenbasis Tampa/Florida (10), Kuwait (50), Afghanistan (92), Mittelmeer (280), Arabische See/Horn von Afrika (820), Bahrein (140), Djibouti (140), Kenia (100).
Von besonderer Brisanz sind hier sicher die 92 Soldaten des Kommando Spezialkräfte bzw. aus den Einheiten der Division Spezielle Operationen in Afghanistan, von denen bekannt wurde, dass sie entgegen der am 16. November mitbeschlossenen unverbindlichen Protokollerklärung an Kampfeinsätzen beteiligt waren. Besonders risikoreich auch die Stationierung von 50 ABC-Abwehrkräften in Kuwait. Über sie sagt Friedrich Merz (CDU): „Alles ABC-Abwehrmaterial ist in Kuwait geblieben, wenn es dort in der Region zu einem Konflikt kommt, ist Deutschland dabei.“2 Das heißt den »ABC-Abwehrkräften« ist eine konkrete Funktion zugeordnet, wenn es zu dem von den USA geplanten Krieg gegen den Irak kommt.
Zusammenfassung
Unter Rot-Grün wurde die Bundeswehr neu ausgerichtet, sie hat sich zu einer Armee im Einsatz entwickelt. Inzwischen sind über 10.000 deutsche Soldaten außerhalb des NATO-Gebietes stationiert. Die Bundeswehr ist dabei, kriegsführungsfähig zu werden und sich im Kernbereich zu einer Interventionsarmee zu entwickeln. Sie hat sich unter Rot-Grün nicht nur an zwei Angriffskriegen beteiligt, sondern in Afghanistan auch an Kampfeinsätzen, bei denen offensichtlich gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen wurde (sie hat Gefangene an US-Truppen übergeben, obwohl diese die afghanischen Gefangenen nicht als Kriegsgefangene behandeln). Eine bittere Bilanz: Kriegseinsätze anstelle der im Koalitionsvertrag formulierten Friedenspolitik.
Anmerkungen
1) Der Jugoslawienkrieg und die deutsche Rolle soll hier nicht Thema sein, deshalb ein Verweis auf das Buch: Der Jugoslawienkrieg, Eine Zwischenbilanz. Hrsg. v. Johannes M. Becker und Gertrud Brücher, Münster, 2001, darin auch mein Beitrag zur Rolle der Bundeswehr im Jugoslawienkrieg.
2) Financial Times Deutschland vom 24.05.2002.
Tobias Pflüger ist Politikwissenschaftler und im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.
zum AnfangTraditionspflege ist Geschichtspolitik
von Jakob Knab
Vor acht Jahren beteuerte der damalige Kanzlerkandidat der SPD, Rudolf Scharping, mir gegenüber: „Für Ihr ausführliches Schreiben zur Praxis der Traditionspflege durch den jetzigen Verteidigungsminister danke ich Ihnen. Ich stimme Ihnen zu, dass dieser Umgang mit der Tradition nicht hingenommen werden darf. (…) Die SPD würde sich nach einer Regierungsübernahme dieser Frage annehmen und dort Änderungen vorschlagen, wo der gültige Traditionserlass missachtet wird.“1
Ein Rückblick auf Rühes »Umgang mit der Tradition«: Sieben Jahre lang hatte die Hardthöhe einen hinhaltenden Abwehrkampf um die Traditionswürdigkeit des Nazi-Generals Dietl geführt. Erst am 9. November 1995 ordnete Rühe die überfällige Umbenennung der »Generaloberst-Dietl-Kaserne« Füssen in »Allgäu-Kaserne« an. Nach dem Regierungswechsel griff dann Staatsminister Michael Naumann mit einem gewaltigen Paukenschlag in die Debatte ein: Am 27. Januar 1999, dem Gedenktag der Befreiung von Auschwitz, erklärte er, dass Namen von Kasernen, die nach Nazi-Generälen benannt sind, umbenannt würden: „Das ändern wir jetzt. Das schwör ich ihnen. In zwei Jahren finden Sie keine mehr.“2
Eine klare Distanzierung von der Wehrmacht auch bei Generalleutnant Willmann, dem damaligen Inspekteur des Heeres: „Die Wehrmacht hat sich zum reinen Ausführungsorgan für das nationalsozialistische Regime entwickelt. Die Führung der Wehrmacht hat Hitler ihre Loyalität immer wieder, manchmal in übertriebenem Maße, bewiesen. Dies führte so weit, dass in der Wehrmacht sogar offensichtlich verbrecherische Befehle gegeben und kritiklos umgesetzt wurden.“3
In der »Willmann-Fibel« wird Feldwebel Erich Boldt als „vorbildlicher Soldat“ vorgestellt. Boldt starb 1961, als er beim Übungssprengen seinen Soldaten das Leben rettete.
Generalmajor Hans Hüttner (1885-1956) ist traditionswürdiger Kasernenpatron der Bundeswehr in Hof an der Saale. An ihm lässt sich die arbeitsteilige Täterschaft von Wehrmacht und Einsatzgruppen aufzeigen. Bei der Eroberung von Shitomir (Ukraine) kämpfte Hüttner an vorderster Front. Auf den Fersen folgten die Mordgesellen der Einsatzgruppe C, die in Shitomir ein Blutbad anrichteten. In den dienstlichen Beurteilungen gilt Hüttner als „überzeugter Nationalsozialist“ und als ein soldatischer Führer, der „vom Nationalsozialismus erfüllt ist“. Am 20. April 1943, an »Führers« Geburtstag, hielt Hüttner in Hof eine Durchhalterede: „Einmal wird auch dieser Krieg siegreich zu Ende gehen und dazu wollen wir allen unserem Führer helfen!“ Es gibt wohl beziehungsreiche Zufälle: Am 30. April 1985, dem 40. Todestag von Adolf Hitler, wurde die »General-Hüttner-Kaserne« in Hof an der Saale eingeweiht.4
Als im Frühjahr 2000 BMVg Rudolf Scharping eine Kaserne suchte, die er nach dem Judenretter und »Gerechten unter den Völkern« Feldwebel Anton Schmid (gest. 1942) benennen könnte, schlug der Führungsstab der Streitkräfte nicht etwa die »General-Hüttner-Kaserne« in Hof (Saale) zur Umbenennung vor, sondern zunächst sollte der Name der »Feldwebel-Boldt-Kaserne« in Delitzsch weichen.5Am 8. Mai 2000 wurde dann die »Rüdel-Kaserne« in Rendsburg mit einer historisch falschen Begründung in »Feldwebel-Schmid-Kaserne« umbenannt. Alle unrichtigen Aussagen zu Rüdel gehen zurück auf diese AP-Agenturmeldung vom März 2000: „Dem Potsdamer Militärgeschichtlichen Forschungsamt zufolge gehörte der bisherige Namensgeber Rüdel als ehrenamtlicher Richter von August 1944 an dem Volksgerichtshof an. Dieser verurteilte mehr als 5000 Menschen.“6
Diese ist aber irreführend. Meine Forschung hat ergeben: Durch Entschließung vom 7. Oktober 1939 ernannte Hitler General Rüdel auf die Dauer von fünf Jahren zu einem ehrenamtlichen Mitglied des Volksgerichtshofes (VGH). General Rüdel nahm im Frühjahr 1940 an einer einzigen Verhandlung des VGH teil; sie endete aufgrund Rüdels Intervention mit einem Freispruch. Es konnte keine weitere Beteiligung General Rüdels am VGH nachgewiesen werden.
Gut gemeinte Vorstöße Scharpings in der Traditionspflege wurden von den Traditionalisten in der Bundeswehr stets ignoriert und blockiert. Bereits im Frühjahr 1999 hatte Scharping Truppe und Stäbe aufgefordert, von sich aus Vorschläge für die Umbenennung von historisch belasteten Kasernennamen zu unterbreiten. Das Ergebnis: kein einziger Vorschlag ging auf der Hardthöhe ein. Auch Scharpings Ansprache vom 20. Juli 2000 im Bendlerblock in Berlin wurde nicht rezipiert. Er hatte diese Soldaten der Wehrmacht gewürdigt: „Der Oberleutnant Albert Battel verhinderte 1942 in Galizien unter Androhung von Waffengewalt eine Mordaktion gegenüber jüdischen Bürgern. Durch die Kriegsereignisse entkam er seiner Verhaftung. Er überlebte und wurde nach dem Krieg in Israel geehrt.
Der Hauptmann Wilm Hosenfeld war Offizier der Besatzungstruppe in Warschau. Aus eigener Initiative versteckte und rettete er verfolgte polnische und jüdische Bürger. Er selbst starb 1952 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft.
Ewald Kleisinger half als Offizier in Warschau verfolgten Juden. Er stellte ihnen Personalpapiere aus und verschickte sie in seine Heimatstadt, wo sie als vermeintlich christliche Fremdarbeiter überlebten. Seine Tätigkeit blieb bis Kriegsende unentdeckt. Auch Kleisinger wurde später als »Gerechter der Völker« geehrt.
Generalleutnant Theodor Groppe, Kommandant einer Infanteriedivision, wagte es Ende 1939, Ausschreitungen gegen Juden unter Androhung von Waffengewalt zu verhindern und offiziell gegen Befehle Himmlers zu protestieren. Er wurde seines Kommandos enthoben und aus dem Dienst entlassen. Nach dem 20. Juli 1944 wurde Theodor Groppe im Zuge der allgemeinen Säuberungswelle verhaftet und er entging dem Tode nur mit knapper Not.“7
Die Bundeswehr hat so ihre Probleme mit dem historisch gebildeten Staatsbürger in Uniform. Offensichtlich ist nicht einmal das historische Datum »22. Juni 1941« auf der Hardthöhe geläufig. Ausgerechnet am 22. Juni 2001 wollten die Traditionalisten der Bundeswehr den »Ball des Heeres« veranstalten. Erst zivile Proteste von außen bewirkten Einsicht beim neuen Inspekteur des Heeres: „Wie erst kürzlich zu erfahren war, muss davon ausgegangen werden, dass dem 60. Jahrestag des Kriegsbeginns zwischen Deutschland und der damaligen Sowjetunionen am 22. Juni 2001 in der Öffentlichkeit und den Medien besondere Beachtung geschenkt wird. Die zeitgleiche Veranstaltung »Ball des Heeres« erscheint mir daher nicht mehr angeraten.“8
Scharping sprach 1994 davon, dass diese „Tradition nicht hingenommen werden darf“, Naumann versprach 1999, dass alle Kasernen, die nach Nazi-Generälen benannt sind, umbenannt würden. Passiert ist – von einer Ausnahme abgesehen – nichts. Diese Kasernen sind immernoch nach Militärs benannt, die beim Angriffs- und Vernichtungskrieg mit dabei waren: General-Hüttner-Kaserne in Hof, Schulz-Kaserne in Munster, Hülsmann-Kaserne in Iserlohn, Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst, General-Konrad-Kaserne in Bad Reichenhall, Röttiger-Kaserne in Hamburg, Peter-Bamm-Kaserne in Munster, Briesen-Kaserne in Flensburg, General-Fahnert-Kaserne in Karlsruhe, General-Henke-Kaserne in Neuwied, General-von-Seidel-Kaserne in Trier, Mölders-Kasernen in Visselhövede und Braunschweig, Schreiber-Kaserne in Immendingen, Medem-Kaserne in Holzminden, General-Heusinger-Kaserne in Hammelburg.
Offensichtlich ist auch die Debatte um die Traditionswürdigkeit des Feldmarschalls von Mackensen ein Tabu: Bei Hitlers Traditionsoffensive 1937/38 war Mackensen zum traditionswürdigen Kasernenpatron gekürt worden. Hier ein Auszug aus seinem Sündenregister: In der Schlacht von Gumbinnen hatte Mackensen in nur zwei Stunden 9000 (Neuntausend) seiner Männer in Tod und Verderben gehetzt. Er selbst sprach von »Massenmord« und »Massenschlächterei«. Den Durchbruch von Gorlice-Tarnow erzwang Mackensen mit Giftgas. Mackensen empfand Genugtuung angesichts der Ermordung Erzbergers: „Den Schädling sind wir los…“ Mackensen verdammte Stauffenbergs Tat als „fluchwürdiges Attentat“. Mitte November 1944 richtete Mackensen einen Aufruf an die Jugend, um vierzehn- bis siebzehnjährige Jungen zu „Opferbereitschaft und Fanatismus“ zu ermahnen. Mackensen hielt bis zuletzt an Adolf Hitler als »Retter« fest. Mackensen ist weiterhin Kasernenpatron der Bundeswehr in Hildesheim.9
Anmerkungen
1) Schreiben Scharpings vom 6. Juni 1994 an den Autor
2) Bonn will mehrere Kasernen umbenennen; in: Süddeutsche Zeitung vom 30. Januar 1999
3) Der Inspekteur des Heeres am 1. Dezember 1999: Wegweiser für die Traditionspflege im Heer, S. 110.
4) Ralph Giordano: Die Traditionslüge. Vom Kriegerkult in der Bundeswehr, Köln 2000, S. 336.
5) Schmid-Kaserne im vierten Versuch, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung vom 20. April 2000.
6) Nach dieser AP-Meldung berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. März 2000.
7) http://www.bundeswehr.de/news/reden/reden_minister/200700.html
8) Schreiben von Generalleutnant Gert Gudera vom 9. April 2001.
9) Theodor Schwarzmüller: Zwischen Kaiser und »Führer«. Generalfeldmarschall August von Mackensen, Paderborn 1995.
Jakob Knab, Kaufbeuren, ist Gründer und Sprecher der »Initiative gegen falsche Glorie«
zum AnfangDer Zivile Friedensdienst
Ein Lichtblick im rot-grünen Tunnel
von Kathrin Vogler
„Mit aller Kraft“ wollte sich die neu gewählte Bundesregierung „um die Entwicklung und Anwendung von wirksamen Strategien und Instrumenten der Krisenprävention und der friedlichen Konfliktprävention bemühen“, so jedenfalls steht es in der Koalitionsvereinbarung von 1998. Der grüne Militärexperte Winfried Nachtwei (MdB) erkannte darin gar die erstmalige Selbstverpflichtung einer Regierung „auf den Primat der Krisenprävention und zivilen Konfliktbearbeitung“, welche sich in einer Vielzahl von Projekten konkretisiere. Im Mittelpunkt seiner Beispielliste stehen hierbei auch die Ausbildung in Peacekeeping und -building, eine zu schaffende Infrastruktur ziviler Konfliktbearbeitung und Friedensfachdienste.1 Damit wollte Nachtwei das Gewicht ziviler Außenpolitik stärken und das Gewicht des Militärischen zurückdrängen.
Im Juni 1999 fiel mit der Verabschiedung eines Rahmenkonzepts für den Zivilen Friedensdienst durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Startschuss für den staatlich mitfinanzierten Friedensfachdienst. Gefordert worden war dieser schon Anfang 1997 von einer Reiher Prominenter unterschiedlicher politischer Couleur in der »Berliner Erklärung«, die auch wesentliche Eckpfeiler eines solchen Dienstes beschrieb. Danach sollte er „in nationalen und internationalen Konflikten mit den Methoden der gewaltfreien Konfliktaustragung (…) dazu beitragen, den Ausbruch von Gewalt zu verhindern oder zu beenden oder nach gewaltsamen Konflikten Prozesse der Versöhnung in Gang zu setzen.“ 2
Dafür sollten Friedensfachkräfte in mehrmonatigen Ausbildungsgängen geschult und in subsidiärer und pluraler Trägerschaft durch Nichtregierungsorganisationen mit staatlicher Unterstützung eingesetzt werden. Vorgearbeitet hatte hierfür bereits die Landesregierung NRW mit dem von ihr finanzierten und von Friedensorganisationen unter Federführung des Forum Ziviler Friedensdienst (ZFD) und der AGDF gestalteten viermonatigen Ausbildungsgang zur »Friedensfachkraft«.
Können Deutsche Frieden schaffen?
Aus einzelnen Friedensgruppen gab es deutliche Kritik an den ZFD-Plänen, zumal wenn es um Einsätze in Ex-Jugoslawien ging. Die Deutschen seien mitverantwortlich für den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien und schon deswegen nicht geeignet für einen Zivilen Friedensdienst in diesem Gebiet; für eine Friedensbewegung, die nicht fähig sei, „die Regierung des eigenen Landes von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg abzuhalten“ könne der ZFD im Ausland zur Ausweichmöglichkeit werden und von der Bundesregierung könne er als ziviles Alibi für die weitere Militarisierung der Außenpolitik missbraucht werden. Das Projekt wurde als elitär zurückgewiesen, da es den Opfern westlicher Kriegführungspolitik unterstelle, sie seien unfähig im Umgang mit Konflikten. Ganz grundsätzlich wurde auch die Berechtigung von NROs zu humanitären Einsätzen in Kriegsgebieten infrage gestellt: „Die zivilmilitärische Zusammenarbeit der Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs) gehört als Begleitprogramm zur militärischen Intervention. (…) Die Rolle von Cap Anamur im Jugoslawienkrieg war beispielhaft. Ohne deren Organisation der Flüchtlingsunterbringung und Verteilung der Flüchtlinge in die von NATO-Soldaten vorbereitete Lager wäre eine Bombardierung des Kosovo von der Dauer und in diesem Umfang nicht möglich gewesen. In dieser militärischen Zusammenarbeit werden auch in der Zukunft – zumindest teilweise – die Aufgaben des Zivilen Friedensdienstes liegen.“3
ZFD fördert nicht die NATO
Aus der Erfahrung der vergangenen drei Jahre können diese Einschätzungen nicht bestätigt werden. Der Zivile Friedensdienst ist kein NATO-Ergänzungsbausatz. Im Gegenteil: Er fördert – wenn auch in kleinem Rahmen – friedenspolitisch sinnvolle Projekte, die sich weder anmaßen, den von Krieg betroffenen Menschen die deutsche Weltsicht aufzuzwingen, noch sich der eigenen Verantwortung an Gewaltzuständen entziehen. Einige Projekte sind eingebunden in friedens- oder entwicklungspolitische Zusammenhänge in Deutschland, die Erfahrungen der Friedensfachkräfte fließen über Berichte, Veröffentlichungen und Veranstaltungen zurück in die deutsche Öffentlichkeit und tragen hier zu einer notwendigen Sensibilisierung bei. Zivile Friedensdienste in unterschiedlicher Form existieren inzwischen in vielen weiteren europäischen Staaten, sie beginnen sich zunehmend zu koordinieren und zusammenzuarbeiten. Diese positiven Entwicklungen basieren auf dem Engagement von NROs; sie können durch staatliches Handeln behindert oder gefördert, aber nicht ersetzt werden.
Auf Drängen der Trägerorganisationen sind einige Defizite der Anfangszeit inzwischen behoben worden. So werden heute auch Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten im Rahmen des ZFD ins Ausland entsandt. Eine wesentliche antimilitaristische Kritik war, dass keine ZFD-Projekte fürs Inland geplant seien. Inzwischen bildet das Forum ZFD die ersten Friedensfachkräfte für den Einsatz im Inland aus. Die Finanzierung ihrer Einsätze ist allerdings nicht klar, da sie nicht in die Zuständigkeit des BMZ fallen und nicht den bisherigen Fördergrundsätzen entsprechen.
Langsamer Start
Das größte Problem des ZFD nach drei Jahren ist aber sein geringer Umfang. Die wenigen Friedensfachkräfte im Einsatz können weder belegen, dass ihre Arbeit dem Ziel gewaltfreier Konfliktbearbeitung nutzt, noch können sie in Deutschland wirklich als positive AkteurInnen wahrgenommen werden und damit politisch gegen die Militarisierung der Außenpolitik wirken. Zu sehr sind sie mit ihren anspruchsvollen Aufgaben im Einsatzland beschäftigt, zu isoliert sind die durchschnittlich drei Friedensfachkräfte pro Einsatzland.
Heute, am Ende der Legislaturperiode, befinden sich nach offiziellen Angaben über 100 zivile Friedensfachkräfte in 38 Projekten und 32 Ländern im Einsatz. Von Null auf 100 in drei Jahren – sollte diese Beschleunigung charakteristisch für die Durchzugsstärke der rot-grünen Regierung sein, wenn es darum geht, „den Primat der Krisenprävention und zivilen Konfliktbearbeitung“ in die politische Praxis einfließen zu lassen, gibt es tatsächlich wenig Anlass für Begeisterung. Wie gering der rote wie der grüne Mainstream selbst die Erfolge auf diesem Sektor werten, erschließt sich aus den entsprechenden Passagen der aktuellen politischen Äußerungen. Der Zivile Friedensdienst taucht im Wahlprogramm der SPD nur mit einem Satz, bei den Grünen gar nicht auf. Das Projekt ist für die SPD einfach noch zu klein und zu unspektakulär, um für Vereinnahmungsversuche interessant zu sein. Für die Grünen hat es den entscheidenden Schönheitsfehler, nicht im Außenministerium angesiedelt zu sein. Diese Konstellation ist vielleicht ein großes Glück für den ZFD, dem so propagandistische Umarmungen durch den Außenminister und politisch motivierte Einmischungen in die Projekte weitgehend erspart blieben. Ein »wirksames Instrument« ziviler Konfliktaustragung ist der ZFD allerdings noch nicht. Dazu bedarf es einer dauerhaften Absicherung und einer erheblichen Ausweitung der Projekte.
„Damit der Zivile Friedensdienst über die Graswurzelebene hinaus stärker regional wirksam werden kann, sollte in den nächsten vier Jahren das Potenzial an Friedensfachkräften von 100 auf 500 gesteigert werden. Das muss einhergehen mit einer schrittweisen Steigerung der Projektförderung.“4 Dieser Forderung des Abgeordneten Nachtwei, der sich damit einer Initiative des Forum ZFD anschließt, bleibt noch hinzuzufügen, dass es nicht allein um Quantität gehen kann. Es geht nicht zuletzt auch um die Frage, welche Projekte zu welchen Bedingungen gefördert werden, und wie die Projekte mittelfristig zu echten multi- oder bilateralen Friedenskooperationen heranwachsen können. Hier sind weiterhin die Friedensorganisationen gefordert.
Alternativen: Zivil oder militärisch, Frieden oder Krieg?
Es geht darum, den ZFD langfristig zu einer echten Alternative zum Militär zu entwickeln und ihn auch in Konkurrenz zum Militär dauerhaft zu finanzieren. Das bedeutet, die zunehmenden Kosten des ZFD müssen auch durch Umverteilung aus dem Bundeswehrhaushalt finanziert werden, statt auf Kosten wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Nur dann kann der ZFD auf Dauer den Anspruch verwirklichen, mehr zu sein als eine gewaltfreie Ergänzung einer durch und durch gewalttätigen und einseitig interessengeleiteten Politik. Diese Perspektive bleibt allerdings bei allen aktuell vorstellbaren politischen Konstellationen Zukunftsmusik.
„Außenpolitik, die ihren Anspruch von Friedenspolitik auch in der Praxis bestmöglich einlösen will, braucht neue und erweiterte zivile Fähigkeiten. Verglichen mit einer enorm kostspieligen militärfixierten Sicherheitspolitik sind die dafür notwendigen Friedensinvestitionen ausnehmend preisgünstig und erfolgversprechend.“5 Genau deswegen findet der ZFD auch zunehmend Anhänger bei CDU/CSU und FDP. Auf dieser pragmatischen Ebene liegen seine großen Chancen in den nächsten Jahren, denn die Begehrlichkeiten der Militärs und die »Bündnisanforderungen« der USA sind von den europäischen Ländern nicht finanzierbar, ohne erhebliche soziale Spannungen zu riskieren. Mögliche Vereinnahmungsversuche durch die Regierungsparteien (welche auch immer dies nach dem 22. September sein mögen) sollten PazifistInnen und AntimilitaristInnen nicht davon abhalten, den Zivilen Friedensdienst zu unterstützen, zu verbreiten, kritisch zu begleiten und für ihre Ziele zu nutzen.
Es gibt viel Dunkel im rot-grünen Tunnel. Dies hier ist wenigstens ein Lichtblick.
Anmerkungen
1) Winni Nachtwei: Replik auf die Gemeinsame Erklärung von Friedensorganisationen, 05.11.1998, www.friedenskooperative.de/themen/lobby_05.htm
2) »Berliner Erklärung für einen Zivilen Friedensdienst«, u.a. unterzeichnet von Hildegard Hamm-Brücher, Hans Koschnik, Manfred Stolpe, Rita Süßmuth, Hans-Joachim Vogel, Antje Vollmer
3) Ralf Cüppers, Siglinde Neher: »Out of area in Zivil« – neu gelesen. www.bundeswehrabschaffen.de o.J.
4) Winfried Nachtwei: Gewalt verhüten – Frieden fördern: Rotgrüne Beiträge zur zivilen Konfliktbearbeitung, April 2002
5) Ebd.
Kathrin Vogler ist Geschäftsführerin beim Bund für Soziale Verteidigung (Minden)
zum AnfangTerroristenhysterie zum Demokratieabbau genutzt
von Heiner Busch
„Die Anschläge vom 11. September haben es deutlich gemacht: Gegen die neue Dimension des Terrors braucht es wirksame neue Massnahmen.“ Dieser Satz findet sich nicht etwa in einer Rede des Bundesinnenministers, sondern in der »Bilanz grüner Regierungsarbeit«.1 Es ist der erste im Kapitel »Innenpolitik«. Die Partei, die sich selbst als »Bürgerrechtspartei« deklariert, versucht dort ganz im Stil und in der Werbesprache einer modernen etablierten Partei den »Grünfaktor« zu erklären: „Was zur Bekämpfung von Terroristen notwendig ist, wird getan. Deutschland bewegt sich jedoch nicht in Richtung Polizei- und Überwachungsstaat.“ Die schlimmsten Pläne des Koalitionspartners habe man abgewendet: Dank der Grünen gebe es keinen Ausbau des Bundeskriminalamts (BKA) zu einem „deutschen FBI mit geheimdienstlichen Befugnissen“ und keine Fingerabdrücke in Pässe und Personalausweise.2 Stimmt: Nicht das BKA ist der Hauptgewinner des »Terrorismusbekämpfungsgesetzes«, sondern die Geheimdienste. Statt des Fingerabdrucks wird es biometrische Daten in den Ausweisen geben. Das Ausländerzentralregister wird ausgebaut – mit vollem Zugriff für Polizei und Dienste. Mit dem Asylgeheimnis ist es faktisch vorbei, weil die Asylbehörden von sich aus Terrorismus-Verdächtige an Polizei und Dienste melden sollen. Das Sozialgeheimnis wird für Rasterfahndungen durchlöchert. Das Ausländerrecht wird verschärft, aber nicht ganz so scharf wie Schily es wollte. Die Kronzeugenregelung wird zwar (vorerst) nicht wieder eingeführt, Ende April aber beschloss der Bundestag eine Ausweitung des § 129a des Strafgesetzbuches – Unterstützung einer terroristischen Vereinigung – auf Vereinigungen im Ausland. Zu den rechtlichen Anti-Terror-Paketen kommt ein finanzielles von insgesamt drei Milliarden DM, davon 500 Millionen für das Bundesinnenministerium (BMI) und seine nachgeordneten Stellen (Bundesgrenzschutz – BGS, Bundeskriminalamt – BKA, Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV etc.) sowie 50 Millionen für den Bundesnachrichtendienst (BND).3 Von den vielen geschluckten Kröten ist in der grünen Bilanz nicht die Rede.
Die SPD hatte sich über Jahrzehnte an der Allparteien-Koalition der Inneren Sicherheit beteiligt – nicht nur während der sozialliberalen Koalition, sondern auch nach der »geistig-moralischen Wende« Kohls. SPD-Landesinnenminister regierten in Bundesländern, deren Polizeigesetze sich kaum von denen der konservativ regierten unterscheiden. Sie regierten mit in der Innenministerkonferenz, die einen grossen Teil der Entscheidungen in Sachen Polizei und Geheimdienste für die Parlamente vorkaut. Die SPD stellte lange Zeit die Mehrheit im Bundesrat und hat dort an vielen Gesetzesprojekten (etwa den Geheimdienstgesetzen oder dem Ausländergesetz) mitgewirkt. Und sie hat – trotz Sperrminorität – zwei verheerenden Verfassungsänderungen unter der Regierung Kohl zugestimmt: Der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1993 und dem Grossen Lauschangriff 1998. Noch Ende Juli 1998 – mitten in der heissen Wahlkampfphase – hatte die SPD ein Positionspapier zur Inneren Sicherheit vorgelegt, das einmal mehr die „gestiegene Kriminalitätsbelastung“ wiederkäute.4 Für einen grundrechtlich motivierten Schwenk der Partei gab es wahrlich keine Anzeichen.
Dass auf innen- und justizpolitischem Gebiet für sie nichts zu holen war, hatte die Spitze der Grünen Partei offenbar schon bei den Koalitionsverhandlungen akzeptiert. Das Kapitel Innenpolitik trägt deutlich die Handschrift der SPD. Das zeigt sich zu allererst an der »Leitlinie«, die man von Tony Blairs New Labour übernommen hatte: „Entschlossen gegen Kriminalität, entschlossen gegen ihre Ursachen.“5 Die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs ohne wenn und aber hatte die Politik der alten Regierung gekennzeichnet, sie sollte bis auf Ausnahmen auch die Leitlinie der neuen sein. Und zwar nicht nur hinsichtlich der organisierten Kriminalität, sondern auch bei der Kleinkriminalität: „Alltagskriminalität“ sei „konsequent aber bürokratiearm zu bestrafen.“ Die Förderung der »Wiedergutmachung« und des Täter-Opfer-Ausgleichs waren allenfalls Beiwerk. An eine Entkriminalisierung z.B. des Ladendiebstahls war nicht zu denken. Einziger Lichtblick war der pragmatische Schwenk in der Drogenpolitik hin zur kontrollierten Abgabe von Heroin an Schwerstabhängige. Die Modellprojekte begannen im Frühjahr 2002 mit bundesweit 1.120 Abgabeplätzen (gegenüber derzeit 3.000 in der Schweiz).6
Kontinuität ebenso bei der »Prävention«, die auch für die neue Regierung vor allem mit repressiven Mitteln und Kontrolle betrieben werden sollte: „Wir werden Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie kriminalpräventive Räte nachhaltig unterstützen.“ Das hieß nichts anderes, als an dem von Kanther propagierten »Sicherheitsnetz« weiter zu häkeln. Mit 13 Bundesländern schloss der BMI als BGS-Dienstherr seit 1998 solche Partnerschaften, Ende 2000 auch mit der Deutschen Bahn: Private Sicherheitsdienste und BGS-Bahnpolizei machen dort gemeinsame Sache.7
Dass am allgemeinen Ausbau des Systems der Inneren Sicherheit nicht gerüttelt würde, ergab sich aber nicht nur aus den Aussagen, sondern erst recht aus den Leerstellen der Koalitionsvereinbarung. Hier einige Beispiele:
- Aussagen zur Schleierfahndung – unter Kanther im BGS-Gesetz verankert – sucht man dort vergebens. Aus den seither erschienenen BGS-Tätigkeitsberichten geht hervor, dass sie ausgebaut wurde.
- Die strategische Überwachung durch den »elektronischen Staubsauger« des BND war mit dem Verbrechensbekämpfungsgesetz von 1994 ausgedehnt worden. In der Koalitionserklärung wurde sie nicht erwähnt; seit der G-10-Gesetz-Änderung – in Kraft seit Juni 2001 – darf der BND nicht nur die über Satelliten gesteuerte, sondern auch die leitungsgebundene Telekommunikation durchfiltern.
- Zur Beschränkung der exzessiven Telefonüberwachung (TÜ) steht nichts in der Koalitionsvereinbarung. Das vom Justizministerium beim Freiburger Max-Planck-Institut in Auftrag gegebene Gutachten, mit dem die Praxis der TÜ überprüft werden sollte, ist noch immer nicht veröffentlicht. Die Zahl der Überwachungsanordnungen ist dagegen weiter gestiegen. Die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die die Anbieterfirmen zur Aufbewahrung von Verbindungsdaten zwingt, war unter der Regierung Kohl gescheitert, Rot-Grün brachte sie Anfang 2002 modifiziert über die Bühne. Mit dem Anti-Terror-Gesetz haben nun auch die Geheimdienste Zugang zu diesen Daten.
- Die DNA-Profildatei war unter Kanther mit grossem populistischem Aufwand durchgebracht worden. „In den letzten Jahren“, so lobt sich das BMI, sei sie massiv gewachsen „von einigen hundert auf inzwischen 164.000 Datensätze (Dezember 2001).“ 8
- Demonstrationsrecht: Die Koalitionsvereinbarung enthielt keine Aussagen über eine Rücknahme des Vermummungsverbots. Kurz vor der Fußball Europa-Meisterschaft im Sommer 2000 verabschiedete der Bundestag eine Passgesetzänderung: Hooligans sollten mit Passbeschränkungen belegt werden können. Die Regelung wird mittlerweile ausgiebig gegen DemonstrantInnen angewandt. Betroffen sind insbesondere Personen, die in den im Januar 2001 eingerichteten »Gewalttäter-Dateien« des BKA erfasst sind. Verurteilungen sind dafür nicht nötig.9
Auch auf europäischer Ebene setzte die rot-grüne Regierung die Politik ihrer konservativen Vorgängerin nahtlos fort. Am 22. April 1999, neun Tage bevor mit dem Amsterdamer Vertrag die Schengen-Kooperation formal in die EU-Strukturen eingegliedert wurde, trat die deutsche Schengen-Präsidentschaft mit einer Note an ihre Partner heran: Das Schengener Abkommen sollte – nunmehr vom Rat der Innen- und Justizminister – überarbeitet werden. Zu erweitern wären insbesondere die grenzüberschreitenden verdeckten Ermittlungsmethoden. Wie das geschehen sollte, demonstrierte das BMI fünf Tage später in einem Vertrag mit dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz, in dem die grenzüberschreitende Observation und der Austausch von verdeckten Ermittlern selbst für präventive Zwecke erlaubt werden. Das – so heisst es seitdem – sei das Muster für weitere Verträge auch im Rahmen der EU.
Auf das deutsche Konto gehen weiter Vorschläge einer EU-Grenzpolizei oder einer EU-Bereitschaftspolizeitruppe, mit der dann u.a. Gipfeltreffen wie in Göteborg oder Genua zu schützen seien. Das BMI brüstet sich in seinem »innenpolitischen Bericht« mit seinem Beitrag zur Neukonzeption des Schengener Informationssystems (SIS2), das dann in Zukunft auch Daten über »violent troublemakers« enthalten soll.10Insgesamt betrachtet, wird man am Ende der Legislaturperiode nicht einmal behaupten können, die rot-grüne Koalition habe anfänglich gemachte Versprechungen nicht eingehalten. Denn tatsächlich war in der Koalitionsvereinbarung das Versprechen einer anderen, an den Grundrechten orientierten Innen- und Justizpolitik, an einem Rückbau der ausufernden Befugnisse und der tatsächlichen Macht von Polizei und Geheimdiensten, nicht enthalten. Ein zukünftiger Bundesinnenminister Beckstein wird keinen Lichtschalter umlegen müssen.
Anmerkungen
1) Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion: Hätten Sie’s gewusst? Bilanz grüner Regierungsarbeit 1998-2002, Berlin März 2002, S. 12
2) ebd.
3) siehe Andrea Böhm: Anti-Terror-Programm des Bundes, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 70, Nr. 3 2001, S. 19
4) Den Rechtsstaat stärken – den Inneren Frieden wahren – die Innere Sicherheit gewährleisten. SPD-Positionspapier zur Inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland, Juli 1998
5) Frankfurter Rundschau 22.10.1998
6) Süddeutsche Zeitung 28.2.2002
7) Innenpolitik Spezial: Innenpolitischer Bericht 1998-2002, S. 18f (Sonderausgabe der vom BMI herausgegebenen Zeitschrift Innenpolitik)
8) ebd., S. 14
9) siehe detaillierter Olaf Griebenow/ Heiner Busch: Nach Göteborg und Genua, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 69, Nr. 2/2001, S. 63-69; Burkhard Hirsch: Rechtlos durch geheime Staatsdatei, in: Grundrechte-Report 2002, Reinbek 2002, S. 50-58
10) Innenpolitik Spezial a.a.O. (Fn 7), S. 17
Heiner Busch ist im Arbeitsausschuss des Komitees für Grundrechte und Demokratie