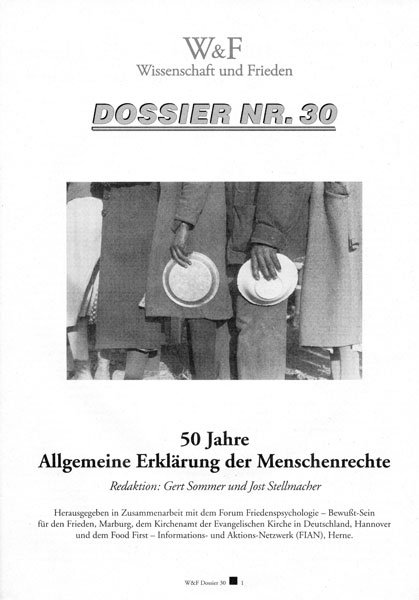50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
von Gert Sommer / Martin Quack und Katharina Wegner / Monika Gerstendörfer / Herbert Leuninger / Andrea Gourd / Lothar Müller
zum AnfangDie Menschenrechts-Charta der Vereinten Nationen
von Gert Sommer
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10.12.1948 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen ohne Gegenstimmen angenommen (48 pro-Stimmen, 8 Enthaltungen). Diese Allgemeine Erklärung ist eines der bedeutsamsten Schriftdokumente der Menschheitsgeschichte: Die damals in den Vereinten Nationen vertretenen Länder haben sich darin auf einen erstaunlich umfassenden Katalog von unveräußerlichen Menschenrechten geeinigt, die für alle Menschen gelten sollen, unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Religion usw. Mit der Allgemeinen Erklärung sind für die nationale und internationale Politik wichtige verbindliche Ziele festgelegt worden:
„… proklamiert die Generalversammlung diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereich ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung… zu gewährleisten.„ (Präambel der Allgemeinen Erklärung).
Die Menschenrechte können sehr pauschal inhaltlich folgendermaßen zusammengefasst werden: Gerechtigkeit, gleiche Rechte und Fehlen von Gewaltanwendungen; individuelle Freiheiten und politische Teilnahme; wirtschaftliche und soziale Sicherheit sowie kulturelle Teilhabe.
Zu den Menschenrechten gehören also das grundlegende Recht auf Leben und weitere bürgerliche und politische Menschenrechte (im folgenden meist abgekürzt als »bürgerliche Rechte«) wie z.B. Asylrecht, Meinungs- und Informationsfreiheit, Verbot von grausamer Behandlung (vgl. Kasten).
Art. 1 legt die humanistisch-philosophische Grundlage für die folgenden Rechte mit dem Hinweis, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren seien. Art. 3 ist ein erster allgemeiner Grundstein, da er das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person thematisiert – die Grundlage für alle anderen Rechte.
Zu den Menschenrechten gehören zudem die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rechte (im folgenden meist »wirtschaftliche Rechte«) wie z.B. Recht auf Arbeit, Schutz vor Arbeitslosigkeit, Anspruch auf ausreichende Lebenshaltung (einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung), Recht auf Bildung. Dementsprechend ist Art. 22 der zweite allgemeine Grundstein der Allgemeinen Erklärung, da er die im einzelnen folgenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte benennt. Bei der Realisierung wird auf innerstaatliche Maßnahmen und auf nationale Zusammenarbeit hingewiesen. Gleichzeitig enthält dieser Artikel auch eine gewisse Relativierung bzw. zeigt die Grenzen auf, da – dies ist selbstverständlich – die Ressourcen jedes Staates bei der Realisierung dieser Rechte berücksichtigt werden müssen.
Die UNO Menschenrechts-Charta
Die zunächst unverbindliche Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bekam eine größere völkerrechtliche Verbindlichkeit durch die zwei Menschenrechtspakte des Jahres 1966 (»Zwillingspakte«: »Pakt über bürgerliche und politische Rechte« sowie »Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte«), die inhaltlich weitgehend mit der Allgemeinen Erklärung übereinstimmen. In den beiden Pakten wird zusätzlich explizit ein Selbstbestimmungsrecht aller Völker aufgeführt und deren freie Verfügung über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel. Andererseits wird das Asylrecht in den beiden Pakten nicht mehr erwähnt.
Die Präambel sowie die Artikel 1, 3 und 5 der beiden internationalen Pakte sind weitgehend identisch. Hier wird die Aussage „Frei von Furcht und Not„ wörtlich übernommen und es wird auf die gleiche Berechtigung von bürgerlichen und sozialen Rechten verwiesen. Neben der Verpflichtung der Staaten wird auch der Einzelne auf seine Verpflichtung hingewiesen, „für die Förderung und Achtung der (Menschenrechte) einzutreten„.
Insbesondere im Zusammenhang mit diesen »Zwillingspakten« von 1966, die bis Ende 1997 von annähernd 140 Staaten unterschrieben und ratifiziert wurden (zusätzlich je 4 Signaturen ohne Ratifizierung; Human Rights. International Instruments. Chart of Ratifications as at 31 December 1997. New York: United Nations), hat sich das Verständnis des Völkerrechts entscheidend verändert: Wenn ein Staat Menschenrechte verletzt oder in seinen Grenzen die Verletzung von Menschenrechten zulässt, dann können andere Staaten es als legitim ansehen, sich in dessen innere Angelegenheiten einzumischen.
Zur UNO-Menschenrechtscharta werden zum einen die Allgemeine Erklärung, zum anderen die beiden Zwillingspakte und schließlich das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 gezählt, der das individuelle Beschwerderecht und die Aufgaben des Ausschusses für Menschenrechte festlegt.
Viele weitere Abkommen – u.a. zu Folter, Skalverei, Rassendiskriminierung, Apartheid, Menschenhandel, Minderheiten, Frauenrechten (vgl. den Beitrag von Gerstendörfer) – sind im wesentlichen Präzisierungen dieser Charta zu Einzelthemen. Es gibt aber auch über die Allgemeine Erklärung hinausgehende bedeutsame Erweiterungen, insbesondere die Konvention über die Rechte des Kindes (1989), den Internationalen Strafgerichtshof (vgl. den Beitrag von K. Wegner) und die Diskussionen um die dritte Generation. Seit einigen Jahren wird in den Vereinten Nationen über eine sogenannte dritte Generation der Menschenrechte diskutiert. Darin geht es um die Rechte auf Frieden, auf Entwicklung und auf eine gesunde Umwelt (vgl. Das Parlament, 24.4.93. Themenheft Menschenrechte; Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 1994, u.a. die dort abgedruckte Weltsozialcharta). Zum Recht auf Entwicklung hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen 1986 eine Resolution angenommen, bei der wiederum die Gesamtheit der Menschenrechte angesprochen wird:
„Artikel 1 (1) Das Recht auf Entwicklung ist ein unveräußerliches Menschenrecht, kraft dessen alle Menschen und Völker Anspruch darauf haben, an einer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung, in der alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll verwirklicht werden können, teilzuhaben…
Artikel 2 (1). Der Mensch ist zentrales Subjekt der Entwicklung und sollte aktiver Träger und Nutznießer des Rechts auf Entwicklung sein.„
Die verschiedenen Menschenrechtsgenerationen haben unterschiedliche Richtungen politischer Forderungen: Bei den bürgerlichen Rechten geht es in erster Linie um Schutzrechte (negative Freiheitsrechte) des Individuums gegenüber der Staatsmacht, bei den politischen um (positive) Teilnahmerechte an politischen Entscheidungen; die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte sind primär Forderungen an den Staat, sie sind Teilhaberechte zur Gewährung angemessener Lebensbedingungen; die bislang nicht verabschiedeten Menschenrechte der dritten Generation schließlich sind Forderungen einzelner Staaten an andere Staaten bzw. die Staatengemeinschaft (zu Dokumentation und Diskussion von Menschenrechten vgl. u.a. Beck, 1992; Bundeszentrale, 1995; Kühnhardt, 1991; Tetzlaff, 1993; United Nations, 1995).
Unteilbarkeit der Menschenrechte
In Reden westlicher Politiker, aber auch in westlichen Medien, wird häufig argumentiert, die wirtschaftlichen Menschenrechte seien keine »richtigen« Menschenrechte, sie seien vielmehr von den damals real-sozialistischen Ländern quasi eingeschmuggelt oder den anderen Staaten aufgezwungen worden. Die Allgemeine Erklärung und die Zwillingspakte sind aber eindeutig in ihrer Aussage, dass sowohl bürgerliche als auch wirtschaftliche Rechte zu den Menschenrechten gehören und dass es unzulässig ist, den einen Teil über den anderen zu stellen oder gegen ihn auszuspielen. Dies ist von den Vereinten Nationen immer wieder bis in die jüngste Zeit betont worden.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete z.B. 1950 eine Resolution, in der es u.a. heißt, dass „der Genuss bürgerlicher und politischer Freiheiten und ökonomischer, sozialer und kultureller Rechte miteinander verbunden und voneinander abhängig sind„ (S. 4; United Nations, 1988; Human rights – The International Bill of Human Rights. Fact Sheet No. 2).
Und es gab auch einen prominenten Zeitzeugen, der diese Zusammengehörigkeit explizit betonte. US-Präsident Franklin D. Roosevelt formulierte in seiner berühmten Jahresbotschaft vom 6. Januar 1941 vor dem amerikanischen Kongress vier Freiheiten für eine künftige bessere Welt: (1) Rede- und Meinungsfreiheit, (2) Glaubensfreiheit, (3) Freiheit von Not (d.h. ökonomische Bedingungen, die jeder Nation ein gesundes Leben für seine BewohnerInnen sichert) und (4) Freiheit von Furcht (d.h. Sicherheit vor militärischen Angriffen).
Menschenrechtsverletzungen auch im »Westen«
Die von den Vereinten Nationen verabschiedeten Menschenrechte beinhalten eine differenzierte, weitgehende Sammlung grundlegender Rechte für ein menschenwürdiges Leben, ausgehend von der „Würde„ und dem „Wert der menschlichen Person„ (Präambel der Allgemeinen Erklärung). Angesichts dieser Menschenrechtskonzeption ist es offensichtlich, dass ihre Verwirklichung wohl nie erreicht werden wird, sondern immer nur angestrebt werden kann „… als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal„, (Präambel).
Somit verletzen alle Staaten permanent Menschenrechte. Bei einigen Staaten ist dies offensichtlich, wenn z.B. Menschen gefoltert und ermordet werden oder wenn keine Meinungsfreiheit oder kein Wahlrecht besteht. Bei anderen Staaten erscheint dies weniger offensichtlich, wenn z.B. Menschen arbeitslos und obdachlos sind. Die Kritik an einzelnen Staaten bezüglich der Verletzung bestimmter Menschenrechte ist somit immer auch ein selektiver, häufig bewusst gesteuerter politischer Akt, ein politisches Kampfmittel; diese Kritik ist häufig stärker von politischer Opportunität geleitet als von der Sorge um das Wohl der Bevölkerung. Durch das Betonen genehmer und das Leugnen oder Herabsetzen nicht genehmer Menschenrechte wird suggeriert, der eigene Staat bzw. die eigene Staatenorganisation sei der wahre Hüter »der« Menschenrechte (Ostermann & Nicklas, 1979, sprechen von »Halbierung« der Menschenrechte; Sommer & Zinn, 1996). Damit wird zur staatlichen und persönlichen Selbstwerterhöhung beigetragen sowie zur Stabilisierung des eigenen gesellschaftlichen Systems.
Da in westlich-demokratischen, hoch industrialisierten Ländern häufig der Eindruck erzeugt wird, diese hätten »die Menschenrechte« realisiert, gebe ich nur einige Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in unseren Ländern.
- Diese betreffen z.B. insbesondere das Recht auf Arbeit und den Schutz vor Arbeitslosigkeit, Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung; das Recht auf soziale Sicherheit, Anspruch auf eine Lebenshaltung, die Gesundheit und Wohlbefinden gewährleistet (in den USA z.B. sind ungefähr 3 Millionen BürgerInnen obdachlos und ungefähr 20 Millionen leiden unter Hunger; vgl. Brown & Allen, 1988); Verbot der Diskriminierung (z.B. fehlende Gleichberechtigung von Mann und Frau; in den USA z.B. Diskriminierung gegenüber Indianern und Schwarzen); Recht auf Asyl (in Deutschland seit dem sog. Asylkompromiss kaum mehr realisiert; vgl. den Beitrag von Leuninger); bedrohte Meinungsfreiheit u.a. durch wirtschaftliche Konzentrationsprozesse (vgl. den Beitrag von Gourd);
- Selbstbestimmungsrecht aller Völker, deren freie Verfügung über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel (Art. 1 der beiden Menschenrechtspakte; dagegen verstoßen z.B. militärische Interventionen und »verdeckte« Operationen der USA in einer Vielzahl von Ländern wie Chile, Grenada, Libyen, Nicaragua; vgl. Hippler 1987; der berühmte US-Sprachwissenschaftler Noam Chomsky sprach angesichts der Geschichte der USA ironisch von der 5. Freiheit, nämlich der „Freiheit zu Raub und Ausbeutung„).
- Schließlich gehören in diese Aufzählungen auch die vielfachen Mithilfen zu Menschenrechtsverletzungen, insbesondere durch die Unterstützung von diktatorischen Regimen, sei dies mit politischen oder wirtschaftlichen Mitteln, durch Polizeihilfe oder Waffenexporte.
- Zu analysieren wäre auch, in welchem Ausmaß die von den führenden Industrienationen wesentlich zu verantwortende Weltwirtschaftsordnung systematisch zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt; als Beispiel seien die Kredite von Internationalem Währungsfond und Weltbank genannt, die üblicherweise von sog. Strukturanpassungsmaßnahmen abhängig gemacht werden. Dazu gehören u.a.
- die Kürzung der Staatsausgaben, die meist zu Kürzungen im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen führen, oder
- die Ausrichtung der Wirtschaft vornehmlich auf Export, was häufig zur Verschlechterung der Versorgung der einheimischen Bevölkerung führt (vgl. den Beitrag von Windfuhr). Hier zeigt sich wiederum die Halbierung der Menschenrechte: Unzureichende Versorgung von Menschen mit Nahrung (bis hin zum Verhungern), Wohnung und Kleidung wird üblicherweise als soziales Problem bezeichnet, nicht aber als konkrete und brutale Menschenrechtsverletzung.
- Zu nennen wäre schließlich die Bedrohung der menschlichen Lebensgrundlagen durch die Gefährdung des ökologischen Systems. So verbrauchen z.B. die Industriestaaten – etwa 25% der Weltbevölkerung – über 80% der Energie, westliche Firmen sind am Raubbau z.B. von Regenwäldern wesentlich beteiligt.
Verwirklichung der Menschen- rechte als permanente Aufgabe
Die Verwirklichung der Menschenrechte ist also eine Aufgabe für alle Menschen und alle Nationen, um eine Kultur des Friedens zu erschaffen. Dazu ist es zunächst wichtig, dass die Menschen über die ihnen zustehenden Menschenrechte informiert werden, was bislang nur unzureichend realisiert ist (Sommer & Zinn, 1996, sowie Sommer, Stellmacher & Christ, 1998, fanden in Untersuchungen, dass außer Meinungs- und Religionsfreiheit kaum weitere Menschenrechte spontan genannt werden konnten; vgl. auch den Beitrag von L. Müller). Es wäre zudem eine wichtige Aufgabe – in Anlehnung an die Berichte von amnesty international zu Menschenrechtsverletzungen an politischen Gefangenen –, für jedes Land der Erde den Stand der Realisierung und Verletzung der Menschenrechte kontinuierlich zu beobachten (vgl. Jongman & Schmid, 1994). Dabei ist das Engagement sowohl von unabhängigen und kompetenten WissenschaftlerInnen als auch von Nichtregierungsorganisationen dringend erforderlich (vgl. Bungarten & Koczy, 1996), da Regierungen aus politischer Opportunität häufig zu einer verzerrten Wahrnehmung und Darstellung neigen. Diese Berichte sollten dann Gegenstand sowohl von innerstaatlichen als auch internationalen Diskussionen sein. Bei den entsprechend diagnostizierten Defiziten wären Agenden für ihre Behebung zu erarbeiten.
Literatur:
Beck-Texte (1992): Menschenrechte. München, Beck.
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (1995): Menschenrechte – Dokumente und Deklarationen. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung.
Brown, J.L. & Allen, D. (1988): Hunger in America, in: Annual Review of Public Health, 9, 503-526.
Bungarten, P. & Koczy, U. (Hrsg.)(1996): Handbuch der Menschenrechtsarbeit. Bonn, Dietz.
Chomsky, N. (1988): Die 5. Freiheit. Hamburg, Argument-Verlag.
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (1994). Bericht über die menschliche Entwicklung 1994. Bonn, DGVN.
Hippler, J. (1987): Low-Intensity Warfare – Konzeption und Probleme einer US-Strategie für die Dritte Welt. Essen, Arbeitspapier des Instituts für Internationale Politik.
Jongmann, A.J. & Schmid, A.P. (1994): Monitoring human rights. Utrecht, PIOOM: Netherlands Instituts for Human Rights.
Kühnhardt, L. (1991): Die Universalität der Menschenrechte. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung.
Ostermann, Ä. & Nicklas, H. (1979): Die halbierten Menschenrechte. Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtsdiskussion, Friedensanalyse Nr. 9. Frankfurt, Suhrkamp.
Sommer, G., Stellmacher, J. & Christ, O. (1998): Die Unteilbarkeit von Menschenrechten: Eine sozialpsychologische Analyse zur kognitiven Repräsentation von Menschenrechten im internationalen Vergleich. Vortrag bei 11. Tagung Friedenspsychologie, Marburg.
Sommer, G. & Zinn, J. (1996): Die gesellschaftliche Halbierung der Menschenrechte: Wissen, Einstellungen und Darstellungsmuster in deutschen Printmedien. Zeitschrift für Politische Psychologie,4, S. 193-205.
Tetzlaff, R. (Hrsg.). (1993): Menschenrechte und Entwicklung. Bonn, Stiftung Entwicklung und Frieden.
Prof. Dr. Gert Sommer, Vorsitzender des Forum Friedenspsychologie (FFP) und der Interdisziplinären Arbeitsgruppe für Friedens- und Abrüstungsforschung an der Universität Marburg
zum AnfangDurchbruch in Rom. Das Statut über die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes
von Martin Quack und Katharina Wegner
Silent leges inter arma – inmitten der Waffen müssen die Gesetze stumm bleiben. Diesen Ausspruch Ciceros zitierte der VN-Generalsekretär Kofi Annan bei seiner Würdigung des neu geschaffenen Internationalen Strafgerichtshofs.
Das soll nun anders werden. Am 17. Juli 1998 hat die Staatenkonferenz der Vereinten Nationen (VN) zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nach fünfwöchiger Verhandlungsdauer in Rom das Statut zum Gerichtshof verabschiedet. 120 Staaten votierten in geheimer Abstimmung für den vom Vorsitzenden des Gesamtausschusses, dem kanadischen Botschafter Kirsch, vorgelegten Kompromissentwurf des Statuts. Gegen diesen »Vertrag von Rom« stimmten die USA, China, die Türkei, Israel und drei weitere Staaten, 21 Länder enthielten sich der Stimme.
Die Gründung des Gerichts mit dem Sitz in Den Haag wurde von Ländervertretern und Nichtregierungsorganisationen (NRO) als historisches Ereignis bezeichnet. VN-Generalsekretär Kofi Annan unterbrach für die Unterzeichnung des Gründungsvertrags eine Südamerikareise und Aussenminister Kinkel sprach von einem „bedeutsamen, ja historischen Sieg„.
Jahrelang haben Staatenvertreter, die Völkerrechtler der VN und die Vertreter der NRO um die genaue Formulierung des Statuts gestritten. Der ausgehandelte Kompromiss enthält folgende zentrale Bestimmungen:
Gegenstand der Ermittlungen
Verfolgt werden, laut der Präambel, die „schlimmsten Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen„. Zur Verantwortung gezogen werden sollen weltweit die Urheber von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Angriffskriegen.
- Als Völkermord gelten nach Art. II der Konvention gegen den Völkermord von 1948 Verbrechen, mit denen „eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise vernichtet„ werden soll.
- Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden definiert als „Teil einer ausgedehnten oder systematischen Attacke„ gegen die Zivilbevölkerung. Dazu gehören Mord, Versklavung, Folter, Vergewaltigung, erzwungene Austragung von Kindern und erzwungene Sterilisation.
- Kriegsverbrechen sind nach dem Statut unter anderem „schwere Verstöße„ gegen die Genfer Konvention von 1949. Dort wird der Schutz der Zivilbevölkerung und die Behandlung von Verwundeten, Kranken und Kriegsgefangenen im Krieg und, in abgeschwächter Form, auch in innerstaatlichen Konflikten geregelt.
- Für den Angriffskrieg wurde keine Definition festgeschrieben; gemäß der Charta der VN stellt der Sicherheitsrat fest, ob ein solcher vorliegt.
Die wichtigsten Organe des Gerichts
- Die Ermittlungen können von der Anklagebehörde unter Leitung der Chefanklägerin bzw. des Chefanklägers selbständig, also von Amts wegen, ohne vorherige politische Konsultationen eingeleitet werden. Die Initiative zu einem Gerichtsverfahren kann auch von einem Vertragsstaat oder vom Sicherheitsrat ergriffen werden.
- Die Anklagebehörde unterliegt der Kontrolle einer Ermittlungskammer mit sechs Richterinnen und Richtern. Sie entscheidet, ob es genügend Anhaltspunkte für eine Strafverfolgung gibt.
- Die Urteile des Gerichts werden von einer Spruchkammermit sechs Richterinnen und Richtern gefällt.
- Zweite Instanz ist die Berufungskammermit fünf Richterinnen und Richtern.
- Kontrollorgan für den IStGH ist die mindestens einmal im Jahr stattfindende Versammlung der Vertragsstaaten, sie beschließt über inhaltliche und Verfahrensfragen.
Die insgesamt 18 Richterinnen und Richter werden von den Vertragsländern für neun Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. Um faire Gerichtsverhandlungen zu garantieren, gelten die folgenden Grundsätze:
Prozessgrundsätze und Gerichtsverfahren
- Prozesse des IStGH finden nur bei Anwesenheit der bzw. des Angeklagtenstatt.
- Es gilt das Rückwirkungsverbot. Danach müssen, damit die Tat geahndet werden kann, Straftatbestände und das Ausmaß der Strafen bereits feststehen, bevor das Verbrechen verübt wird. Der IStGH wird ferner nur bei Straftaten tätig, die nach dem Inkrafttreten des Statuts begangen werden.
- Straftäter sind vor dem IStGH individuellfür ihre Taten verantwortlich, auch Staatsoberhäupter und andere Amtsträger genießen keine Immunität.
- Verurteilte erhalten Gefängnisstrafenvon bis zu 30 Jahren oder, bei besonders schweren Verbrechen, lebenslänglich. Der Gerichtshof kann auch zusätzlich Geldstrafen verhängen und Güter beschlagnahmen. Die Todesstrafe kann nicht verhängt werden.
- Opfernkann das Gericht Entschädigungen zusprechen, Zeugenwird Schutz zugesichert und das Gericht kann Aussagen auf Video zulassen, vor allem, wenn es um Vergewaltigung geht.
Tätigwerden des Gerichts
- Der Grundsatz der Komplementaritätbedeutet, dass der IStGH nur tätig wird, wenn nationale Gerichte zu einer Strafverfolgung nicht willens oder in der Lage sind.
- Im Falle von Kriegsverbrechen durch eigene Staatsangehörige oder auf dem eigenen Territorium steht es einem Unterzeichnerland frei, während einer Übergangsfrist von sieben Jahren die Kompetenz des Gerichts nicht anzuerkennen.
- Tätig werden kann der Gerichtshof auch nur, wenn die Tat in einem Unterzeichnerland geschehen ist oder der Verdächtige die Staatsangehörigkeit eines solchen Landes besitzt. Auf Beschluss des Sicherheitsrates der VN, d.h. mit der Zustimmung der vetoberechtigten, ständigen Mitglieder, entfällt diese Bedingung.
- Der Sicherheitsrat kann unter bestimmten Bedingungen durch Beschluss Gerichtsverfahren für ein Jahr aussetzen. (Das bedeutet aber auch, dass jedes ständige Mitglied mit einem Veto diese Verfahrensverzögerung verhindern kann.) Diese Frist kann verlängert werden.
Finanzierung und Überprüfungskonferenz
Der IStGH soll durch von der Generalversammlung zu genehmigende, allgemeine VN-Mittel, durch Beiträge der Vertragsstaaten und durch Spenden finanziert werden.
Sieben Jahre, nachdem der Gerichtshof seine Arbeit aufgenommen hat, soll eine Überprüfungskonferenz stattfinden, um u.a. eine Definition des Angriffskriegs zu erarbeiten und ggf. den Verbrechenskatalog um Drogenhandel und Terrorismus zu erweitern.
Bis das Den Haager Gericht jedoch seine Arbeit aufnehmen kann, ist es noch ein steiniger Weg. Voraussetzung ist nämlich, dass die Parlamente von mindestens 60 Staaten das Statut ratifiziert haben. Und das kann, auch wenn das Votum bei der Schlusssitzung in Rom eindrucksvoll war und z.B. die Bundesregierung das Ratifikationsverfahren bald einleiten wird, noch Jahre dauern.
Jahrzehntelang und steinig war auch der Weg, der zum »Vertrag von Rom« führte.
Der lange Weg zu einem Internationalen Strafgerichtshof
Seit der Antike haben angesehene Gelehrte von Plato bis Hugo Grotius die Rechtmäßigkeit von Krieg und Kriegsführung diskutiert. Vor mehr als 200 Jahren forderte Immanuel Kant in seiner Schrift »Zum Ewigen Frieden« den Schutz des Friedens und der Menschenrechte durch die Herrschaft des Völkerrechts. Trotz Forderungen nach einem internationalen Strafgericht im letzten Jahrhundert wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegermächten der erste Versuch gemacht, Kriegsverbrecher, vor allem den deutschen Kaiser Wilhelm II., zur Verantwortung zu ziehen. Dieser fand jedoch Zuflucht in Holland, das die Kompetenz eines internationalen Gerichts, ein Staatsoberhaupt anzuklagen, bestritt. Auch die anderen Kriegsverbrecher mussten sich nur vor dem deutschen Reichsgerichtshof verantworten.
Die Notwendigkeit eines effektiveren Systems internationaler Strafjustiz wurde dadurch zwar deutlicher, doch erst die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges führten zu den ersten internationalen Strafgerichten. Bei den Militärtribunalen der Siegermächte 1945 in Nürnberg und Tokio wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, schwere Verstöße gegen das Kriegsrecht sowie das Verbrechen des Angriffskriegs verhandelt. Der Grundsatz der persönlichen Verantwortung, auch von Generälen, Staatspräsidenten und Monarchen, wurde verankert.
Bereits 1947 wurde dann vom Sekretariat der VN ein Entwurf für eine Konvention über ein internationales Straftribunal ausgearbeitet. Aber die 1948 von der Völkerrechtskommission der VN weitergeführten Arbeiten zur Errichtung eines ständigen internationalen Strafgerichtshofs versandeten 1953 im Ost-West-Konflikt.
Erst mit dessen Ende ging wieder eine Initiative vom damaligen sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow aus, der die Schaffung eines Strafgerichtshofs zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus anregte. 1989 schlugen Trinidad und Tobago vor, den internationalen Drogenhandel mit Hilfe eines internationalen Strafgerichtshofs einzudämmen. Diese Anregungen führten 1990 zum Auftrag der VN-Generalversammlung an die Völkerrechtskommission, Entwürfe für die Satzung eines IStGH und eines internationalen Strafgesetzbuchs zu erarbeiten. Im Juli 1994 wurde ein Satzungsentwurf vorgelegt.
Noch während dieser Vorarbeiten wurden im ehemaligen Jugoslawien, bei dem ersten großen militärischen Konflikt in Europa seit Jahrzehnten, massive Menschenrechtsverletzungen verübt. Die Fernsehberichte über misshandelte und verhungernde Gefangene und über Massenvergewaltigungen erregten weltweites Entsetzen. Deshalb setzte der Sicherheitsrat der VN am 25. Mai 1993 zum ersten Mal gemäß Kapitel VII der Charta der VN ein internationales Gericht ein, das Ad-hoc-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. Am 8. November 1994 wurde zur Aufarbeitung der Verbrechen in Ruanda ein weiteres Ad-hoc Tribunal im tansanischen Arusha errichtet. Dies waren entscheidende Schritte auf dem Weg zu einem IStGH. Wesentliche Regelungen dieser beiden Gerichte, z.B. über Verfahrensgrundsätze, dienten als Modell und Praxistest für das Statut des IStGH.
Die Konferenz in Rom
Durch die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda waren so viele Staaten von der Notwendigkeit eines IStGH überzeugt, dass 1996 von der Generalversammlung ein Vorbereitungsausschuss mit der Klärung der offenen Fragen betraut wurde. Dazu wurden Vertreter aller Staaten und auch NRO eingeladen, von denen sich 220 zu einer »Coalition for an International Criminal Court« zusammenschlossen.
Mit zahlreichen offenen Fragen begann am 15. Juni 1998 in Rom die im Dezember 1997 von der Generalversammlung beschlossene Staatenkonferenz. Es gab allein 1.400 Texte in Klammern, über deren Formulierung bis dahin noch keine Einigung erzielt worden war. Für einen starken und unabhängigen IStGH engagierten sich ca. 50 »gleichgesinnte« Staaten –unter ihnen alle EU-Staaten ausser Frankreich –, die von den NRO unterstützt wurden. Ihnen standen auf der anderen Seite die nicht organisierten Gegner eines starken und unabhängigen Gerichtes gegenüber. Dazu zählten vor allem die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates USA, China, Russland und Frankreich und andere Regionalmächte wie Indien und Mexiko sowie Diktaturen wie Libyen, der Irak und Kuba. Die meisten Staaten waren jedoch unentschieden und wurden deshalb heftig umworben.
Die Motive der Gegner
- Regionalmächte wie Indien, Pakistan, Mexiko, Ägypten, Syrien und Nigeria waren besorgt um ihre den Kolonialherren mühsam abgerungene Souveränität und wegen Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land.
- Israel stimmte gegen das Statut, weil Siedlungen in besetzten Gebieten als Kriegsverbrechen gelten.
- Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates wollten mehr Einfluss auf die Arbeit des Gerichts haben, Frankreich stimmte am Schluss jedoch dem Kompromiss zu.
- Indien wiederum lehnte jeden Einfluss des Sicherheitsrates auf den Gerichtshof ab – insbesondere weil dessen Mitglieder USA und China dem Vertrag nicht zustimmten.
- Der wichtigste Gegner, die USA, wollten ein zu mächtiges Gericht verhindern. Sie behaupteten, ihre weltweit eingesetzten Streitkräfte vor Gerichtsverfahren schützen zu müssen. Die Soldaten könnten von gegnerischen Staaten zu Propagandazwecken vor dem Tribunal angeklagt werden, womöglich auch noch vor Richtern, die aus Libyen oder aus dem Irak kommen. Deshalb verlangten die USA eine Vetomöglichkeit. Weiterhin arbeiteten sie auch erfolgreich gegen die Möglichkeit, den Einsatz von nuklearen Waffen auch bei Selbstverteidigung als Kriegsverbrechen anzuklagen. Die USA erklärten, den IStGH nicht anzuerkennen und aktiv gegen ihn zu arbeiten. Der Vorsitzende des Senatsausschusses für auswärtige Politik, der Republikaner Jesse Helms, hält den IStGH für „dead on arrival„.
Der Kompromiss kam erst nach überaus zähen Verhandlungen zustande, und die ganze Konferenz drohte bis zum Schluss zu scheitern. Nach der von den USA verlangten Schlussabstimmung – die Konferenzleitung hätte den Beschluss lieber im Konsens gefasst – waren die Vertreter der meisten Länder und NRO erleichtert, dass der Beschluss doch noch zustande kam. Es bleiben jedoch viele Kritikpunkte:
Kritik am Kompromiss
Besonders bemängelt werden die auf Drängen Frankreichs aufgenommene mögliche Schonfrist bei Kriegsverbrechen und die Möglichkeit der Verzögerung der Verhandlungen durch den Sicherheitsrat. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Definition von Aggression und die Tatsache, dass der Gerichtshof nur dann Fälle an sich ziehen kann, wenn entweder der Staat, in dem das fragliche Verbrechen begangen wurde, oder der Herkunftsstaat des mutmaßlichen Täters das Statut ratifiziert hat.
Beanstandet werden auch die Straflosigkeit des Einsatzes von Kindersoldaten über 15 Jahren und die Möglichkeit Angeklagter, sich auf den Befehlsnotstand berufen zu können. Mit der Behauptung, lediglich Befehle ausgeführt zu haben, ohne zu wissen, dass diese Anordnungen illegal waren, können sie auf Strafminderung hoffen. In einem Fall wie dem des Kriegsverbrechers Mladic könnte diese Klausel problematisch werden.
In dem Verbrechenskatalog fehlen weiterhin die, immerhin diskutierten, Umweltverbrechen, der Einsatz von Atomwaffen und von Landminen. Die Ablehnung des Gerichtshofs durch China und vor allem die USA wird als Geburtsfehler bezeichnet.
Bewertung
Trotz der zahlreichen Kritikpunkte ist die Verabschiedung des Statuts zum IStGH ein großer Schritt auf dem Weg zum Ende der bisherigen weitgehenden Straflosigkeit bei den im Statut aufgeführten Verbrechen. Die starke Unabhängigkeit des Gerichts und vor allem der Anklagebehörde, die vier Verbrechensgruppen und die große Mehrheit bei der Abstimmung erschienen noch vor wenigen Jahren kaum erreichbar. Zum ersten Mal werden Verbrechen innerhalb eines Landes nicht als innere Angelegenheit des betreffenden Landes anerkannt.
Die Überprüfungskonferenz bietet die Möglichkeit, den Verbrechenskatalog zu erweitern und die Fehler des Statuts zu beheben. Deshalb darf der diplomatische und öffentliche Druck auf unwillige Länder, dem Statut beizutreten und den IStGH zu unterstützen, nicht nachlassen.
Die Mitarbeit der USA, der einzigen Supermacht mit weltweiten militärischen Einsatzmöglichkeiten, ist für einen starken IStGH unerläßlich. Leider sind die USA allgemein nicht bereit, sich internationalen Kontrollen zu unterwerfen. Sie betrachten diese als unzulässige Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Die USA sind beispielsweise auch als einer von wenigen Staaten weder der VN-Konvention über die Rechte des Kindes noch der VN-Konvention über die Eleiminierung aller Formen der Diskriminierung von Frauen beigetreten. Die VN werden von den USA politisch und finanziell eher behindert als unterstützt. Schon beim Anti-Minen-Abkommen von Ottawa, in dem der Einsatz, die Lagerung und die Herstellung von Antipersonenminen sowie der Handel damit verboten wurde, stand die Supermacht nahezu allein mit ihrer Ablehnung des Vertrags. Auf der Konferenz in Rom musste sie jetzt die zweite schwere Niederlage auf dem internationalen Parkett binnen eines Jahres einstecken. Auch hinsichtlich der Todesstrafe stehen die USA weiter im Abseits. Es bleibt zu hoffen, dass sie ihre Haltung überdenken und den IStGH bald unterstützen.
Martin Quack, Katharina Wegner (Kirchenrätin), tätig im Menschenrechtsreferat im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Postfach 210220, 30402 Hannover
zum AnfangFemizid: Tödliche Gewalt gegen Frauen
von Monika Gerstendörfer
Tödliche Gewalt gegen Frauen hat Tradition, vielfältige Ursachen und viele Gesichter. Sie wird seit Jahrtausenden systematisch betrieben, im Krieg wie im Frieden. So behauptete schon Aristoteles in seiner Theorie von der Sukzessivbeseelung, dass der männliche Embryo nach 40 Tagen eine Seele besäße, der weibliche jedoch erst nach 80 Tagen. Entsprechend war die Mutter nach der Geburt eines Mädchen 80 Tage unrein, nach der eines Jungen nur 40 Tage lang (vgl. Ranke-Heinemann, 1988). Diese Behauptung von der Unreinheit und Minderwertigkeit von Frauen war und ist ein wesentlicher Faktor für das Zustandekommen des Phänomens »Femizid«.
Heute »fehlen« nach UN-Schätzungen weltweit 60 bis 90 Millionen Mädchen und Frauen (vgl. Klasen, 1993). Die Ursachen sind vielfältig. Beispielsweise wird ein Teil weiblicher Feten mit Hilfe moderner Technologie (z.B. Pränataldiagnostik) abgetrieben; u.a. in Indien, denn Mädchen und Frauen gelten als »teuer« wegen der zu zahlenden Mitgift (vgl. Wichterich, 1994, 1995). Gibt es in einem Land keine Möglichkeit zur Pränataldiagnostik oder sind die Leute arm und können sich eine solche Untersuchung nicht leisten, dann werden die weiblichen Neugeborenen ausgesetzt, misshandelt, getötet oder man lässt sie einfach verhungern. So »fehlen« heute in Indien fast 36 Millionen Frauen (vgl. Klasen a.a.o.).
Auch in China – hier sind es 40 Millionen Frauen, die »fehlen« (a.a.o.) – werden bevorzugt weibliche Feten abgetrieben, denn dort herrscht die staatlich vorgegebene »Ein-Kind-Politik«, die mit brutalen Sanktionen durchgesetzt wird. Wenn Eltern also nur ein Kind bekommen dürfen, dann soll es „wenigstens ein Junge sein„, denn Mädchen werden als „nutzlos und teuer„ angesehen. Dies gilt insbesondere für die ländlichen Gebiete, denn dort bedeuten männliche Kinder zusätzliche Arbeitskräfte. Nur Söhne bieten die Garantie für ein gesichertes Alter und für soziales Ansehen im Dorf. Erbrecht und Konfuzianismus tun ein übriges, um den Druck auf die Frauen zu verschärfen. Wie überall auf der Welt, so lassen auch hier die Männer ihren Unmut über solcherlei staatliche Zwangsmaßnahmen an den Frauen aus. So gibt es in China eine Regelung, nach der ein Ehemann nach einer verordneten Abtreibung sechs Monate keine Scheidung beantragen darf. Trotzdem werden Frauen, die »nur« Mädchen bekommen, oftmals vom Ehemann verstoßen. Wie furchtbar die Situation für weibliche Menschen in China ist, verdeutlicht der Inhalt eines Artikels des chinesischen Gesetzes »zum Schutz von Frauen und deren Interessen« von 1992, der keines weiteren Kommentars bedarf:
„Das Töten, Aussetzen und grausame Verletzen von weiblichen Säuglingen ist verboten. Diskriminierung und Misshandlung von Frauen, die Mädchen geboren haben, ist verboten.„
In vielen Ländern werden die Mädchen nach wie vor schlechter ernährt als die Jungen. Sie müssen hungern, während die Jungen mit genügend Nahrung versorgt werden. Ressourcenknappheit wird hier auf dem Rücken von weiblichen Menschen ausgetragen. Auch das hat Tradition.
Weiterhin trägt die Verhütungs"philosophie« ihren Teil zum Femizid bei: laut UN-Schätzungen gibt es 45 Millionen Abtreibungen pro Jahr, bei denen ca. 70.000 Frauen ihr Leben lassen. In Lebensgefahr sind Mädchen auch in Ländern, in denen die sog. Kinderehe üblich ist. Weibliche Kinder von elf, zwölf Jahren werden mit erwachsenen Männern verheiratet, die meist keine Rücksicht auf den körperlichen und seelischen Entwicklungsstand der Mädchen nehmen und sie in einem Alter schwängern, in dem die Gefahr der Todesfolge sehr hoch ist.
Die moderne Technik hat die alten Rituale und Traditionen keineswegs verdrängt, sondern die Gefahr eines systematisch betriebenen Femizids verschärft. Ein erstes Beispiel ist die pränatale Diagnostik, mit deren Hilfe nicht nur eine genetische Fehlbildung, sondern auch das Geschlecht eines Fetus festgestellt werden kann. Die Geschlechtszugehörigkeit entscheidet dann darüber, ob der Embryo abgetrieben wird oder nicht, und es sind die weiblichen Feten, die abgetrieben werden (vgl. Wichterich, 1994a, b, 1995). Fehlbildungen und weibliche Geschlechtszugehörigkeit werden in vielen Ländern der Erde im Grunde als »synonym« angesehen; beides dient als Grund für eine vorzunehmende Abtreibung.
Ein weiteres Beispiel ist die Reproduktionsmedizin und die dafür entwickelte Technologie. Hier wird deutlich, dass das Frauenbild auch Ende des zwanzigsten Jahrhunderts von Entwertung und Missachtung gezeichnet ist. Schon die verwendete Sprache spricht hier für sich. So wird im Zusammenhang mit der Reproduktionstechnologie von Frauen als „Eispenderinnen„ und sogar als „fötales Umfeld„ gesprochen.
Nicht zu vergessen ist der rassistische Aspekt: Lebensgefährliche Verhütungsmittel werden von großen Pharmakonzernen an den Frauen aus der sog. Dritten Welt getestet, damit die sog. »Bevölkerungslawine« gestoppt werden kann. Es sind zum Teil Mittel, die für Frauen der »Ersten Welt« verboten sind, weil sie lebensgefährliche Risiken bergen (vgl. Wichterich, a.a.O.).
Die Beschreibung der massiven Menschenrechtsverletzungen an Frauen in der heutigen und in der vergangenen Zeit macht klar, dass es Musterähnlichkeiten über alle Formen des Femizids hinweg gibt, nämlich eine Be- bzw. Abwertung weiblichen Lebens.
Das Beispiel Tibet verdeutlicht es: Seit 45 Jahren hält die Volksrepublik China ungestraft und illegal das Land Tibet besetzt. Seit 1985 werden ArbeiterInnen und BäuerInnen vermehrt nach Tibet umgesiedelt. In manchen Gebieten kommen mittlerweile 8 ChinesInnen auf eine TibeterIn. Die illegale Besetzung Tibets ist der politische Rahmen, innerhalb dessen die Menschenrechtssituation der Frauen in Tibet zu beschreiben ist (vg. Drongshar, 1993, 1994; Gerstberger et al. 1993, Gerstendörfer 1994, Saalfrank, 1993). Es handelt sich um eine Situation, die mit den Begriff »Genozid durch Femizid« umschrieben werden muss. Obwohl es in dem riesigen Land keine objektive Notwendigkeit zu irgendwelchen Geburtenkontrollmaßnahmen gibt1, wird die chinesische Bevölkerungspolitik hier verschärft und mit offener Gewalt angewendet. Nach jahrelangen Beobachtungen von Menschenrechtsorganisationen ziehen in Tibet Vollstrecker – sog. Geburtenkontrollteams – durchs Land, die angeblich auf Quotenjagd sind. Frauen, die sich vor den Quotenjägern verstecken, werden bestraft, indem ihre Schwägerinnen und Cousinen in Lastwagen abgeholt werden, um sie einer Zwangsabtreibung zu unterziehen. Sogenannte »mobile Ambulanzen« stehen dafür zur Verfügung. Die Mehrzahl der Frauen wird – Berichten zufolge – nach der erzwungenen Abtreibung gleich zwangssterilisiert. So etwas wird sogar bei Erstschwangerschaften durchgeführt.
Neben dieser Form der »demographischen Endlösung« praktiziert die chinesische Regierung auch ihre anderen üblichen Formen des Terrors: Da es insbesondere immer wieder die Tibeterinnen – unter ihnen wiederum besonders die Nonnen – sind, die sich gegen die chinesische Terrorherrschaft wehren, sind sie es auch, die besonders krassen Formen der Gewalt ausgesetzt werden. Die chinesische Antwort auf die mutigen Proteste der Frauen hieß und heißt: Hinrichtungen, Zwangsarbeit, Gefängnis und Folter, »Verhöre« und brutale Vergewaltigungen, Misshandlungen der Geschlechtsteile mit elektrischen Viehtreiberstäben, das Hetzen hungriger Hunde auf wehrlose, nackte Frauen u.v.m.
Ein weiteres Beispiel für Genozid durch Femizid ist uns aus der jüngsten Vergangenheit noch sehr präsent: die massenhafte Vergewaltigung im ehemaligen Jugoslawien, aber auch in Ruanda und anderswo (vgl. Gutmann 1993, Ossig 1993, Stiglmayer 1993, Welser 1993).
In Kriegszeiten nimmt man seit Menschengedenken die massenhaften Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen als Selbstverständlichkeit hin, denn „es ist halt Krieg„. Die Selbstverständlichkeit brutalster Gewalt, beständiges Schweigen auf Täter- wie Opferseite und hohe Dunkelziffern sind wesentliche Merkmale des Femizids wie auch die bewusste Verbreitung von Mythen über die angeblich „allzeit bereiten, kriegerischen Triebtäter„.
Der Femizid beginnt jedoch nicht erst mit den Massenvergewaltigungen. Wieder ist es die Technik, die noch mehr Frauen (und Kinder) tötet. Betrachten wir nämlich die Entwicklung der Kriege in unserem Jahrhundert, so zeigt sich, dass es zunehmend mehr tote ZivilistInnen als tote Soldaten gibt. Im II Weltkrieg gab es bereits weit mehr tote ZivilistInnen als Soldaten; im Koreakrieg war das Verhältnis 5 zu 1 – und im Vietnamkrieg bereits 13 zu 1! Diese Tendenz ist steigend. Die männlich dominierte Technikgestaltung machte es möglich, dass – zunächst durch Städtebombardierung (II. WK) – die Überlebenschancen der Soldaten verglichen mit der Zivilbevölkerung immer größer wurden. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Kriege heute um so schneller »gewonnen« werden, je mehr ZivilistInnen – in ihrer Funktion als Angehörige der Soldaten – getötet werden können. Der Krieg gegen die Frauen ist also ein wesentlicher Teil der Kriegführung geworden.
Aber so neu ist diese Form des Femizids nicht, denn im Zweiten Weltkrieg, im April 1945, warnte Goebbels die deutschen Frauen vor den bösartigen „Bestien„, den „Untermenschen„, die über sie herfallen würden (vgl. Sander, 1992, S.23). Hier wurde unter den Frauen Angst und Panik verbreitet, gleichzeitig wurden die Männer gegen „den bösen Iwan„ aufgehetzt. Tatsache ist, dass es keineswegs nur die Russen waren, die vergewaltigt haben (vgl. Sander, a.a.O.). Aber die Volksverhetzung durch Goebbels und andere wirkt bis in unsere Tage. Kaum jemand denkt bei den Massenvergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg an die Amerikaner, Briten und Franzosen oder auch an die Wehmachtsbordelle der Deutschen und die sog. Freudenabteilungen der Nazis, in denen jüdische und andere Frauen das erdulden mussten, was vor wenigen Jahren den Frauen im ehemaligen Jugoslawien angetan wurde. Frauen wurden und werden als Kriegswaffe benutzt, um die Gegner zu zermürben und Völker (möglichste langfristig) gegeneinander aufzuhetzen (vgl. Batscheider, 1993).
Der offen betriebene Femizid im Krieg sollte jedoch niemals darüber hinwegtäuschen, dass Frauen auch in Friedenszeiten objektiv an Leib, Seele und Leben bedroht sind. Sexualisierte Gewalt stellt hierbei ein besonderes Risiko dar. Zählt man alle Gewalttaten, denen Frauen in Deutschland zum Opfer fallen könnten (Handtaschenraub: 5.5%, Raub: 1.8%, Einbruch: 5.3%, Körperverletzung mit Waffen: 1.9%) zusammen, so ist die Summe dieser möglichen Verbrechen geringer als die Zahl der sog. Sexualstrafdelikte (14.9 %; vgl. KFN-Studie 1995). Die Beispiele am Anfang lassen sich also leicht ergänzen und erweitern. Gewaltformen wie Genitalverstümmelungen (80 Millionen laut WHO-Schätzungen der 80er Jahre; vgl. Afele 1993) und andere schwere Menschenrechtsverletzungen gehören genauso dazu wie die neuesten Formen der virtuellen Gewalt mit Hilfe der weltweiten Computernetze, wo sich Händler, Pornoringe, satanistische Sekten und viele andere in einem nahezu vollständig geschützten Raum tummeln dürfen, um den modernen Sklavinnen- und Sklavenhandel immer besser zu organisieren und zu verbreiten. Hier hat sich in den letzten Jahren ein regelrechter und bestens organisierter Markt entwickelt, auf dem weibliche Körper nur noch als »Frischfleisch« betrachtet werden (vgl. Gerstendörfer 1998).
Frauenverachtung und damit einhergehende Menschenrechtsverletzungen sind auch in Deutschland an der Tagesordnung. Eine Zielgruppe sind professionelle Sexarbeiterinnen. Seit Monaten klagen Selbsthilfegruppen aus der politischen Hurenbewegung in Deutschland (u.a. HWG e.V. Frankfurt, Hydra e.V. Berlin; vgl. u.a. FR, taz, BZ, Bild v. 13.8.98) über eine drastische Zunahme von Gewalttaten gegen Prostituierte sowie deren immer härter werdende Formen. Es geschieht jedoch nichts. Im Gegenteil. Sieht man sich den Ausgang und die Urteilsbegründungen von Vergewaltigungsprozessen in diesem Bereich an, so wird nach wie vor der Mythos gepflegt, nach dem eine Prostituierte immer zu Sex bereit sei, weshalb sie gar nicht vergewaltigt werden könne. Dass eine Vergewaltigung ein besonders brutaler Gewaltakt ist, der Körper und Seele zerstört, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen (vgl. Gerstendörfer 1998b, c). Auf diese Weise werden Verbrechen, die eigentlich als Offizialdelikte eingestuft sind (§177 StGB: Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung, § 223-226 StGB Körperverletzungsdelikte, § 239 Freiheitsberaubung, § 212 StGB Totschlag, § 211 StGB Mord usw.), in der Praxis – und damit in der Lebenswirklichkeit von Frauen – als bloße Vergehen behandelt. Diskriminierende Prostitutionsgesetze (lebensgefährliche Orte durch Sperrgebietszonen usw.), die Menschenrechtsverletzungen an Frauen im Grunde vorprogrammieren, tun ein übriges; ebenso die »Eintopf-Philosophie«, was die Prostitution und die sog. Zwangsprostitution angeht. Dass es bei der »Zwangsprostitution« keineswegs um »Sexarbeit«, sondern um fortgesetzte sexualisierte Misshandlung geht, wird durch die Sprache und deren Auswirkungen auf die Einstellung von Politik, Gerichten und Gesellschaft geleugnet. Geleugnet wird aber ebenso, dass es bei der professionellen Prostitution um freiwillig angebotene Sexarbeit geht. Hier spielen altväterliche und altfeministische Moralvorstellungen eine erhebliche Rolle, und sie sind ein weiteres Beispiel für eine tiefsitzende Frauenverachtung in unseren Gesellschaften. Sie tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass sowohl SexarbeiterInnen als auch sog. Zwangsprostitutierte von unserer Gesellschaft ausgeschlossen und damit potentiellen Gewalttätern geradezu ausgeliefert werden. Die dramatischen Auswirkungen solcher Moralvorstellungen lauten: Weder ist ein Ende der Sklaverei (sog. Frauenhandel) noch ist eine Ende der Gewalt gegen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Sicht.
Die Unterschiedlichkeit der Beispiele sollte deutlich gemacht haben, dass die offensichtlich extremen Formen der Gewalt gegen Frauen im Krieg nicht (allein) für Femizide verantwortlich sind. Es ist vielmehr so, dass alles seinen Anfang hat: Im »Frieden« nämlich, und dort in den unterschiedlichen und nach wie vor kaum geächteten Formen der täglichen Diskriminierung von Frauen. Ob es nun sexualisierte Übergriffe gegen Studentinnen durch ihre Lehrer (vgl. Gerstendörfer 1994b) oder Belästigungen und Mobbing am Arbeitsplatz sind, ob Gewalt in Ehe und Partnerschaft, sexistische Witze oder die Ungleichverteilung bei gut bezahlten Arbeitsplätzen; all dies formt einen Rahmen, innerhalb dessen vieles vorbereitet wird, was in anderen »social settings« zu offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen führt.
Mit diesen wenigen Beispielen aus dem »Frieden« soll der Bogen geschlossen und zugleich deutlich gemacht werden, dass die allgemeine gesellschaftliche Reaktion auf Gewalt gegen Frauen, auf Vergewaltigung, Folter und Mord, im Krieg nicht so sehr anders ist als im Frieden.
Zwar sind die Erlebniswelten in Krieg und Frieden ganz und gar unterschiedlich, aber die zentralen Denk- und Verhaltensmuster gegenüber Frauen sind durchgängig. Der Krieg lässt nur die soziale Kontrolle und die kulturell vermittelten Handlungstabus fallen; soziale Kontrolle und Tabus, die im Frieden die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Männern und Frauen einigermaßen erträglich gestalten, indem sie Feindseligkeiten verdecken und mit Hilfe von gesellschaftlichen Regelungen – auch durch Gesetze – die tatsächliche Ungleichheit, den Sexismus, verschleiern (vgl. Forum Menschenrechte 1996).
Der Krieg zeigt nur mit radikaler Deutlichkeit und Prägnanz, wohin frauen- und lebensfeindliche Bewusstseinsprägungen in handelnder Konsequenz wirklich führen. Das ist der rote Faden, der systematisch ausgeübte Gewalt gegen Frauen und Femizid im Krieg wie im Frieden miteinander verbindet. Um hier etwas ändern zu können, muss Öffentlichkeit hergestellt und die Fakten benannt werden (dürfen). Leider ist es bislang immer noch so, dass tägliche Diskriminierungen verleugnet und heruntergespielt oder gar zum Gegenstand allgemeiner Belustigung erhoben werden.
Dabei wäre der Kampf gegen diesen Sexismus gar nicht so schwer, denn wenn wir uns den Kampf gegen Rassismus und Fremdenhass vor Augen führen, dann sind wir hier zumindest soweit gekommen, dass ein »Wehret den Anfängen« längst als wichtige Strategie anerkannt ist, um diese Form der Ungleichheit zwischen Menschen abschaffen zu können. Gleiches gilt für den alltäglichen Widerstand im Kleinen.
Für die Problematik des Sexismus wären genau solche Gegenstrategien angebracht, denn die Muster zwischen den verschiedenen Ismen (Ungleichheiten zwischen Menschen) sind gleich. Es ist bislang jedoch keineswegs selbstverständlich, dass dies für die Bekämpfung des Sexismus umgesetzt würde.
Vor diesem Hintergrund machen alle Worte, Forderungen und Handlungsempfehlungen – wie sie u.a. in UN-Konventionen zu lesen sind – erst dann Sinn und haben Aussicht auf Erfolg, wenn jede einzelne Person bei sich selbst und in ihrem Umfeld damit beginnt, Diskriminierungen nicht weiter zu tolerieren und Gewalt offen zu ächten.
Literatur
Afele, E. (1993): Die Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane. In: der Überblick, 2 (29), S.29f.
amnesty international, Jahresbericht 1992: China (Volksrepublik), S.129-136, Fischer, 1992.
Batscheider, T. (1993): Friedensforschung und Geschlechterverhältnis, BdWi, Marburg (Dissertation).
Drongshar, T.W. (1993): Die Frauen Tibets/Tibetische Frauen, Teil 1. Terre des Femmes-Rundbrief, 4, S.19-21.
Drongshar, T.W. (1994): Die Frauen Tibets/Tibetische Frauen, Teil 2. Terre des Femmes-Rundbrief, 1, S.23-25.
Forum Menschenrechte (Hrsg.) (1996): Vergewaltigung – Verbrechen an Frauen in Kriegs- und Friedeszeiten, Dokumentation einer Anhörung in der Friedrich Ebert Stiftung, DGVN, Bonn.
Gerstberger, I., Klemp, L., König, A., Reischies, A. & Wang, R. (1993): Dossier anlässlich der Weltfrauenkonferenz 1995 – Menschenrechtsverletzungen an Frauen in der VR China und Tibet, Germanwatch, NRO-Frauenforum, Terre des Femmes, Bonn.
Gerstendörfer, M. (1994a): Hauptsache die Kasse klingelt! Menschenrechtsverletzungen an tibetischen und chinesischen Frauen kein Thema. kofra 70, 12, S.11-14.
Gerstendörfer, M. (1994b): SINE LAUDE! Sexismus an der Hochschule. Metzingen, Glühwurm-Verlag.
Gerstendörfer, M. (1995): Menschenrechtsverletzungen an Frauen im Krieg: Frauen als militärisches Kalkül – II. Weltkrieg, Naziherrschaft und Schweigen. In: Loccumer Protokolle 62/93: Nicht länger schweigen! Fraueninhaftierung und Gewalt, S.97-126.
Gerstendörfer, M. (1996): Der § 218 – Das Bundesverfassungsgericht und seine Geschlechterpolitik. In: P. Imbusch & R. Zoll (Hrsg.) Friedens- und Konfliktforschung, (S.351-375). Opladen: Leske + Budrich.
Gerstendörfer, M. (1998a): Informationstechnologie und die digitale Konstruktion von Frauenkörpern. metis - Zeitschrift für historische Frauenforschung, 13 (7). edition ebersbach, Dortmund, S.51-63.
Gerstendörfer, M. (1998b): Über die Gefährlichkeit der Sprache, Teil I: Die Bagatellisierung der Gewalt durch Sprache – ein Plädoyer für die Verteidigung der Würde von Opfern sexualsierter Gewalt. Zeitung für leichte und schwere Mädchen, 18, S.9-11.
Gerstendörfer, M. (1998c): Gewalt durch Sprache, Teil II: Die Kriminalisierung von Sexualität – ein Plädoyer für die Verteidigung der Würde von Frauen, die der Prositutuion nachgehen. Zeitung für leichte und schwere Mädchen, 18, S.5-8.
Gutman, R. (1993): Wir haben Befehl, Mädchen zu vergewaltigen. In: T. Zülch (Hrsg.), »Ethnische Säuberung« – Völkermord für »Großserbien« (S.105-109). Zürich Luchterhand Flugschrift 5.
Kahlweit, C. (1993): Zerstörung der Seele – Vergewaltigungen als »intelligente Waffe« im jugoslawischen Bürgerkrieg. In: der Überblick, 2 (29), S.46-49.
Klasen, S. (1993): Millionen Frauen sterben infolge von Diskriminierung in: der Überblick, 2 (29), S.25f..
KFN (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.), Wetzels. P., Pfeiffer, Ch. (1995): Sexuelle Gewalt gegen Frauen im öffentlichen und privaten Raum – Ergebnisse der KFN-Opferbefragung 1992 – , Forschungsberichte Nr. 37, Hannover.
Ossig, G. (1993): Sammellager – Einladung für Vergewaltiger? In: der Überblick, 2 (29), S.24.
Ranke-Heinemann, U. (1988): Eunuchen für ein Himmelreich, Hamburg: Hoffmann & Campe.
Schneider, I. (1994): Neue Leibeigenschaften – Wie der Frauenkörper zur Plantage und die Leibesfrucht zum »nachwachsenden Rohstoff« wird. In: beiträge zur feministischen theorie und praxis, Gewalt-tätig, 37, Köln, S.127f.
Saalfrank, E. (1993): Tibetische Frauen kämpfen für ihr Mutterland. Terre des Femmes-Rundbrief, 1, S.42-44.
Sander, H. & Johr, B. (Hrsg.) (1992): BeFreier und Befreite. Kunstmann, 2. Aufl.
Stiglmayer, A. (Hrsg.) (1993): Massenvergewaltigungen – Krieg gegen die Frauen. Fischer.
Welser, M. (1993): Am Ende wünschst du dir nur noch den Tod – Die Massenvergewaltigungen im Krieg auf dem Balkan. München: Knaur.
Wichterich, Ch. (1994a): Menschen nach Maß – Bevölkerungspolitik in Nord und Süd. Göttingen: Lamuv.
<$tbrknowith=n;>Wichterich, Ch. (1994b): »Frei und verantwortlich« – Geburtenkontrolle, Reproduktionstechnologie und Bevölkerungspolitik zwischen Zwang und Freiwilligkeit. In: beiträge zur feministischen theorie und praxis, Gewalt-tätig, 37, Köln,S.111.
Wichterich, Ch. (1995): Frauen der Welt – vom Fortschritt der Ungleichheit. Göttingen: Lamuv.
Wilsnack, D. (1993): Den Besitz des Feindes beschädigen – Vergewaltigung im Krieg. In: der Überblick, 2 (29), S.43-46.
Zülch T. (Hrsg.): »Ethnische Säuberung« – Völkermord für »Großserbien«.Luchterhand Flugschrift, Zürich, 5, S.110-112.
Monika Gerstendörfer, Dipl.-Psychologin, Lobby für Menschenrechte, Postfach 1030, 72541 Metzingen.
zum AnfangAsylrecht in Deutschland – Asylrecht in Europa
von Herbert Leuninger
Die Grundgesetzänderung vom 26. Mai 1993 solle die „Singularisierung der Bundesrepublik Deutschland beseitigen„, so der Fraktionsvorsitzende der CDU/ CSU, Dr. Wolfgang Schäuble, am Tag der Grundgesetzänderung im Deutschen Bundestag. Der grundrechtliche Schutz für politisch Verfolgte müsse „an das Niveau der Schutzgewähr der internationalen Staatengemeinschaft, wie es in der Genfer Konvention seinen Ausdruck findet„, angepasst werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Grundsatzurteil vom 14. Mai 1996 dieses Asylrecht als verfassungskonform bestätigt. Mit der Grundgesetzänderung sei „eine Grundlage geschaffen, um durch völkerrechtliche Vereinbarungen eine europäische Gesamtregelung der Schutzgewährung für Flüchtlinge mit dem Ziel einer Lastenverteilung zwischen den beteiligten Staaten zu erreichen.„ Das Gegenteil dessen, was Politik und Verfassungsgericht hier verkünden, ist wahr: Deutschland versucht sich zunehmend von den bisher anerkannten Standards des internationalen Flüchtlingsschutzes zu lösen.
Nach dem Abbau des Grundrechts auf Asyl sind die nächsten Angriffspunkte die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Beide kommen nur noch eingeschränkt in Deutschland zur Geltung. 1993 wurde das Asylrecht angeblich geändert, um ein europäisches Asylrecht zu schaffen. Jetzt ist die Bundesrepublik die Vorreiterin bei der Demontage des internationalen Flüchtlingsrechtes. Bis heute hat die Bundesregierung keinen Vorschlag für ein einheitliches europäisches Asylrecht, das politisch Verfolgte wirksam schützt, vorgelegt. Bisher gibt es vor allem eine europäische Asylpolitik, die auf die Abwehr von Flüchtlingen gerichtet ist. Vergleichbare Verfahrensregelungen oder gar ein gemeinsames materielles Asylrecht gibt es nicht.
Die Abkommen von Dublin und Schengen haben im europäischen Bereich nur Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen gebracht. Sie sind jedoch nicht in den Bereich des materiellen Asylrechts vorgedrungen. Da alle EU-Staaten prinzipiell ein Asylrecht anerkennen und sich zur Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet haben, ist die Forderung, ein solches materielles europäisches Asylrecht zu schaffen, nicht so weltfremd wie manchmal dargestellt. PRO ASYL fordert von der neu gewählten Bundesregierung unmittelbar nach der Bundestagswahl Initiativen zur Schaffung eines verbindlichen europäischen Rechts. Hierbei sind die bislang anerkannten Standards des internationalen Flüchtlingsrechts, die Empfehlungen des Europarates aus dem Jahre 1981 und die Auslegung dieser Standards durch den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) zu berücksichtigen. Aus dem Bereich der Nichtregierungsorganisationen gibt es Vorschläge des Europäischen Flüchtlingsrates ECRE, die ebenfalls als Grundlage dienen können.
Damit dieses Vorhaben nicht auf die lange Bank geschoben wird und sich die Politik nicht mit dem Hinweis auf die angeblich so langwierigen internationalen Prozesse entlasten kann, fordern wir konkrete Schritte vom nationalen Gesetzgeber, dem Deutschen Bundestag. Allerdings sind die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen von Rot-Grün zum Asylrecht eine einzige große Enttäuschung.
Dennoch hat für PRO ASYL nach wie vor oberste Priorität, dass die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention wieder uneingeschränkt in Deutschland Geltung erlangen.
Angleichung des deutschen Asylrechts an internationale Standards
Genfer Flüchtlingskonvention
Mit der Drittstaatenregelung, wie sie im Asylverfahrensgesetz festgeschrieben ist, hat sich die Bundesrepublik Deutschland von der Einzelfallprüfung abgewandt und ist zur Pauschalierung des Asyl- und Menschenrechtsschutzes übergegangen.
Die Drittstaatenregelung erklärt alle Nachbarstaaten Deutschlands und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu sicheren Drittstaaten, insofern dort der Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention gilt. Flüchtlinge, die über diese Länder einreisen, verlieren in Deutschland jeden Anspruch auf Asyl und können dorthin zurückgeschoben werden.
Demgegenüber setzt aber das in Artikel 33 GFK enthaltene Refoulement-Verbot eine Einzelfallprüfung voraus (Refoulement-Verbot: Die Genfer Flüchtlingskonvention untersagt es, Flüchtlinge gegen ihren Willen in ihre Herkunftsländer abzuschieben). Dies ist die Auffassung des UNHCR. Um dieser Auffassung wieder zur Geltung zu verhelfen, muss nicht das Grundgesetz geändert werden. Die geforderte Regelung widerspricht auch nicht der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vom 14. Mai 1996. Es genügt eine Änderung von § 34 a Asylverfahrensgesetz.
Eine derartige Regelung ist auch politisch keineswegs weltfremd. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Bundestagsfraktion der SPD im Jahr 1993 einen Änderungsantrag gestellt hat, mit dem sicher gestellt werden sollte, dass auch solche Asylsuchende eine gerichtliche Beschwerdemöglichkeit erhalten, die über einen »sicheren Drittstaat« nach Deutschland einreisen.
In Deutschland hat sich eine Rechtsprechung durchgesetzt, die den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention verengt. Verfolgt sollen nur diejenigen sein, deren Verfolgung vom Staat ausgeht. Damit wird faktisch verhindert, dass die Genfer Flüchtlingskonvention ihre volle Schutzwirkung entfalten kann. Motoren dieser Entwicklung sind neben der ehemaligen Bundesregierung die höchstrichterliche Rechtsprechung, insbesondere die des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG).
Durch diese Interpretation der GFK sind z.B. Flüchtlinge aus Somalia, Afghanistan und auch aus Bosnien aus dem unmittelbaren Asylschutz herausgefallen. Zehntausende Flüchtlinge werden als AsylbewerberInnen abgelehnt und gelten dann als Menschen, die das Asylrecht missbrauchen.
So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil vom 4. November 1997 entschieden, dass praktisch allen Flüchtlingen, die aus Kriegs- und Krisengebieten nach Deutschland fliehen, der asylrechtliche Schutz verweigert wird. Obwohl das Gericht im konkreten Fall zugestand, dass der Asylsuchende aus Afghanistan als hoher Funktionär des früheren kommunistischen Regimes inzwischen überall in Afghanistan mit lebensbedrohender Verfolgung rechnen müsse, verweigerte es ihm asylrechtlichen Schutz. Politische Verfolgung besteht nach dem Bundesverwaltungsgericht nur dann, wenn sie von einem Staat oder einer staatsähnlichen Gewalt ausgeht, deren Herrschaft stabil und dauerhaft ist. Diese Rechtsprechung ignoriert die Entstehungsgeschichte der Genfer Flüchtlingskonvention. Diese entstand mit dem Ziel, alle diejenigen Menschen zu schützen, die durch den Wegfall des zuvor gewährten staatlichen Schutzes schutzlos geworden sind – unabhängig davon, ob der Auslöser der Untergang des Herkunftsstaates oder eine Verfolgung durch staatliche Organe ist. Die Folge der verengenden Auslegung der GFK durch das Bundesverwaltungsgericht ist, dass Flüchtlingen die Status-Rechte der GFK vorenthalten werden (etwa Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina, Afghanistan, Somalia). Eine Änderung der Praxis ist erforderlich. Vom UNHCR ist in den vergangenen Jahren die entsprechende Beachtung der GFK immer wieder gefordert worden.
Europäische Menschenrechtskonvention
Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verbietet es, jemanden der Folter, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung zu unterwerfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass das Verbot des Art. 3 EMRK auch dann gilt, wenn eine Person in ein Land gebracht werden soll, in dem die Misshandlung von nichtstaatlicher Seite droht (EuGMR, Urteil vom 17.12. 1996 Nr. 71/ 1995/ 577/ 663 – Ahmed ./ . Österreich, InfAuslR 1997, S. 279 ff.). Dieser Rechtsprechung zu folgen, weigert sich das Bundesverwaltungsgericht in seiner Somalia-Entscheidung vom 15. April 1997. Zugrunde lag dieser Entscheidung der Fall eines somalischen Staatsangehörigen, der von den Truppen des Clanchefs Aidid verfolgt und inhaftiert wurde. Dem nach Deutschland Geflohenen wurde von den Verwaltungsgerichten nicht nur der Asylanspruch verweigert; man verweigerte ihm auch die Rechtsstellung nach § 51 Abs. 1 AuslG und den Abschiebungsschutz gemäß § 53 Abs. 4 AuslG, der sich auf den Schutz durch die Europäische Menschenrechtskonvention bezieht. Die Begründung: Als unmenschliche Behandlung seien gemäß Art. 3 EMRK grundsätzlich nur Misshandlungen durch staatliche Organe anzusehen (AZ.: BVerw G 9C 38. 96, Urteil vom 15.4. 1997).
Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach der Auffassung, dass eine die Abschiebung verbietende unmenschliche oder erniedrigende Behandlung nach Art. 3 EMRK nur dann vorliegen soll, wenn „sie von einem Staat oder von einer staatsähnlichen Organisation herrührt„.
Demgegenüber hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil »Ahmed gegen Österreich« vom 17. Dezember 1996 ( N r. 71/ 1995/ 577/ 663) festgestellt, dass „angesichts des absoluten Charakters von Art. 3 auch nicht … das Fehlen jeder staatlichen Gewalt in Somalia„ der Anwendbarkeit von Art. 3 EMRK entgegenstehe. Der Grundsatz, wonach es beim Abschiebungsschutz nach Art. 3 EMRK nicht auf die Einwirkung einer staatlichen oder staatsähnlichen Gewalt ankommt, sondern absoluter Schutz vor Folter, unmenschlicher Behandlung oder Abschiebung in eine vergleichbar lebensbedrohliche Lage gewährt werden soll, wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Urteil »D. gegen Vereinigtes Königreich« vom 2. Mai 1997 (N r. 146/ 1996/ 767/ 964) bestätigt. (In der Entscheidung ging es um einen Aidskranken, dem nach seiner Abschiebung ins Herkunftsland mangels ausreichender Behandlungsmöglichkeiten der baldige Tod gedroht hätte. Die Abschiebung wurde als unmenschliche Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK bewertet.)
Damit geht die deutsche Rechtsprechung einen Sonderweg und setzt sich in Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Schutzbedürftigen wird so der notwendige Schutz entzogen.
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte muss auch für deutsche Gerichte verbindlich sein. Deshalb ist im Zuge einer europäischen Harmonisierung des Menschenrechtsschutzes § 53 Abs. 4 AuslG wie oben bereits dargelegt zu fassen.
Erfordernisse eines »harmonisierten« Asylrechts in der EU
Der Europäische Flüchtlingsrat (ECRE), in dem Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen aus 21 europäischen Ländern vertreten sind, hat auf seiner gemeinsamen Sitzung im Frühjahr 1998 in Portugal die europäischen Politiker aufgefordert, in der Asylpolitik einen stärker ethisch orientierten Ansatz zu verfolgen. Der Rat appelliert an die europäischen Regierungen, eine Führungsrolle in der Verteidigung der Menschenrechte der Asylsuchenden zu übernehmen, die aus den Krisengebieten vor den Toren Europas fliehen.
ECRE zeigt sich sehr besorgt angesichts der wachsenden Diskrepanz zwischen der Verpflichtung der europäischen Regierungen zu demokratischen Werten und humanitären Traditionen auf der einen Seite und dem restriktiven Ansatz in der Bewältigung der jüngsten Flüchtlingskrisen auf der anderen. Drei namhafte Beispiele bieten besonderen Anlass zur Sorge. Die Unruhen im Kosovo, in Algerien und im nördlichen Teil des Iraks und der Türkei wurden allesamt frühzeitig vorhergesehen, dennoch ergriff die Völkergemeinschaft keine wirksamen Präventivmaßnahmen. Viele der Opfer dieser Tragödien gelangen nun als »Boat People« zu uns und überleben nur mit knapper Mühe ihren Versuch, in Europa Zuflucht zu finden. Die derzeitige abschreckende Reaktion Europas gegenüber diesen Menschen kann als Ergebnis der Politik einer »Festung Europa« betrachtet werden, welche die Regierungen seit fast einem Jahrzehnt mit ihrer politischen Tagesordnung verfolgen.
Im einzelnen fordert ECRE :
- die Tatsache anzuerkennen, dass ein bedeutender Teil der Personen, die derzeit aus Algerien, dem Kosovo, dem Irak und der Türkei fliehen, des internationalen Schutzes bedürfen. Die europäischen Staaten sollten nicht versuchen, die Flüchtlingsproblematik durch den Einsatz von Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung zu lösen. Der Aktionsplan der Europäischen Union zum Phänomen der sogenannten irakischen Einwanderer vom Februar 1998 sei der Inbegriff eines solchen Ansatzes. An einer Stelle wird darin erwähnt, dass „die Bedingungen der Genfer Konvention Beachtung finden„, aber davon abgesehen geht es ausschließlich um Maßnahmen, die verhindern sollen, dass weitere kurdische Flüchtlinge nach Europa gelangen – Maßnahmen, welche völlig außer Acht lassen, dass Menschenrechtsverletzungen gegen das kurdische Volk Realität sind.
- noch einmal alle Abschiebungen von AlgerierInnen, Kosovo-AlbanerInnen und KurdInnen zu überprüfen, um eine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips der Genfer Flüchtlingskonvention zu vermeiden und niemanden zurückzuschicken, der Gefahr läuft, Folterungen oder anderen unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlungen ausgesetzt zu werden. Die Regierungen Europas sollten ihre Kräfte dafür einsetzen, die Ursachen der Flüchtlingsbewegungen zu beseitigen, statt auf die Verhandlung oder Durchsetzung von Rückführungsabkommen mit diesen Ländern zu drängen. Derartige einseitig erzwungene Rückführungen seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt kontraproduktiv, sie wirkten sich destabilisierend auf eine ohnehin schon höchst instabile Situation aus, und sie liefen den internationalen Verpflichtungen der aufnehmenden Staaten zuwider, wie sie in der Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951 und in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind.
- in Diskussionen mit anderen europäischen Staaten hinsichtlich der Harmonisierung der Aufnahme- und Asylpolitik eine Grundsatzposition einzunehmen und zu überdenken, wie Europa auf Flüchtlinge reagieren soll, die vor einem Bürgerkrieg oder vor einem allgemeinen Gewaltklima fliehen. Folgendes sei von vitalem Interesse:
- eine korrekte Anwendung der Konvention aus dem Jahre 1951 in Übereinstimmung mit ihrem humanitären Geist, einschließlich der Anerkennung des Status derjenigen, die der Verfolgung von nichtstaatlicher Seite ausgesetzt sind;
- ein regionales und zeitlich begrenztes Schutzsystem wie beispielsweise das von der Kommission der Europäischen Union vorgeschlagene, mit dem ein Instrument zum Umgang mit plötzlichen großen Flüchtlingsaufkommen geschaffen würde;
- sicherer und rechtsverbindlicher Schutz von De-facto-Flüchtlingen, die nicht unter die Flüchtlingsdefinition gemäß der Konvention fallen;
- eine angemessene Politik der Lastenteilung, die auch die Schaffung eines europäischen Flüchtlingsfonds beinhaltet, um die finanzielle Verantwortung für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zwischen den europäischen Staaten aufzuteilen.
Alternativen zum Strategiepapier der EU
Der Europäische Flüchtlingsrat, in dem von deutscher Seite die großen Wohlfahrtsverbände und PRO ASYL Mitglieder sind, hat sich auch mit eigenen Vorschlägen an den österreichischen Ratsvorsitz gewandt. Dieser hatte im Juli 1998 ein Strategiepapier zur Einwanderungs- und Asylpolitik vorgelegt, das unter den Nichtregierungsorganisationen große Unruhe auslöste. ECRE hat hierzu ausführlich Stellung genommen und diverse und in mancher Hinsicht moderate Alternativen unterbreitet.
- Die EU-Staaten sollten bei größeren erzwungenen Fluchtbewegungen äußerst zurückhaltend mit einer Visumspflicht umgehen. (Deutschland hatte am Beginn des Bosnien-Konfliktes sofort eine Visumspflicht für Bosnier eingeführt, um deren Flucht ins Bundesgebiet zu erschweren). Gegebenenfalls seien Abschiebungen und Rücknahmeabkommen für Krisengebiete vorübergehend auszusetzten.
- Asylbewerber sollten vielmehr beim Zugang zum europäischen Territorium und zu Anerkennungsverfahren unterstützt werden. Das würde eine Kehrtwendung in der derzeitigen europäischen Flüchtlingspolitik bedeuten, die auf die Verhinderung von Zuflucht abstellt und Flüchtlingen keine andere Wahl lässt, als sich dubiosen und kostspieligen Fluchthilfeorganisationen (sog. Schleppern oder Schleusern) auf Gedeih und Verderb zu überantworten und »illegal« die Grenzen zu überschreiten.
- Das umständlichen Systems der Asylverfahren könnte vereinfacht werden, jedoch dürfte die Rechtsstaatlichkeit der Verfahren dabei keinen Schaden nehmen. Vielmehr sollten einige der ineffizienten und teuren Maßnahmen, die in den letzten zehn Jahren immer häufiger angewendet wurden, abgeschafft werden. Dies betrifft insbesondere die Abschiebehaft trotz gleichwertiger Alternativen, die Regelung des sicheren Drittstaates (welche zur Vervielfachung der Verfahren, Inhaftierungen und Rückführungen geführt hat), die Abschiebung in Fällen, bei denen keine Programme zur freiwilligen Rückkehr angeboten wurden, sowie die Visapflicht für Personen, die fluchtproduzierenden Situationen zu entkommen trachten.
- Andere Möglichkeiten der EU-Staaten im Bereich Asyl (vorübergehender Schutz, Rückkehrprogramme und andere humanitäre Angebote) sollten besser genutzt werden.
- Schließlich gehe es um die Vollendung der Harmonisierung, einschließlich der Verbesserung früherer Maßnahmen und Abkommen, sowie um die Ausarbeitung einer ergänzenden Definition für Flüchtlinge, die aus der Genfer Flüchtlingskonvention herausfallen;
- Auf europäischer Ebene müssten Integrationsstrategien entwickelt werden, die sich auf Vielfalt, Nichtdiskriminierung, sozioökonomische Rechte und die Rechte der Familienzusammenführung gründen. Wenn ECRE auch nicht einer Rückführung von Personen widerspricht, die keines internationalen Schutzes bedürfen, so sei es erforderlich, dass die Mitgliedstaaten jenen einen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen, die aus Gründen, die diese selbst nicht zu verantworten hätten, nicht zurückgeführt werden können;
- Die politische Unterstützung für das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) sollte wieder hergestellt werden, um auf dem direktesten Weg weltweite Solidarität praktizieren zu können und das Prinzip der Universalität der Menschenrechte (und somit auch des Rechts auf Asyl) zu wahren.
Letztlich muss der Kampf gegen die Ursachen erzwungener Migration Vorrang haben vor einer wie auch immer gearteten Abwehr von Menschen, die Schutz suchen oder um ihr Überleben kämpfen. Ein interessantes Beispiel dürfte der Ende 1995 eingeleitete Barcelona-Prozess sein. In ihm haben sich die Anrainer des Mittelmeeres unter Führung der EU zusammengeschlossen. Mit einem eindrucksvollen Bündel von Konferenzen, Kontakten und Maßnahmen – nicht zuletzt auch durch beachtliche finanzielle Mittel – soll ein Raum der Partnerschaft, der Stabilität und des Friedens entstehen. Dieser Versuch, der neben einer Reihe nordafrikanischer Staaten auch Israel und die Türkei umfasst, verdiente eine höhere Aufmerksamkeit. Er ist im Übrigen ausdrücklich darauf angelegt, Flüchtlingsströme einzudämmen.
Literatur:
Heinhold, H. (1997): Abschiebungshaft in Deutschland. Frankfurt.
Heinhold, H. (1997): Recht für Flüchtlinge – Ein Leitfaden durch das Asyl- und Ausländerrecht für die Praxis. Frankfurt.
Leuthardt, B. (1997): Europas neuer Pförtner – Litauen im Schatten des deutschen Asylrechts. Frankfurt.
PRO ASYL (Hrsg.) (1998): Mindestanforderungen an ein neues Asylrecht. (Materialheft), Frankfurt.
Wurzbacher, S. (1997): Gut beraten. Abgeschoben … Flüchtlingssozialarbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Frankfurt.
Herbert Leuninger, Europareferent von PRO ASYL – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge, Postfach 101843, 60018 Frankfurt.
zum AnfangMeinungsfreiheit in der Mediengesellschaft
von Andrea Gourd
Die Meinungsfreiheit zählt zu den vornehmsten Menschenrechten überhaupt (BVerfGE 5, 85: 205). Daher gehört das Grundrecht auf Meinungsfreiheit zum Standard in den Verfassungen westlicher Demokratien und zählt nach verbreiteter Ansicht zu den verwirklichten Grundprinzipien. Doch gerade diese vermeintliche Selbstverständlichkeit birgt die Gefahr in sich, dass Meinungsfreiheit zwar positiv rechtlich verankert wird, ihr normativer Sinn jedoch aus dem Blick gerät.
Was konkret mit dem normativen Sinn der Meinungsfreiheit gemeint ist, erschließt sich bei einer Betrachtung ihres elementaren politischen Charakters. Um mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen, ist Meinungsfreiheit „für eine freiheitliche demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend, denn sie ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Sie ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt„ (BverfGE 5, 85: 205). Ihre Bedeutung gewinnt Meinungsfreiheit also nicht nur als elementares Individualrecht, sondern mehr noch als konstituierendes Element der parlamentarischen Demokratie. Es handelt sich hier sozusagen um eine doppelte Legitimation, wobei beide Dimensionen sich gegenseitig bedingen.2 Diesen Doppelcharakter von individualrechtlicher und gesellschaftspolitischer Stoßrichtung teilt die Meinungsfreiheit mit anderen Grundrechten. Menschenrechte bewegen sich im Kontext von Staat und Individuum, sie definieren Freiheitsräume des Einzelnen, die um der individuellen Entfaltung willen vor staatlichen Interventionen geschützt sind. Umgekehrt verlangt aber individuelle Entfaltung auch nach sozialer Teilhabe; erst im Zusammenspiel von Unabhängigkeit vor Eingriffen und Teilhabe am politischen Prozess einer Gesellschaft werden Menschenrechte verwirklicht. Dieses Zusammenwirken von positiver und negativer Freiheit ist für das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit konstitutiv. Meinungsfreiheit lässt sich als ein klassisches Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe in die individuelle Freiheit der Meinungsäußerung interpretieren. Meinungsfreiheit erschöpft sich aber nicht in der Freiheit vor staatlichen Ein- und Übergriffen. Wird sie verstanden als elementares Recht, das die Mitwirkung am politischen Geschehen einer Gesellschaft ermöglicht, sichert und fördert, und das zugleich der Einlösung der Demokratie dient, so nimmt Meinungsfreiheit den Charakter eines Teilhaberechts an.3 Dies impliziert weiter, dass der Einzelne zur Wahrnehmung seiner verbürgten Freiheit auf staatliche Vorkehrungen angewiesen ist, die ihm die Ausübung seines individuellen und staatsbürgerlichen Rechts ermöglichen. Die Frage, in welcher Form der Staat heute tätig werden muss, um der so verstandenen Meinungsfreiheit aller Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, steht im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzung um dieses Grundrecht.
Unter den Bedingungen der sog. modernen Massendemokratie vollziehen sich der politische Meinungsstreit und die Meinungsbildung in erster Linie vermittelt durch Massenmedien. Es obliegt also im wesentlichen den Medien, ein Forum bereitzustellen, in dem sich die unterschiedlichen Interessengruppen einer Gesellschaft auseinandersetzen und verständigen sollen. Dieses Forum, normativ verstanden als eine allen zugängliche Öffentlichkeit, ist in pluralistischen Massengesellschaften unerläßliche Bedingung demokratischer Willensbildung, denn nur über die Herstellung von Öffentlichkeit ist demokratische Legitimation von politischen Entscheidungsprozessen möglich.
Je stärker freie Meinungsbildung auf Massenmedien angewiesen ist, desto deutlicher wird eine neue Dimension des Rechts auf Meinungsfreiheit: Es geht nicht mehr nur darum, überhaupt aussprechen zu dürfen, was man denkt, sondern darüber hinaus um die Chance, Meinungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn Meinungsfreiheit umfasst nicht nur das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern setzt den Zugang zu Informationen ebenso voraus wie die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden, seine Bedürfnisse und Überzeugungen zu artikulieren, auf andere informationsgebend und meinungsbildend zu wirken usw.4 Es geht also um den Zugang zu den Massenmedien, insbesondere dem Fernsehen als dem bewusstseinsbestimmenden Medium unserer Zeit. Meinungen, die keinen Zugang zu massenmedialer Verbreitung finden, haben so gut wie keine Durchsetzungschance mehr. Zum »Zu-Wort-Kommen« als Aspekt der Meinungsfreiheit tritt also wesentlich das »Zu-Gehör-Kommen« als ergänzende Komponente. Der Zugang zu den Massenmedien entscheidet darüber, ob der für eine freiheitliche Demokratie notwendige Meinungspluralismus widergespiegelt wird oder ob durch einseitige Ausrichtung der Medien womöglich Manipulationen der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung möglich werden. Politische Machtfragen entscheiden sich heute zu einem großen Teil an der Beherrschung der Medien.
Vor diesem Hintergrund erweitert sich der Ruf nach Meinungsfreiheit zu einer menschenrechtlichen Forderung neuer Qualität, nämlich zur Forderung nach einer umfassenden Kommunikationsfreiheit, in die beide Dimensionen dieses Grundrechts, also individualrechtliche und gesellschaftspolitische, Eingang finden. Die Umsetzung dieser Konzeption von Meinungsfreiheit bringt jedoch auch in Deutschland erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Dies macht der Streit um die verfassungsrechtliche Interpretation von Art. 5 des Grundgesetzes deutlich. Mit Art. 5 Abs. 1 GG ist das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit zum konkret einklagbaren Grundrecht geworden. Dabei gehört das Verhältnis des Satzes 2 („Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet„, sog. Medienfreiheit) zu Satz 1 („Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten„) zu den umstrittensten Fragen der Auslegung des Art. 5. Dies erläutern wir im folgenden.
Hinter diesem grundsätzlichen Dissens stehen unterschiedliche Auffassungen zur Stellung der beiden Seiten der Meinungsfreiheit zueinander. Strittig ist das Verhältnis subjektiv- zu objektivrechtlichen Elementen des Grundrechtsschutzes. Der individualrechtlichen Interpretation des Art. 5 steht die funktionalistische Auslegung einer um ihre gesellschaftspolitische Funktion erweiterten Meinungsfreiheit gegenüber – mit jeweils erheblichen Konsequenzen für die Ausgestaltung des Medienwesens und die Anforderungen an staatliches Tätig werden. Bei diesen divergierenden verfassungsrechtlichen Interpretationen der Meinungsfreiheit steht der Umfang dieses Freiheitsrechts selbst zur Diskussion, was der Streit um die »richtige« Auslegung der Rundfunkfreiheit verdeutlicht.
In der subjektiv- bzw. individualrechtlichen Deutung des Art. 5 I 2 GG wird Rundfunkfreiheit als liberales Abwehrrecht verstanden. Nach diesem klassischen Grund- und Menschenrechtsverständnis sichert die Rundfunkfreiheit dem einzelnen einen Raum freier Betätigung ohne staatliche Eingriffe. Das Äußern und Verbreiten einer Meinung mittels Rundfunk ist in dieser Sichtweise lediglich ein unselbständiger Unterfall der individuellen Meinungsäußerung. Aus dem Recht auf freie Meinungsäußerung wird daher ein Recht des Einzelnen auf Rundfunkveranstaltung abgeleitet und dieses wiederum eng mit der ökonomischen Entfaltungsfreiheit im Rundfunksektor gekoppelt. Gemäß dieser individualrechtlichen Sicht dient Rundfunkfreiheit also nicht primär dem Recht aller auf freie Meinungsbildung, sondern in erster Linie dem Recht des privaten Unternehmers, ein Rundfunkunternehmen zu gründen und Gewinn orientiert zu betreiben. Dass wirtschaftliche Macht sowie organisiertes Durchsetzungsvermögen darüber entscheiden, wer diese so verstandene Rundfunkfreiheit verwirklichen kann und welche Interessen und Ansichten im öffentlichen Meinungsspektrum zur Geltung kommen, wird in diesem Modell nicht problematisiert.
Ganz im Gegensatz dazu steht die funktionalistische Deutung der Rundfunkfreiheit, in der die bereits angesprochene politische Dimension der Meinungsfreiheit bedeutsam wird. Danach bildet gelungene Meinungsbildung den Kern der Rundfunkgewährleistung. Sie setzt auf Maximierung pluralistischer öffentlicher Informations- und Meinungsvermittlung. Rundfunkfreiheit hat hier primär eine den Kommunikationsinteressen aller Bürgerinnen und Bürger dienende Funktion. Um des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung willen ist es daher gerechtfertigt und sogar gefordert, die Interessen der Rundfunkunternehmer zu beschneiden, insofern sie der eng mit dem Demokratieprinzip verbundenen Zielsetzung freier Meinungsbildung zuwiderlaufen. Nach diesem Grundrechtsverständnis wird massenmediale Kommunikation auch und gerade um ihrer gesellschaftlichen Bedeutung willen geschützt. Da der Rundfunk aufgrund der erforderlichen technischen und finanziellen Voraussetzungen nicht jedermann offensteht, wird daraus die Pflicht des Staates zur Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen abgeleitet, die sicherstellen, dass Fernsehen und Hörfunk ihrer gesellschaftlichen Funktion auch tatsächlich gerecht werden. Aus dem liberalen Abwehrrecht wird so ein politisches Auftragsrecht.
Im Bundesverfassungsgericht findet sich ein prominenter Vertreter der funktionalistischen Deutung. Bezüglich der Rundfunkfreiheit hat das Gericht wiederholt betont, dass diese der Gewährleistung freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung diene. Wie der Rundfunk organisiert ist – also öffentlich-rechtlich oder privat-kommerziell – ist zweitrangig, solange der Gesetzgeber sicherstellt, dass „die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet„ ( BVerfGE 57, 295). Das Grundrecht auf Rundfunkfreiheit beinhaltet demnach einen Auftrag zur Sicherung gleichgewichtiger Vielfalt und zur Schaffung kommunikativer Chancengleichheit. Es mündet damit zwangsläufig in die Forderung nach pluraler Medienorganisation.
Bereits hier ist evident, dass diese Ziele durch ein Verständnis von Meinungsfreiheit als Abwehrrecht nicht hinreichend gesichert werden können. Der Gesetzgeber ist vielmehr aufgefordert, den Missbrauch kommunikativer Macht zu Instrumentalisierungs- oder Manipulationszwecken zu verhindern und publizistische Vielfalt effektiv zu sichern. Insbesondere gilt es einer ökonomischen und damit publizistischen Konzentration im Mediensektor vorzubeugen sowie der Gefahr des Missbrauchs mit dem Ziel einseitiger Einflussnahme auf die öffentliche Meinung entgegenzutreten (BVerfGE 73, 118). Hier ergibt sich ein konkreter Gestaltungsauftrag an den Staat, der weit über eine rein gewerberechtliche Lizenzierung, wie sie faktisch bei der Zulassung privat-kommerzieller Fernsehprogramme praktiziert wird, hinausreicht.
Konfrontiert man nun diese Forderung nach einer unter funktionalen Aspekten »zweckdienlichen« Ausgestaltung des Medienwesens mit den tatsächlich vorhandenen Strukturen des Rundfunksystems, so wird eine erhebliche Diskrepanz offenkundig. Obwohl nicht nur das Verfassungsgericht auf die besonderen Gefahren, die von einer Medienkonzentration für Meinungsvielfalt und freie Meinungsbildung ausgehen, nachdrücklich und mehrfach hingewiesen hat – insbesondere mit dem Hinweis, dass Fehlentwicklungen gerade in diesem Bereich nur schwer rückgängig zu machen sind –, ist genau diese Situation heute zu konstatieren. Hinter der Fassade der Vielfältigkeit (weil Vielzahl) im privaten Rundfunk verbergen sich in Deutschland im wesentlichen die beherrschenden Medienverbünde Kirch und Bertelsmann/ CLT. Die Anfang der 80er Jahre von interessierter Seite proklamierte Bestrebung, das »Monopol« ARD/ZDF zugunsten eines pluralistischen privaten Fernsehsystems abzulösen, hat heute dazu geführt, dass sich – über zahlreiche Verschachtelungen der Besitzformationen, Abhängigkeitsverhältnisse etc. – der private Fernsehmarkt fest im Griff des genannten Duopols befindet, das darüber hinaus bereits Tendenzen zum Monopol aufweist: Die Konzerne Kirch und Bertelsmann kooperieren beim Pay-TV-Kanal Premiere und beabsichtigen, den gewinnträchtigen Zukunftsmarkt des digitalen Fernsehens gemeinsam zu erschließen.5 Diese massive Konzentration im Mediensektor bedeutet eine Einengung publizistischer Vielfalt und pluralistischer Meinungsvermittlung, da einzelne Unternehmer mit spezifischen Interessen erheblichen Einfluss auf die veröffentlichte Meinung und damit auf die Meinungsbildung der Bevölkerung bekommen. Andere Interessen, Meinungen und das Potential zum Widerspruch gegen die herrschenden Perspektiven verlieren damit zunehmend an Artikulationsmöglichkeiten und werden vom politischen Willensbildungsprozess ausgeschlossen. Eine gefährliche Potenzierung erlangt der Einfluss dieser Medienkonzerne dadurch, dass nicht nur die horizontale Konzentration außerordentlich hoch ist, d.h. ein Anbieter jeweils mehrere bundesweite Sender beherrscht (Sat1, Pro7, Kabel 1, DSF, Premiere unter dem Einfluss von Kirch; RTL, RTL2, Premiere, Vox maßgeblich beeinflusst von Bertelsmann/ CLT). Darüber hinaus wird die Verflechtung durch vertikale und diagonale Konzentrationstendenzen immer stärker vorangetrieben. Ein Medienunternehmen tritt also nicht nur als Veranstalter mehrerer Fernsehprogramme auf, sondern ist zusätzlich etwa im Produktions- und Vertriebsbereich tätig und verfügt neben erheblicher Meinungsmacht im Rundfunk auch über Meinungsmacht im Printsektor. Diese intermediäre Verflechtung bildet sich zunehmend zur Multimedia-Konzentration aus. Für kleinere, unabhängige Programmanbieter bleibt auf diesem Markt kein Platz mehr. Bestes Beispiel für eine solch drastische Konzentration ist der Kirch-Konzern, der monopolartig die Kontrolle über alle Funktionen des Marktes von der Programmproduktion über den Programmhandel bis hin zur Ausstrahlung besitzt – und darüber hinaus durch den Verbund mit dem Springer-Konzern über erheblichen Einfluss auf dem Printsektor verfügt. Die sich hieraus ergebenden Synergieeffekte weiss Kirch weidlich zu nutzen. Solche multimedialen Anbieterstrukturen ermöglichen eine kaum mehr zu überschauende und erst recht kaum mehr zu kontrollierende ökonomische und publizistische Marktmacht in wenigen Händen und versprechen größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg. Die Massenmedien, normativ Instrumente zur Verwirklichung von Meinungsfreiheit, werden so zur Machtquelle, und wie Hege richtig bemerkt: „Politische Macht ist immer Macht auf Zeit, die Macht von Medienunternehmen ist es nicht.„6
Von Seiten der Politik wurde die zunehmende Vermachtung des Mediensektors nie ernsthaft angegangen. Im Gegenteil: Standortpolitik, gesetzlicher Nachvollzug und damit Legalisierung bereits eingetretener Missverhältnisse haben diesen Prozess begünstigt statt verhindert. Nicht umsonst hat mit der Etablierung kommerziellen Fernsehens die individualrechtliche Deutung der Rundfunkfreiheit an Boden gewonnen. Erst der Ruf nach möglichst wenig staatlicher Reglementierung und möglichst viel Spielraum für individuelle profitorientierte Betätigung auf dem Fernsehmarkt hat diesen zu einem einträglichen Geschäft werden lassen. Die Kommerzialisierung des Rundfunks hat zu einer Funktionsverschiebung des Fernsehens von der Wahrnehmung politisch-gesellschaftlicher Ziele zur Wahrnehmung ökonomischer Ziele geführt – geebnet wurde dieser Weg durch eine den wirtschaftlichen Erfordernissen angepasste Grundrechtsinterpretation. Dem normativen Sinn der Kommunikationsfreiheit, freie individuelle Meinungs- und demokratische Willensbildung zu sichern, kann ein hochkonzentriertes, in den Dienst privater Gewinninteressen gestelltes Fernsehen jedenfalls nicht gerecht werden.
Wenn das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit seine Konturen angesichts der Herausforderungen des elektronischen Zeitalters bewahren soll, so muss es im dargestellten Sinne zum Kommunikationsgrundrecht aller erweitert werden – mit erheblichen Konsequenzen für die Ausgestaltung des Medienwesens. Gefordert ist die Gegensteuerung durch das Rechtssystem, das reguliert, wo es um das Offenhalten von Kommunikationskanälen geht, und dem aktuellen Ruf nach Deregulierung angesichts neuer Medientechniken mit profitablen Gewinnaussichten nicht leichtfertig nachgibt. Denn ohne gesellschaftlich verantwortungsvolle Wahrnehmung staatlicher Gestaltungsmöglichkeiten wird das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit inhaltlich ausgehöhlt. Dies sollte insbesondere bei der aktuellen Diskussion um die – wieder mal – »neuen Medien« der Informationsgesellschaft nicht aus dem Blick geraten.
Dipl.-Politologin Andrea Gourd, seit 1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg, Wilhelm-Röpke-Str.6, 35032 Marburg.
zum AnfangMenschenrechtserziehung in Deutschland. Ziele, Erfolge, Perspektiven
von Lothar Müller
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte jährt sich in diesem Jahr zum fünfzigsten Mal. Welches Resümee lässt sich angesichts dieses halben Jahrhunderts ziehen? Der in diesem Jahr vorgestellte Jahresbericht von amnesty international füllt wie bislang viele hundert Seiten lediglich mit den am besten dokumentierten Fällen. In über 120 Staaten der Welt werden Menschen gefoltert oder misshandelt, in über 90 Staaten sind gewaltlose politische Gefangene in Haft, in rund 70 Staaten werden Menschen Opfer politischer Morde oder von »Verschwinden-lassen«. Es muss von horrenden Dunkelziffern ausgegangen werden. Ein Blick in die Tagespresse reicht aus, um ein ernüchterndes Bild von der Lage der Menschenrechte in der Welt am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zu zeichnen. Dennoch sehen viele in der Idee der Menschenrechte und ihrer fortschreitenden Implementierung in die Organe der Staaten und Völkergemeinschaft gerade nach Beendigung des Kalten Krieges Anlass zur Hoffnung. Aktuell richtet sich der Blick auf die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshof mit seiner wahrscheinlich großen Bedeutung für die Einklagbarkeit der Menschenrechte.
Welche Rolle kann in dieser Situation Menschenrechtserziehung spielen?
Ein Wertekanon, wie er sich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausdrückt, bedarf einer angemessenen Wertevermittlung, wenn er von der breiten Bevölkerung getragen werden soll. Die Frage nach geeigneten Mechanismen zur Wertevermittlung bzw. -erziehung wird seit geraumer Zeit in verschiedenen Kontexten wissenschaftlich zu beantworten gesucht. Beiträge finden sich unter den Überschriften Friedens-, Mündigkeits-, Demokratie- oder eben Menschenrechtserziehung. Vielerorts findet sich dort die Forderung nach einer ganzheitlichen Werteerziehung, was den Einbezug von kognitivem, emotionalem sowie handlungsorientiertem Lernen meint. Was bedeutet das für die Menschenrechtserziehung in Deutschland? Welche Ziele verfolgt sie? Welche Erfolge lassen sich verbuchen? Welche Perspektiven für die Zukunft ergeben sich daraus?
Welche Ziele verfolgt Menschenrechtserziehung?
Ich zitiere hier die Zielsetzungen der »Empfehlung zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule« der Kultusministerkonferenz von 19807. Sie reiht sich in Ansätze ein, welche mit Kognitionen, Emotionen und Handlungen arbeiten oder anders ausgedrückt bei »Kopf, Herz und Hand« ansetzen, und ist somit exemplarisch zu nennen. Dies wird an den im Folgenden geschilderten drei Zielen von Menschenrechtserziehung deutlich:
- Menschenrechtserziehung soll Kenntnisse und Einsichten vermitteln, z.B. in die sozialen, ökonomischen und politischen Gründe der weltweit festzustellenden Menschenrechtsverletzungen.
- Die Frage nach der Verwirklichung der Menschenrechte soll ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der politischen Verhältnisse werden.
- In dem Schüler und der Schülerin soll die Bereitschaft geweckt werden, sich für die Verwirklichung der Menschenrechte einzusetzen. Er und sie sollen sich für die Rechte anderer einsetzen.
Mit dieser Empfehlung liegt in Deutschland erstmalig eine Stellungnahme von offizieller Seite zur Ausgestaltung von Menschenrechtserziehung vor. Die Kultusministerkonferenz betont hier ausdrücklich, dass es nicht ausreicht, lediglich Kenntnisse im Bereich der Menschenrechte zu vermitteln. Es erscheint einleuchtend, dass ein Wissen über die Menschenrechte, das vokabelgleich gelernt und abgefragt wird, nicht geeignet sein kann, Haltungen oder sogar Handlungen heranwachsender Menschen zu beeinflussen. Das Wissen um Menschenrechte und deren Verletzungen soll ergänzt werden durch eine emotional relevante Bewertung dieses Wissens. Im gewünschten Fall wird die Verletzung von Menschenrechten abgelehnt. Schließlich sollte die Erziehung zur Wahrung der Menschenrechte immer auch handlungsorientiert sein. Neben dem politischen Engagement gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich im schulischen Umfeld für die eigenen oder die Rechte anderer einzusetzen. Dieses »sich einsetzen« für die Menschenrechte ist das Letztkriterium der Kultusministerkonferenz8.
Welche Erfolge lassen sich verbuchen beim staatlichen Engagement?
Die bislang erfolgten Evaluationen zur Umsetzung der KMK-Empfehlung zeichnen ein eher ernüchterndes Bild. So führte Peter-Michael Friedrichs 1990, also zehn Jahre nach der Empfehlung, eine kurze Umfrage durch, in der er bei allen Kultusministerien anfragte, inwiefern die Empfehlung umgesetzt worden sei und bat um Zuschickung relevanter Unterlagen.
Die ihm aus den (alten) Bundesländern daraufhin zugeschickten Materialien, sprich Unterrichts- und Ausbildungskonzepte, passten bequem in einen Schuhkarton. Daneben wurde ihm versichert, welch hohen Stellenwert die Thematik habe. Sicher ist der Umfang solcher Materialien allein noch kein Beleg für mangelndes Engagement. Innerhalb des Schuhkartons ist nach Dafürhalten von Friedrichs der Anteil von relativ unsystematisch erstellten und kaum evaluierten Konzepten jedoch recht hoch. Außerdem zeigt sich eine Schiefe zugunsten einer inhaltlichen Bearbeitung der Thematik und zuungunsten von bewusstseinsschaffenden Ansätzen sowie der Förderung von Engagement.
Ausgehend von dieser Datenlage führte ich zu Beginn dieses Sommersemesters eine Studie an der Universität Trier durch, welche insgesamt 95 teilnehmende Studierende eines Seminars zur Menschenrechtserziehung mittels Fragebogen befragte. Es handelte sich um 42 Lehramtskandidatinnen und –kandidaten sowie um 53 Studierende des Diplom-Studienganges Pädagogik. Bis auf fünf Personen begannen alle ihre Schulzeit 1980 oder später, also nach der Empfehlung der KMK, alle schlossen mit Abitur ab. Mit diesen Voraussetzungen stellen die Befragten natürlich keine repräsentative Stichprobe dieser Altersgruppe dar. Sie sind überdurchschnittlich lange schulisch ausgebildet und haben im Schnitt eine zweijährige Universitätskarriere hinter sich. Der Fragebogen thematisiert u.a. folgende Punkte:
- Die Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
- Die Effekte von Menschenrechtserziehung in Anlehnung an die Ziele der KMK.
Im ersten Teil des Fragebogens wurden die Studierenden aufgefordert, spontan aufzuschreiben, welche Menschenrechte sie kennen. Obwohl bereits die Nennung eines Stichwortes aus einem Artikel zur Bewertung »Artikel gekannt« führt, »kennen« die Studierenden im Schnitt nur 5,4 Menschenrechtsartikel. Es ist festzustellen, dass die Studierenden ein im Schnitt nur rudimentäres Wissen über den Gegenstand der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besitzen9. Diese Ergebnisse decken sich mit Untersuchungen von Sommer et al.10, die einen noch deutlich geringeren Kenntnisstand (vermutlich aufgrund einer restriktiveren Auswertung der Angaben der Studierenden) konstatieren.
Im zweiten Teil des Fragebogens wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz von 1980 Effekte in der schulischen Ausbildung der Befragten hatten. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, den Erfolg ihrer eigenen schulischen Menschenrechtserziehung, gemessen an den Zielsetzungen der KMK im Wortlaut, auf einer 5-stufigen Ratingskala einzuschätzen. Dabei wurden die verschiedenen Ziele der KMK in der Wahrnehmung der Studierenden bei ihnen selbst als zwischen »eher nicht« und »mittel« von der Schule erreicht angesehen. Besonders wenig wurde es danach von der Schule erreicht, zu ermöglichen, „das Verhältnis von universeller Geltung und jeweiliger nationaler Entfaltung der Menschenrechte zu beurteilen„ sowie die Studierenden zu befähigen, „sich in ihrem persönlichen und politischen Lebensumkreis für die Realisierung der Menschenrechte einzusetzen„. Ergänzend zu den Zielen der KMK wurde nachgefragt, ob und inwiefern die Studierenden sich selbst aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen. Die Beantwortung dieser Frage weist den niedrigsten Mittelwert aller erhobener Items auf. So sagen 62,1 Prozent der Befragten, dass sie sich »gar nicht« oder »eher nicht« für die Menschenrechte einsetzen. Nur jede zehnte befragte Person sagt von sich selbst, sie würde sich »etwas« für die Menschenrechte einsetzen. Insgesamt werden also die Ziele der KMK als »wenig« bis »mittelmäßig« erreicht angesehen. Insbesonders eigene Möglichkeiten der Realisierung der Menschenrechte werden eher nicht als von der Schule vermittelt gesehen. Darf man den Selbstauskünften Glauben schenken, so ist das größte Manko in der mangelnden Initiierung entsprechenden Verhaltens zu sehen. Angesichts der hohen Selektivität dieser Stichprobe ist davon auszugehen, dass die Ziele bei anderen Gleichaltrigen in noch deutlich geringerem Maße verwirklicht wurden.
Das ernüchternde Bild zum Stand der Menschenrechtserziehung, welches sich hier darstellt, deckt sich mit vielen Aussagen von Lehrpersonen und Schülern, die im Rahmen von Studientagen oder Fortbildungen zu hören sind. Selbst die inhaltliche Vermittlung der Menschenrechte kann nicht als gewährleistet gesehen werden. Das Erzeugen eines Menschenrechtsbewusstseins sowie das Initiieren von Engagement bleibt weit hinter den Zielen zurück.
Welche Erfolge lassen sich beim individuellen und ehrenamtlichen Engagement verbuchen?
An dieser Stelle soll die tragende Rolle der NGOs, der Nicht-Regierungs-Organisationen, angesprochen werden. Die größten Organisationen, die Engagement in der Frage der Menschenrechtserziehung zeigen, sind u.a. die kirchlichen Organisationen wie Missio, Miserior, Diakonisches Werk oder die Jugendverbände. Daneben arbeiten nicht konfessionell gebundene Organisationen wie Terre des Hommes und nicht zuletzt amnesty international zur Menschenrechtserziehung. Spezielle Fragen der Menschenrechte werden vom Deutschen Roten Kreuz oder der Deutschen Welthungerhilfe bearbeitet. Daneben existieren verschiedene kleinere bundesweit oder regional arbeitende Gruppen. Diese Organisationen leisten seit geraumer Zeit wohl den entscheidenden Beitrag zur Menschenrechtserziehung in Deutschland.
Es werden vielfältige Ansätze wie z.B. konkrete Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung oder Konzepte zur Weiterbildung, Gottesdienste und öffentliche Veranstaltungen entwickelt und angeboten. So sehr dieses Engagement grundsätzlich erfreuen mag, so wenig lässt sich leider leugnen, dass selbst relativ mitgliederstarke Organisationen wie amnesty international massiv in ihren personalen und finanziellen Ressourcen limitiert sind.
Es ist festzustellen, dass auch das hohe Engagement nichtstaatlicher Organisationen dem immer wieder verlauteten Stellenwert der Menschenrechtserziehung nicht entsprechen kann. So verbleibt der Entwicklungsstand der Menschenrechtserziehung weit unter dem theoretisch Möglichen.
Welche Perspektiven für die Zukunft ergeben sich daraus?
An vielen Schulen Deutschlands zeigen sich trotz der mangelnden Förderung von Menschenrechtserziehung ermutigende Beispiele. So führen z.B. die Unesco-Projektschulen vielfach Projekte und Aktionen in diesem Jahr zu den Menschenrechten durch. Diese in Deutschland etwa 100 Schulen erheben die Behandlung der Menschenrechte zu einem ihrer Grundsätze11. Immer wieder finden sich auch in anderen Schulen einzelne engagierte Lehrpersonen, die ausgezeichnete Konzepte entwickeln und durchführen. In Kontakten mit solchen Lehrpersonen wird deutlich, dass diese Personen mit großem Lerngewinn für ihre SchülerInnen wie für sich selbst, aber auch mit spürbar positiven Konsequenzen für die Klassen- und Schulatmosphäre, Menschenrechtsthemen bearbeiten. Diese Ansätze zu stärken möchte ich als das erste Ziel für die Zukunft bezeichnen. Wenn sich die Erziehung zur Wahrung der Menschenrechte Hand in Hand mit der Demokratie- oder der Friedenserziehung flächendeckend positiv entwickeln soll, sind unterschiedliche konkrete Forderungen denkbar, welche nun ansatzweise dargestellt werden sollen.
- Es sollte eine Neufassung der KMK-Erklärung von 1980 in Form eines Erlasses verabschiedet werden. Insbesonders die Schulbuchverlage orientieren sich nach eigenen Aussagen sehr eng an solchen Vorgaben. Vorreiter ist Nordrhein-Westfalen, das 1997 einen Erlass zur Förderung der Menschenrechtserziehung herausgab. Andere Bundesländer wie Bayern oder das Saarland signalisieren ähnliche Initiativen, doch ein umfassender KMK-Beschluss wäre natürlich von größerem Gewicht.
- Die in der KMK-Erklärung aufgeführten Ziele sollten verbindlich in die Lehrpläne, Richtlinien oder Curricula der Fächer im historisch-politischen Lernfeld, aber auch darüber hinaus, aufgenommen werden. Außerdem wäre die Produktion geeigneter Schulbücher und sonstiger Lehr- und Lernmittel anzuregen und von Regierungsseite zu unterstützen12
- Pädagogische Konzepte müssten professionell, z.B. von den Staatsinstituten für Schulpädagogik, entwickelt und bekannt gemacht werden.
- Menschenrechtserziehung sollte zum verbindlichen Gegenstand der offiziellen Lehrpersonenaus- und -fortbildung gemacht werden.
- Im Bereich der außerschulischen Bildung sollten informelle Menschenrechtserziehungsprojekte (wie z.B. Straßentheater, Workshops, Cartoons, Trainingsprogramme für Multiplikatoren etc.) entwickelt werden, damit auch Menschen – insbesondere Jugendliche, die den formalen Erziehungsbereich verlassen haben – mit Menschenrechtsprogrammen erreicht werden können.
- Die Bundesregierung sollte aufgefordert werden, eine Nationale Koordinierungsstelle zur Menschenrechtserziehung einzurichten. In der Erklärung zur Dekade der Menschenrechtserziehung der UNO von 1995-2004 wird eine solche Stelle gefordert. In Österreich ist diese Forderung in Form der »Servicestelle für Menschenrechtserziehung« in Wien bereits erfüllt13
Dipl. Psych. Dipl. Päd. Lothar Müller ist Sprecher der Sektionskoordinationsgruppe Menschenrechtserziehung bei amnesty international Deutschland. Er arbeitet am FB 1 Pädagogik der Universität Trier, Universitätsring 15, 54286 Trier.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(Kurze Zusammenfassung)
Bürgerliche und politische Rechte
- Menschen sind frei und gleich geboren;
- universeller Anspruch auf Menschenrechte, Verbot der Diskriminierung nach Rasse, Geschlecht, Religion, politischer Überzeugung usw.;
- Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit;
- Verbot von Sklaverei;
- Verbot von Folter und grausamer Behandlung;
- Anerkennung des Einzelnen als Rechtsperson;
- Gleichheit vor dem Gesetz;
- Anspruch auf Rechtsschutz;
- Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Ausweisung;
- Anspruch auf unparteiisches Gerichtsverfahren;
- Unschuldsvermutung bis zu rechtskräftiger Verurteilung, Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen;
- Schutz der Freiheitssphäre (Privatleben, Post…) des Einzelnen;
- Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit;
- Asylrecht;
- Recht auf Staatsangehörigkeit;
- Freiheit der Eheschließung, Schutz der Familie;
- Recht auf individuelles oder gemeinschaftliches Eigentum;
- Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;
- Meinungs- und Informationsfreiheit;
- Versammlungs- und Vereinsfreiheit;
- Allgemeines gleiches Wahlrecht.
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
- Recht auf soziale Sicherheit, Anspruch auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte;
- Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, befriedigende Arbeitsbedingungen; Schutz vor Arbeitslosigkeit; Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, angemessene Entlohnung, Berufsvereinigungen;
- Anspruch auf Erholung, Freizeit und Urlaub;
- Anspruch auf ausreichende Lebenshaltung, Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Wohnung, ärztliche Betreuung und soziale Fürsorge;
- Recht auf Bildung, Elternrecht; Entfaltung der Persönlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Freundschaft zwischen den Nationen als Bildungsziele;
- Recht auf Teilnahme am Kulturleben;
- Recht auf eine soziale und internationale Ordnung, die die Rechte verwirklicht;
- Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, Beschränkungen mit Rücksicht auf Rechte anderer;
- Absoluter Schutz der in diesen Menschenrechten angeführten Rechte.
Allgemeine Literatur zu Menschenrechten.
amnesty international (1993). Menschenrechte vor der Jahrhundertwende. Frankfurt a.M..
Bielefeldt, H. (1998). Philosophie der Menschenrechte. Darmstadt: Primus.
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.)(1995). Menschenrechte – Dokumente und Deklarationen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Bungarten, P. & Koczy, U. (Hrsg.)(1996). Handbuch der Menschenrechtsarbeit. Bonn: Dietz. (Handbuch zur deutschen und europäischen Menschenrechtsarbeit und -politik mit vielen wichtigen Informationen und Adressen)
Braßel, F. & Windfuhr, M. (1995). Welthandel und Menschenrechte. Bonn: Dietz.
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (1998). Bericht über die menschliche Entwicklung 1998. Bonn: UNO-Verlag.
Dialektik 1987, Heft 13 (Die Rechte der Menschen)
Evangelische Kirche Deutschland (Hrsg.)(1996). Menschenrechte und Entwicklung. Frankfurt a.M..
FIAN (Hg.). (1998). Food First. Bonn: Dietz.
Heinz, W. S. (1986). Menschenrechte in der Dritten Welt. München: Beck.
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.). (1995). Die Rolle der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte im Kontext des UN-Weltsozialgipfels. Bonn.
Human Rights Watch (1992). World Report. New York.
Hutter, F.-J. & Tessmer, C. (Hrsg.)(1997). Die Menschenrechte in Deutschland. München: Beck.
Könitzer, B. & Martens, J. (Hrsg.)(1997). UN-williges Deutschland. Der WEED-Report zur deutschen UNO-Politik. Bonn: Dietz.
Kühnhardt, L. (1991). Die Universalität der Menschenrechte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Nowak, M. (Ed.). (1994). World Conference on Human Rights: Vienna, June 1993. The Contribution of NGOs. Reports and Documents, Wien.
Weiß, N., Engel, D. & d’Amato, G. (1998). Menschenrechte. Vorträge zu ausgewählten Fragen. Berlin: Berlin Verlag.
Tetzlaff, R. (Hrsg.). (1993). Menschenrechte und Entwicklung. Bonn: Stiftung Entwicklung und Frieden.
United Nations (1995). The United Nations and Human Rights, 1945-1995. New York: United Nations.
Widerspruch, Juli 1998, Heft 35 (Menschenrechte)
Prof. Dr. Gert Sommer, Vorsitzender des Forum Friedenspsychologie (FFP) und der Interdisziplinären Arbeitsgruppe für Friedens- und Abrüstungsforschung an der Universität Marburg
Martin Quack, Katharina Wegner (Kirchenrätin), tätig im Menschenrechtsreferat im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Postfach 210220, 30402 Hannover
Monika Gerstendörfer, Dipl.-Psychologin, Lobby für Menschenrechte, Postfach 1030, 72541 Metzingen.
Herbert Leuninger, Europareferent von PRO ASYL – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge, Postfach 101843, 60018 Frankfurt.
Dipl.-Politologin Andrea Gourd, seit 1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg, Wilhelm-Röpke-Str.6, 35032 Marburg.
Dipl. Psych. Dipl. Päd. Lothar Müller ist Sprecher der Sektionskoordinationsgruppe Menschenrechtserziehung bei amnesty international Deutschland. Er arbeitet am FB 1 Pädagogik der Universität Trier, Universitätsring 15, 54286 Trier.