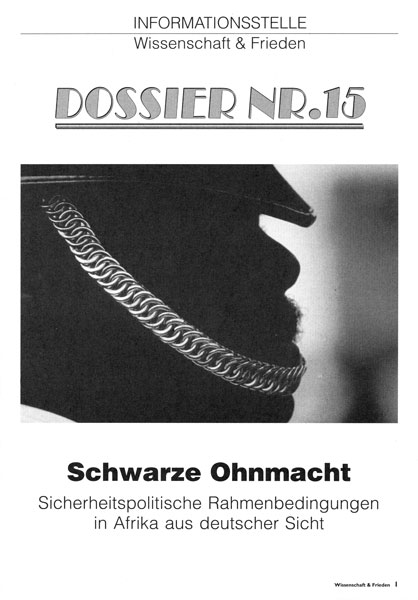Schwarze Ohnmacht – Sicherheitspolitische Rahmenbedingungen in Afrika aus deutscher Sicht
von Klaus Schlichte, Dirk Hansohm und Peter Körner
zum AnfangKriege und Konflikte in Afrika
von Klaus Schlichte
Die »Chaosmacht Afrika« sorgt seit der Dekolonisationsphase für die gleichen Schlagzeilen: Hunger, Krieg, Flüchtlingselend und Despotismus scheinen die herausragenden Besonderheiten afrikanischer Gesellschaften zu sein. Das Ende der kolonialen Epoche hat daran nichts geändert. Weder konnten im subsaharischen Afrika1 die Entwicklungsträume der sechziger Jahre verwirklicht werden, noch haben sich die nachkolonialen Staaten zu wirklichen Nationalstaaten entwickeln können. Das Charakteristikum des Kriegsgeschehens auf dem afrikanischen Kontinent wie anderswo ist, daß zwischenstaatliche Kriege an Bedeutung verloren haben, während innenpolitische Konflikte sich häufig zu Bürgerkriegen entwickeln. Das ist keineswegs in allen afrikanischen Staaten der Fall, doch die Staaten, deren Geschichte seit 1960 ohne Kriege, Revolten und ethnische Massaker verlaufen ist, können in der Tat fast an einer Hand abgezählt werden: Botswana, Benin, Côte d'Ivoire, Ghana und die Inselstaaten der Kapverden, Sao Tomé und Principe beispielsweise blieben bisher von größeren gewaltsam ausgetragenen Konflikten verschont.
Doch dieser Abriß soll nicht die Vielzahl der gewaltsamen Eskalationen in der nachkolonialen Geschichte Afrikas südlich der Sahara behandeln, sondern lediglich einen Überblick über die am Ende des Jahres 1993 laufenden Kriege geben. Zu diesem Zeitpunkt fanden in dieser Region 14 Kriege statt, den Bürgerkrieg in Algerien dabei allerdings eingeschlossen.2 Ergänzend zu kurzen Beschreibungen dieser Kriege findet sich am Ende des Beitrags eine Auflistung weiterer sechs innenpolitischer Konflikte, deren Einschätzung als »Krieg«3 nach Angaben der »Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung« (AKUF), Universität Hamburg, noch zweifelhaft ist. Denn gemäß der verwendeten operationalen Definition können gewaltsam ausgetragene Massenkonflikte nur dann als Kriege gelten, wenn es sich bei mindestens einer der kampfbeteiligten Parteien um reguläre Streitkräfte einer Regierung handelt, wenn beide Seiten mit einem Mindestmaß an zentraler Organisation agieren und wenn die bewaffneten Zusammenstöße mit einer gewissen Kontinuität auftreten.
Neben dem durch die internationale Intervention bekannt gewordenen Krieg in Somalia gibt es eine Reihe von Kriegen auf dem afrikanischen Kontinent, die ihrer langen Dauer wegen ebenfalls einem breiteren Publikum zumindest ihrem Schauplatz nach bekannt sind. Hierzu zählen die Kriege in Angola und Mosambik, Sudan und Tschad, aber auch der Anti-Apartheids-Krieg in der Republik Südafrika.
Angola
Die Konflikte in den ehemaligen portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik weisen in einiger Hinsicht Parallelen auf. Nach dem Zusammenbruch des portugiesischen Kolonialreiches, zu dem die Befreiungskriege in den Kolonien wesentlich beitrugen, erhielten die dortigen Ereignisse einerseits deshalb eine besondere Brisanz, weil sie in unmittelbarer Nähe zu den fortdauernden Dekolonisationskriegen im südlichen Afrika stattfanden (Namibia, Südafrika, Rhodesien). Zum anderen standen schon die Staatsgründungen Mosambiks und Angolas unter dem Stern des Ost-West-Konflikts, der eine wesentliche Bedingung für die Persistenz der Bürgerkriege in diesen Ländern war. Im Sommer 1975 brach in Angola der Krieg zwischen den Befreiungsbewegungen noch vor der offiziellen Erlangung der Unabhängigkeit aus. Schon zu diesem Zeitpunkt hatten die weltpolitischen Mächte ihre Karten verteilt: Während die MPLA4 weiterhin von der Sowjetunion und Kuba Unterstützung erfuhr, lieferten die USA und die Republik Südafrika Waffen an die UNITA und FNLA. Diese Konstellation dauerte bis zum Ende der achtziger Jahre fort, um zwischenzeitig zu der weltpolitischen Absurdität zu führen, daß von US-amerikanischen Gesellschaften betriebene Ölförderanlagen von kubanischen Soldaten beschützt wurden, weil die Exporterlöse der MPLA-Regierung zugute kamen. Das Ende des Ost-West-Konfliktes machte im südlichen Afrika aber nicht nur die Unabhängigkeit Namibias möglich, sondern erlaubte auch ein Ende des Krieges in Angola. Die UNITA erkannte jedoch den im September 1992 erlangten Wahlsieg der MPLA nicht an. Nach nur eineinhalb Jahren Waffenruhe wurde der Krieg im Oktober fortgesetzt. Mittlerweile hat die UNITA jedoch auf die offizielle externe Unterstützung aus den USA und durch Südafrika verzichten müssen. Doch soll die UNITA nach wie vor von privaten südafrikanischen Kreisen und von Zaire unterstützt werden.
Angola zählt infolge des nunmehr über dreißigjährigen Kriegszustandes zu den am stärksten von Kriegsfolgen betroffenen Ländern der Welt. Noch am Ende des Jahres 1993 fordert dieser Krieg pro Woche Tausende von Opfern.
Auch während der kurzen Waffenruhe in Angola blieb dort ein Landesteil weiter umkämpft: in der ölreichen Enklave Cabinda führt eine Sezessionsbewegung einen bislang erfolglosen Guerillakrieg. Diese Bewegung hat sich vor allem durch Bombenanschläge und die Entführung von Ausländern Gehör verschafft. Für das vom Krieg zerstörte Angola bleiben die Öleinnahmen aus der Enklave aber unabhängig vom weiteren Schicksal des Landes unverzichtbar.
Mosambik
Der Krieg in Mosambik fand durch die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen der FRELIMO-Regierung und der RENAMO im Oktober 1992 ein vorläufiges Ende. Auch dieser Krieg wurde durch den Ost-West-Konflikt und seine Auswirkungen auf die Subregion des südlichen Afrika wesentlich verschärft. Die RENAMO war ursprünglich eine Kreation des rhodesischen Geheimdienstes, die dann von Südafrika unterhalten wurde. Ob der opferreiche Krieg in Mosambik dauerhaft beendet ist, muß noch bezweifelt werden. Bisher sind die kämpfenden Fraktionen weder kaserniert noch entwaffnet, und die von der RENAMO mit terroristischen Mitteln errichtete Kriegswirtschaft wird nur sehr schwer zu zivilen Formen zurückfinden können. Mehrere Millionen Mosambikaner sind vor dem Krieg in die Nachbarländer geflohen. Ihrer Remigration steht nicht nur eine völlig ruinierte Ökonomie entgegen, sondern auch die unbeseitigte Menge von 2,5 Millionen Landminen. Mosambiks Rückkehr zur Normalität wird länger dauern als geplant. Die für Oktober 1993 vorgesehenen Wahlen wurden bereits um ein Jahr verschoben.
Tschad
Auch die Regierung Idriss Deby konnte den seit 1966 im Kriegszustand befindlichen Tschad nicht befrieden. Stattdessen wird sie international vor allem wegen umfangreicher Menschenrechtsverletzungen kritisiert: Sie soll in zwei Jahren über 500 Hinrichtungen vollstreckt haben und über 1000 politische Gefangene festhalten. Neben Übergriffen von Polizisten auf Demonstranten ereigneten sich auch 1993 Massaker zwischen diversen »ethnischen Gruppen«, angeführt von amtierenden oder ehemaligen Mitgliedern der Staatsklasse. Eine internationale Dimension erhielt dieser Krieg nicht nur durch die großen Flüchtlingsbewegungen, die er auslöste, sondern auch durch den Anspruch Libyens auf den Aouzou-Streifen im Norden des Tschad, was zwischenzeitig Frankreich und die USA auf den Plan rief, die die wechselnden Regime in N'Djamena unterstützten.
Nach Versuchen, am Jahresbeginn 1993 mit einer Nationalkonferenz zur Befriedung des Landes zu gelangen, ist der Krieg mittlerweile wieder im vollen Gange: Seit August 1993 wird im Gebiet des Tschadsees gekämpft.
Sudan
Der seit 1983 geführte Krieg in den südlichen Landesteilen des Sudan, der schon einen von 1956 bis 1972 dauernden Vorläufer hatte, nahm in der jüngeren Vergangenheit insofern eine Wende, als die Regierungstruppen seit 1992 große Geländegewinne erzielen konnten. Die im Süden kämpfende Bewegung hatte sich 1991 gespalten, später kam es auch zu Kämpfen zwischen diesen Flügeln, so daß die Truppen der Zentralregierung rasch vordringen konnten. In diesem Krieg sind bisher über eine halbe Million Menschen ums Leben gekommen, rund 3,5 Nationen sind in die Nachbarländer geflohen. Große Teile der Bevölkerung sind periodisch von Hungerkatastrophen bedroht.
Republik Südafrika
Auch die Auseinandersetzungen im Verlauf der Umwandlung des Apartheidsystems in der Republik Südafrika haben nach wie vor Kriegscharakter. Zwar hat der African National Congress (ANC) schon 1990 den bewaffneten Kampf gegen das Minderheitsregime suspendiert, der systematische Terror der konservativen Zulu-Organsation Inkatha gegen den ANC wird aber von Staatsorganen unterstützt. Mittlerweile gibt es Bündnisse zwischen Homeland-Führern und burischen Rechtsparteien, während die blutigsten Kämpfe zwischen Anhängern des ANC und der Inkatha stattfinden. Die Allianzen in diesem seit 1976 andauernden Krieg haben sich also verschoben, am Konfliktgegenstand, der Abschaffung des Apartheidsystems, hat sich jedoch nichts geändert. Über 14.000 Menschen kamen in diesem Krieg bisher ums Leben.
Somalia
Unter mindestens ebenso großer internationaler Beachtung entwickelte sich der Krieg in Somalia, vor allem seit Beginn der Intervention im Dezember 1992. Eine friedliche Regelung dieses Krieges wird vor allem dadurch erschwert, daß der somalische Staat schon seit geraumer Zeit aufgehört hat zu existieren. Der seit 1988 laufende Krieg hat die ohnehin stark fraktionierte somalische Gesellschaft ohne jede übergeordnete politische Institution zurückgelassen. Auch die von der internationalen Staatengemeinschaft getragene Intervention hat bisher keine tragfähigen Ansätze zu einer politischen Regelung des Konflikts erkennen lassen. Das weitere Schicksal Somalias ist schon insofern völlig ungewiß, als die territoriale Integrität des Landes durch die Proklamation eines unabhängigen »Somalilands« im Nordwesten in Frage gestellt ist.
Die vergessenen Kriege
Neben diesen international viel beachteten Kriegen gibt es auf dem afrikanischen Kontinent aber noch eine Vielzahl von Bürgerkriegen, über die in der deutschen Publizistik nur vereinzelt etwas zu erfahren ist. Die Auseinandersetzungen in der Casamance (Senegal), in Mali, Niger, Algerien, Liberia, Sierra Leone, Rwanda, Uganda, Äthiopien und Djibouti haben gleichwohl schon vor Jahren die Schwelle vom Konflikt zum Krieg überschritten.
Ein Beispiel für solch einen »vergessenen Krieg«, ist der Kampf unterschiedlicher Gruppen der Tuareg in der südlichen Sahara, von dem vor allem die Länder Mali und Niger betroffen sind. Die ökologische und ökonomische Degradation in den nördlichen Provinzen dieser Länder hat in den siebziger und achtziger Jahren zu Fluchtbewegungen nach Libyen, Algerien und in verschiedene westafrikanische Länder geführt. Von dort ausgewiesen, kehrten Ende der achtziger Jahre viele Tuareg nach Mali und Niger zurück, ohne dort indes verbesserte Bedingungen vorzufinden. Im Mai 1990 kam es in Niger schließlich erstmals zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Tuareg-Organisationen und Regierungstruppen, wenig später auch in Mali. Neben einer Verbesserung der Versorgung forderten die Tuareg den Abzug der Regierungstruppen aus ihren Siedlungsgebieten sowie Autonomiebestimmungen. Auch die demokratischen Umgestaltungen, die Mali und Niger zu Beginn der neunziger Jahre erfuhren, konnten die Kämpfe zunächst nicht beenden. Die traditionell hohe Mobilität der Tuareg und die Fluchtbewegungen infolge des Kriegsausbruchs haben den Konflikt zudem zu einem sicherheitspolitischen Problem für die Nachbarstaaten Algerien, Libyen und Mauretanien werden lassen. In Mali wurde 1992 zwar ein »Nationalpakt« von der neuen demokratischen Regierung und den Tuareg-Organisationen unterzeichnet, Anschläge auf Regierungseinrichtungen gab es aber weiterhin. Die starke Fraktionierung der Tuareg macht ein heftigeres Wiederaufflammen der Kämpfe durchaus möglich. Auch in Niger gingen die Kämpfe 1993 weiter.
Die Regierung in Algerien hat schon deshalb ein Interesse an der Regelung des Tuaregproblems, weil sie selbst in einen Krieg mit islamischen Fundamentalisten verwickelt ist. Mit über 250 Hinrichtungen allein im Jahr 1993 hat die Regierung versucht, auf die Attentatswelle der FIS zu reagieren, die sich vor allem gegen Intellektuelle und politische Funktionsträger richtet.
Durch die Unabhängigkeit Eritreas und das Ende des Krieges in der Provinz Tigray hat sich die innenpolitische Lage in Äthiopien zwar entspannt, doch als befriedet kann auch dieses Land nicht gelten. Nach großen Schwierigkeiten bei den Regionalwahlen und der demokratischen Umgestaltung im Sommer 1992 nahmen die Sezessionisten aus der Provinz Oromo den Kampf gegen die Zentralregierung wieder auf.
Im benachbarten Djibouti führt die Ethnie der Afar mit ca. 5000 Kämpfern einen Aufstand gegen das Regime. Dieses wurde zeitweilig von den USA und Frankreich militärisch und finanziell unterstützt. Die französischen Truppen, die zur Überwachung eines Waffenstillstands eingesetzt worden waren, wurden allerdings bis Ende 1992 wieder abgezogen. Die neu aufgerüstete Armee führte bis zum Sommer 1993 eine Offensive gegen die Aufständischen durch. Da die Ziele dieser Offensive aber nicht erreicht werden konnten, weil die Afar sich zunehmend auf Guerrillataktiken verlegten, gingen die Regierungsssoldaten im Spätsommer 1993 zunehmend zu Übergriffen auf Zivilisten über. 20.000 Menschen sind aus Djibouti nach Äthiopien geflohen, während die 120.000 somalischen Flüchtlinge in Djibouti dort etwa 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Im ostafrikanischen Rwanda führt eine Rebellenorganisation seit Oktober 1990 Krieg gegen das amtierende Regime, das vorübergehend mit Kontingenten aus Zaire und Belgien unterstützt wurde. Nach wie vor befinden sich französische Soldaten in Rwanda, vorgeblich, um die dort lebenden französischen Staatsangehörigen zu beschützen. Die Rebellen rekrutieren sich vor allem aus Flüchtlingen, die sich seit den sechziger Jahren nach Uganda abgesetzt hatten. Im Verlauf des Konflikts schlugen sich aber auch andere Oppositionsgruppen auf ihre Seite, so daß der gemeinhin als ursächlich betrachtete Konflikt zwischen den Ethnien der Tutsi und Hutu kaum zur Erklärung dieses Krieges dienen kann. Auch in Rwanda hat der Krieg die innenpolitische Entwicklung verschärft. So mußte das Regime Juvénal Habyarimanas 1992 schließlich eine Beteiligung der Oppositionsparteien an der Regierung akzeptieren. Im August 1993 wurde unter Vermittlung der Nachbarstaaten und der OAU erneut ein Friedensabkommen unterzeichnet, dessen Erfolg allerdings abzuwarten bleibt. Noch im Herbst 1993 war das innenpolitische Klima in Rwanda durch Bombenanschläge und Attentate gekennzeichnet.
Der seit 1981 laufende Krieg in Uganda kann ebenfalls noch nicht als beendet betrachtet werden. Zwar gelang es der Regierung Museveni im Verlauf des Jahres 1992, die Aktivitäten von Rebellen und Banditen im Norden und Nordosten auf ein Minimum zu beschränken. Die innere Sicherheit blieb aber schon wegen der Rückwirkungen der Konflikte in den Nachbarstaaten Rwanda, Sudan und Zaire beeinträchtigt. Über eine halbe Million Menschen fanden im Verlauf des ugandischen Bürgerkriegs den Tod. Auch soll der Krieg wesentlich zur beschleunigten Ausbreitung von AIDS in Uganda beigetragen haben: Mehr als eine Million der 16 Millionen Einwohner sollen davon infiziert sein.
Im westafrikanischen Liberia herrscht seit Ende 1989 Krieg. Mittlerweile hat die Rebellengruppe, die von Côte d'Ivoire kommend das alte Regime angriff, rund zwei Drittel des Territoriums unter die Kontrolle ihrer »warlords« bringen können, während eine Interventionstruppe der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, die sich vor allem aus Kontingenten der anglophonen Staaten zusammensetzt, die Hauptstadt Monrovia kontrolliert.5 Dort wurde eine Interimsregierung installiert, die nach einem vielversprechenden Abkommen im Sommer 1993 um Vertreter aller Kriegsparteien erweitert werden sollte. Die fortdauernden Kämpfe zwischen den Getreuen des alten Regimes und den Rebellen haben aber die Umsetzung des Abkommens bisher verhindert. Nigeria, das das größte Kontingent der ECOWAS-Eingreiftruppe stellt, hat inzwischen den Rückzug seiner Truppen zum März 1994 angekündigt. Die Erweiterung der Interventionstruppe um Kontingente aus Uganda, Zimbabwe, Tansania und Ägypten war zwar im Friedensabkommen im Sommer 1993 vereinbart worden, hat aber zum geplanten Zeitpunkt im Herbst nicht stattgefunden. Dennoch konstituierte sich Anfang Oktober 1993 das Übergangsparlament unter Beteiligung aller Kriegsparteien in der Hauptstadt, während auf dem Lande eine neue Welle von Plünderungen und Massakern an Zivilisten anhob.
Von den Auseinandersetzungen in Liberia sind auch die Nachbarstaaten Guinea und vor allem Sierra Leone betroffen. Die Übergriffe der Kämpfe auf das Territorium Sierra Leones haben dort die innenpolitische Krise so verschärft, daß es im April 1992 zu einem Militärputsch mit über hundert Todesopfern kam. Das neue, sich äußerst repressiv gerierende Regime machte durch Hinrichtungen vermeintlicher Putschisten von sich reden, erzielte aber militärische Erfolge gegen die mit den liberianischen Rebellen kooperierenden Aufständischen im eigenen Land.
Auch das gemeinhin als demokratisch bezeichnete Senegal kennt seit 1990 einen Guerillakrieg in der südwestlichen Provinz Casamance. Zwar hatte es schon 1991 ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Separatisten und der Zentralregierung gegeben, doch seit Mitte 1992 kam es zu erneuten Auseinandersetzungen. Eine friedliche Beilegung des Konflikts ist umso schwieriger geworden, als Teile der bewaffneten Separatisten sich der Kontrolle des politischen Teils ihrer Organisation entzogen zu haben scheinen.
Nachdem es 1989 in Senegal und Mauretanien Auseinandersetzungen zwischen Schwarzafrikanern und Mauren gegeben hatte, haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten zwar wieder verbessert. In Senegal lebende Exil-Mauretanier sollen sich aber in jüngerer Zeit ebenfalls zu bewaffneten Organisationen zusammengeschlossen haben, ohne daß dies indes bereits zu Angriffen auf mauretanisches Territorium geführt hätte.
Entstehende Kriege
Neben all diesen als Kriege zu bezeichnenden Konflikten in afrikanischen Staaten gibt es noch eine Reihe von innenpolitischen Entwicklungen, die bisher erst auf die Gefahr entstehender Kriege hindeuten.6 Dabei lassen sich zwei grobe Kategorien unterscheiden: Staaten wie Nigeria oder Burundi haben hinsichtlich ihrer ethnischen Diversität schlechte Erfahrungen hinter sich. Dort gibt es innenpolitische Konflikte im ethnischen Gewande trotz der politischen Bemühungen, sie einzudämmen.
In Zaire und Kenya hingegen sind es die autoritären Regime selbst, die ethnische Gegensätze zu ihrem Vorteil instrumentalisieren, während Demokratisierungsprozesse nur zur Währung der ohnehin bescheidenen Reste des internationalen Ansehens durchgeführt werden.
Burundi hatte gerade die wesentlichen Schritte zur demokratischen Umgestaltung absolviert, als am 21. Oktober 1993 durch einen Coup des Militärs die gerade viermonatige Herrschaft der demokratisch gewählten Regierung beendet wurde. Die auf ethnische Unterschiede reduzierten Gegensätze des Landes hatten schon in den Jahren 1972 und 1988 zu großen Massakern geführt. So gab es auch im Verlauf des Jahres 1992 im Nordosten gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Militärs und der Zivilbevölkerung. Der Abbruch der Demokratisierung verhindert gerade den Prozeß, der weitere Gewalteskalationen langfristig vielleicht hätte unterbinden können: die Ausbildung eines politischen Systems, das die Gegensätze mit friedlichen Mitteln ausbalancieren könnte.
In Nigeria hat sich unter fortdauernder Militärherrschaft nicht nur in und zwischen den politischen Partien ein Klima der Gewalt breitgemacht. Auch die Willkür von Polizei und Armee und die Zunahme des organisierten Verbrechens veminderten die innere Sicherheit. Zu Beginn der neunziger Jahre hat es in Nigeria wiederholt gewaltsame Konflikte zwischen ethnischen und religiösen Gruppen um Land und andere Ressourcen gegeben. Möglichkeiten, diese Konflikte friedlich beizulegen, werden durch die repressive Politik des Regimes erschwert, das die Bildung und Artikulation von religiösen, regionalen und ethnischen Interessengruppen untersagt hat.
Auch in Kenya kommt es seit Herbst 1991 wiederholt zu »ethnisch« motivierten Übergriffen im Rift Valley. Diese Ereignisse haben bisher Hunderte Tote gefordert und die Vertreibung von Zehntausenden verursacht. Hier steht allerdings das amtierende Regime im begründeten Verdacht, die vermeintlich »ethnisch motivierten« Übergriffe inszeniert zu haben, um aus einem »law-and-order«-Argument innenpolitisch rigider verfahren zu können und den wachsenden internationalen Legitimationsdruck abzuschwächen.
In Zaire blockiert das lange vom Westen unterstützte Regime Mobutus die demokratische Umgestaltung und Konsolidierung des Landes. Spätenstens seit 1992 steht Zaire am Rande eines neuen Bürgerkrieges. Insbesondere Zugriffe der Armee gefährden die innere Sicherheit. Ausbleibende Soldzahlungen veranlassen die Soldateska regelmäßig zu Übergriffen auf Zivilisten, 1992 soll es auch Scharmützel zwischen militanten Regimegegnern und Regierungssoldaten gegeben haben. Das Militär ist offenbar auch in die Kämpfe zwischen ethnischen Gruppen im Nordosten und in den Provinzen Kivu und Shaba beteiligt. In diesen Auseinandersetzungen kamen Schätzungen zufolge im Laufe des vergangenen Jahres mehr als 9000 Menschen ums Leben. Andere Schätzungen gehen mittlerweile von mindestens 150.000 Vertriebenen allein aus der Provinz Shaba aus. Die Ereignisse im südlichen Zaire sind allerdings in engem Zusammenhang mit dem Krieg in Angola zu sehen, wo noch loyal zu Mobutu stehende Regierungssoldaten auf der Seite der UNITA kämpfen. Die Herrschaft Mobutu Sese Sekus, der über Jahrzehnte westliche Unterstützung genoß, ist in weiten Teilen des Landes zusammengebrochen. Es bestehen wenig Aussichten, daß in diesen in die Anarchie verfallenen Landesteilen eine friedliche Umgestaltung möglich sein wird.
Auch in Togo haben innenpolitische Konflikte ein ethnisches Gepräge angenommen. Die privilegierte ethnische Gruppe des Präsidenten Eyadéma dominiert in den zivilen Schlüsselpositionen des Regimes, aber auch im Offizierkorps. Das Regime hat die Demokratisierungsbewegung bisher erfolgreich destabilisiert, so daß die seit 1991 erreichten Demokratisierungserfolge teilweise wieder rückgängig gemacht wurden. Nach zahllosen Übergriffen durch Polizei und Militär auf Demonstranten hat auch ein weitgehend befolgter Generalstreik über acht Monate der Demokratiebewegung nicht geholfen; zu sehr scheint die politische Szene vom Patronagenetz Eyadémas umspannt zu sein. Bei den Präsidentschaftswahlen, die nach vielen Verzögerungen doch im Sommer 1993 stattfanden, blieb der aussichtsreichste Kandidat der Opposition, Gilchrist Olympio, ausgeschlossen.
Gefahr droht dem Regime auch aus den eigenen Reihen: Im März 1993 waren es Offiziere und Soldaten der Armee Togos, die eine Absetzung des alten Regimes erreichen wollten. Ihr Putschversuch scheiterte jedoch. Mit den Putschisten sympathisierende Militärs flohen ins Ausland oder fielen anschließenden Säuberungen zum Opfer. Daß der Konflikt um die Beseitung des Eyadéma-Regimes damit noch nicht zu einem Ende gekommen ist, zeigte sich noch im Oktober 1993 durch einen Bombenanschlag auf das französische Kulturzentrum in Lomé.
Der Norden Afrikas
Grundsätzlich anders sind die Konflikte im Norden des Kontinents, in Ägypten gestaltet: Neben den Aktivitäten von islamischen Fundamentalisten, deren Konfrontation mit dem ägyptischen Staat aber bisher noch nicht zum Krieg eskaliert ist, hat sich zwischen Ägypten und Sudan ein zwischenstaatlicher Streit um die Hala'ib-Region entwickelt. Die Kontroverse bewirkte schon Einschränkungen im diplomatischen Verkehr der beiden Staaten, die sich anbahnenden Wiederannäherungen zwischen den Regierungen haben bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Literatur
Afrika Jahrbuch (1987ff.), hrsg. v. Institut für Afrika-Kunde Hamburg, Opladen: Leske u. Budrich
Gantzel, K.J. / Meyer-Stamer, Jörg (Hg.) 1986: Die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1984. Daten und erste Analysen. München u.a.: Weltforum
Gantzel, K.J. / Schwinghammer, T. / Siegelberg, J. 1992: Kriege der Welt. Ein systematisches Register der kriegerischen Konflikte 1985 bis 1992, Interdependenz Nr. 13, Bonn: Stiftung Entwicklung u. Frieden
Hofmeier, Rolf / Matthies, Volker (Hg.) 1992: Vergessene Kriege in Afrika, Göttingen: Lamuv
Siegelberg, Jens (Red.) 1991: Die Kriege 1985 bis 1990. Analyse ihrer Ursachen, Münster u. Hamburg: Lit
zum AnfangEntwicklungshilfe in Afrika – Die Interessen der Geber und Nehmer
von Dirk Hansohm
Dieser Artikel stellt zunächst ein paar Zahlen zur Bedeutung Afrikas in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) dar. Entgegen der letztlich naiven Hoffnungen auf eine Friedensdividende ist Ausmaß und Art der EZ natürlich auch weiterhin durch die Interessen der Geber bestimmt, die schlaglichtartig beleuchtet werden, bevor die Ergebnisse der EZ für die afrikanischen Nehmer und deren Ursachen diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund werden die neuen Leitlinien des BMZ für die EZ mit Afrika bewertet. Abschließend werden einige Folgerungen gezogen.
Die »Zeitenwende«, die das Ende des Ostblocks und damit des Kalten Krieges Ende der 80er Jahre bedeutete, hat auch Afrika und die Politik gegenüber Afrika in vielfältiger Weise berührt. Wie anderswo zeigt sich auch dort, daß das Ende des »kommunistischen Modells« keineswegs das »Ende der Geschichte« bedeutete, sondern nur das Ende alter Gewißheiten und Sicherheiten – eine neue Unübersichtlichkeit. Dies zeigt sich auch in Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten in den Einschätzungen hinsichtlich der EZ mit afrikanischen Ländern.
Afrika steckt nicht länger in der Zwangsjacke des Ost-West-Konfliktes, der die Politik der Weltmächte gegenüber Afrika – einschließlich der EZ – nach der Unabhängigkeit von Anfang an bestimmt hatte. Dies bedeutet eine Chance, da damit der Weg offen zu sein scheint für einen schablonenfreien Blick auf die Entwicklung Afrikas (vgl. Hansohm/Kappel 1993). Die Hoffnung wird gehegt, daß die EZ sich nun stärker an den Interessen der Nehmer orientieren könne. Neben dieser qualitativen Verbesserung wird vor allem auch eine quantitative Erhöhung erhofft, eine »Friedensdividende«, ermöglicht durch die Reduzierung der Militärausgaben der Geberländer.
Andererseits ist mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes auch ein Hauptinteresse der westlichen Geber am afrikanischen Kontinent entfallen. Daher ist die Befürchtung eines zunehmenden Desinteresses an Afrika nicht unbegründet. Dieses könnte sich zum einen in einer Reduzierung der Mittel für EZ niederschlagen, zum anderen in einer Konzentration auf Maßnahmen der EZ, die kommerzielle Interessen der Geber fördern, also einer qualitativen Verschlechterung (Griffin 1991).
Der Stellenwert Afrikas in der Entwicklungshilfe
Tab. 1 zeigt die Entwicklungshilfezahlungen einiger Industrieländer (Mitglieder im Development Assistance Committee (DAC) der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), der die wichtigsten Industrieländer angehören) in ausgewählten Jahren seit 1980. Es ist erkennbar, daß das von den Industrieländern selbst gesetzte Ziel – EZ-Mittel in Höhe von 0,7 % am Sozialprodukt – nicht erreicht wurde. Wenn überhaupt ein Trend erkennbar ist, dann ein negativer – von 0,37 % im Jahr 1980 auf 0,34 % im Jahr 1991. Die Erwartung einer »Friedensdividende« hat sich bislang nicht bewahrheitet. Deutschland liegt mit seinen relativen Ausgaben leicht über dem DAC-Durchschnitt, jedoch ebenfalls weit unter dem angestrebten Ziel. Nur die skandinavischen Länder und die Niederlande übertreffen die 0,7 %-Marke, Frankreich als ehemalige Kolonialmacht tat dies zeitweise und liegt über dem Schnitt der anderen Länder. Die USA waren zwar bis 1991 der größte EZ-Geber, wiesen aber im Verhältnis zu ihrer ökonomischen Macht die geringste Leistung auf.
Deutschland leistet weiterhin den überwiegenden Teil (etwa 2/3) der EZ in bilateraler Form – dem Ziel der wichtigen und allseits geforderten Geberkoordination ist es damit nicht näher gekomen (siehe Tab. 2).
Afrika hatte seit jeher den größten Anteil an EZ-Mitteln Deutschlands sowie der Industrieländer als Gruppe mit rund 2/5 der Gesamtmittel (siehe Tab. 2 und 3). Im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl ist der Kontinent dabei überproportional berücksichtigt. Aus den zur Zeit zur Verfügung stehenden Zahlen (Stand: 1991) ist keine Veränderung zu erkennen. Aufgrund der veränderten Interessenlage der Geberländer wird jedoch von den meisten Beobachtern mit eher nachlassendem Engagement in der EZ und speziell in Afrika gerechnet.
Funktionen der Entwicklungszusammenarbeit für die Geber
Bei aller entwicklungspolitischen Rhetorik darf man nicht vergessen, daß die EZ der Industrieländer mit Afrika (wie die mit den anderen Kontinenten) ganz eindeutig in erster Linie außen- und sicherheitspolitischen Interessen entsprang, konkret den Ost-West-Gegensätzen des Kalten Krieges. Die Entkolonisierung führte zu einem Wettbewerb der politischen Systeme, die um die Gunst der Länder der sog. Dritten Welt buhlten. Dazu kam ein ideologisches Interesse, die Überlegenheit des eigenen Systems unter Beweis zu stellen. In diesem Wettbewerb war die EZ ein Mittel unter anderen, nicht das einzige und oft auch nicht das wichtigste, aber doch nicht ohne Bedeutung.
Natürlich hat die EZ auch andere Funktionen für die Geber:
- das ökonomische Interesse, eine expandierende Weltwirtschaft zu schaffen;
- das direktere Anliegen, die eigene Wirtschaft durch Exporte zu fördern (hierzu dient die Lieferbindung, aber auch ohne diese können zumindest die stärkeren Industrieländer wie die Bundesrepublik ihr Ziel erreichen) und die Erschließung von Märkten;
- die Erschließung und Sicherung der Rohstoffquellen.
Gerade in bezug auf Afrika ist aber festzuhalten, daß das oben genannte außen- und sicherheitspolitische Interesse dominant war. Diese Interessenlage gab den Empfängerländern einen großen Spielraum. Sie waren in der Lage, Geber gegeneinander auszuspielen (prominentestes Beispiel: Äthipien/Somalia, die wechselseitig von USA und UdSSR unterstützt wurden) und konnten sich einen hohen Freiheitsgrad in ihrer Politik erhalten.
Eine Analyse der EZ muß von der Interessenlage auf Seiten der Geber ausgehen. Die landläufige Analyse der EZ, die sie lediglich an ihren offiziellen entwicklungspolitischen Ansprüchen mißt, weist hier einen blinden Fleck auf. Ein beträchtlicher Teil des Mißerfolgs der EZ in der »Dritten Welt« im allgemeinen und in Afrika im besonderen läßt sich durch diese Interessenlage erklären.
Diese Fremdbestimmung heißt allerdings nicht, daß die EZ von vornherein nicht erfolgreich in der Erreichung ihrer Ziele sein kann, wie ihr von radikaler Seite unterstellt wird, die die EZ lediglich als Mittel begreift, Armut, Unterdrückung und Abhängigkeit aufrechtzuerhalten (z.B. Hayter 1971). Dazu kommt, daß es auch humanitäre Ziele und Interessen, z.B. auf Seiten der Entwicklungshelfer gibt.
Die Unterstellung, daß EZ aufgrund ihrer Fremdbestimmung durch die Interessen der Geber nicht helfen könne, ist genauso naiv wie die Vermutung, daß nach dem Ende des Kalten Krieges rein humanitäre Interessen die Politik des Westens bestimmen würden. Der Sinn von EZ läßt sich zum einen aus humanitären/moralischen Gründen belegen, aber auch und genauso gut aus den eigenen Sicherheitsinteressen der Bevölkerung der Geberländer: Spätestens Ende der 80er Jahre ist nicht nur die zweite Welt verschwunden, sondern auch die Dritte Welt als weit entfernte und abgeschottete Welt. Der Prozeß der Weltintegration geht immer rapider voran, wie es nicht nur durch Berichte im Fernsehen, sondern viel stärker durch die Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge, die die Industrieländer erreichen, immer stärker ins Bewußtsein der Bevölkerung gerät.
Es ist kaum noch zu bestreiten, daß die zunehmende Ungleichheit auf der Welt und Verarmung vieler Länder, in erster Linie in Afrika, nicht nur für die Betroffenen dramatische Folgen hat, sondern auch die Sicherheit auf der ganzen Welt nachhaltig bedroht.
Ergebnisse der Entwicklungszusammenarbeit für die afrikanischen Empfängerländer
Gerade in Afrika ist das Ergebnis der EZ äußerst ernüchternd, was sowohl auf Seiten der Geber wie auch der Nehmer u.a. Positionen einer spektakulären radikalen Ablehnung provoziert hat (vgl. Erler 1985; Kabou 1993). Diejenigen, die trotz allem die EZ positiv beurteilen (Cassen 1990, Riddell 1987), sind in der Diskussion zur Zeit in der Minderheit. In den letzten Jahren gibt es nun auch eine radikale Selbstkritik auf Seiten von EZ-Institutionen, beispielsweise Weltbank und BMZ (s.u.).
Nimmt man die Entwicklungsindikatoren der letzten 3 Jahrzehnte als Maßstab, scheint die EZ ihre wichtigsten Ziele – wirtschaftliche Entwicklung und Überwindung der Armut – nicht erreicht zu haben – eher im Gegenteil. Sieht man näher hin, läßt sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen EZ und Wachstum oder Entwicklung nicht herstellen – weder positiv noch negativ. Ein Vergleich der Weltregionen scheint eher auf einen negativen Zusammenhang hinzuweisen: Afrika und Lateinamerika wiesen in den 80er Jahren negative Wachstumsraten auf, obwohl ihnen zuvor große Kapitalmengen zugeflossen waren. Während der gleichen Periode konnten jedoch eine Reihe asiatischer Länder hohe Wachstumsraten aufrechterhalten, ohne daß ihnen nennenswerte Beträge an Mitteln der EZ zuflossen (Singapur, Thailand, Malaysia; vgl. Griffin 1991).
Es wäre jedoch verfrüht, aus den verfügbaren Daten den generellen Schluß zu ziehen, die EZ habe negative Wirkung auf die Entwicklung, wie dies z.B. Griffin (1991) und Kabou (1993) tun – ein statistischer Zusammenhang muß kein kausaler sein, außerdem ist die Richtung der Kausalität unklar. Der Zusammenhang zwischen EZ und Entwicklung ist zum einen zu vielschichtig und zu wenig erforscht. Zum anderen ist zur Zeit wenig Klarheit und Konsens zu der Frage sichtbar, was unter Entwicklung verstanden wird. Offensichtlich ist nur zweierlei:
- der »westliche Entwicklungsweg« hat sich als Sackgasse herausgestellt: ein Festhalten an der inneren Logik der gegenwärtigen, einzig profitorientierten Wirtschaftsweise würde nur zu bald die ökologischen Grenzen durchbrechen; eine tiefgreifende Umstrukturierung von Wirtschaft und Gesellschaft hier ist unausweichlich.
- damit hat dieser Weg praktisch seine eindeutige Modellfunktion für Afrika verloren. Weder ist ein Ressourcenverbrauch der ganzen Menschheit auf dem Niveau des Westens ökologisch möglich, noch ist mittelfristig für viele Länder Afrikas ein Weg sichtbar, der eine erfolgreiche weltmarktorientierte Entwicklung eröffnen könnte.
Trotz aller berechtigten Kritik an der EZ ist vorauszusehen, daß sie zwar zurückgehen, aber nicht gänzlich versiegen oder zur Wohltätigkeitsgeste verkommen wird. EZ wird jedoch nur nach einer Verarbeitung und Berücksichtigung der Lehren aus 30 Jahren EZ in Afrika auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein (vgl. Hansohm/Kappel 1993).
- EZ tendiert dazu, eine konservative Wirkung zu haben, indem sie die Empfängerregierungen stärkt – gegenüber (potentieller) Opposition, aber auch dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft im allgemeinen. Die Staatsapparate haben sich jedoch nur zu oft als die entscheidenden Entwicklungshindernisse herausgestellt. Diese Einschätzung gilt auch für projektgebundene Mittel, da sie den Regierungen erlauben, eigene Mittel woanders zu verplanen (Fungibilität von Ressourcen). Dadurch hat EZ nur zu oft dazu beigetragen, daß gesellschaftlicher Wandel verhindert wurde.
- Trotz aller Bemühungen um Armutsorientierung ist die EZ vorwiegend den Mittel- und Oberschichten zugute gekommen.
- Die EZ geht im Grunde davon aus, daß Afrika das braucht, was die Geber haben: Kapital, Wissen, Fähigkeiten. Dies ist jedoch problematisch.
- Kapital: Entgegen landläufiger Vorstellungen ist die Sparrate keineswegs notwendigerweise in Ländern der Dritten Welt niedriger. EZ war nun häufig ein Ersatz für einheimische Ersparnisse (durch eine Senkung der Zinsrate, also des Anreizes zu sparen), hat also einen wichtigen Faktor der Entwicklungsfähigkeit eher reduziert. Es hat sich auch gezeigt, daß die EZ keineswegs gleichbedeutend mit Investition ist – ein beträchtlicher Teil wird konsumiert. Andere negative Begleiterscheinungen waren eine Verzerrung des einheimischen Preissystems und des Wechselkurses (Überbewertung der einheimischen Währung). Die Überbewertung wurde selbst zum wichtigsten Grund für den Kapitalmangel, führte damit zu einer weiteren Abhängigkeit von EZ und entmutigte Exporte.
- Wissen, Fähigkeiten: Es ist inzwischen klargeworden, daß das in den Industrieländern erworbene Wissen nur modifiziert in der Dritten Welt anwendbar ist. Kaum jemals haben EZ-Projekte dies ausreichend berücksichtigt.
- EZ unterminiert oft die innere Entwicklungsdynamik. »Entwicklung« wird mit Hilfe aus dem Ausland identifiziert und nicht als eigene Aufgabe erkannt (vgl. Kabou 1993). Die EZ führt in diesem Sinn zur Entmündigung der Afrikaner. Einige Beobachter inner- und außerhalb Afrikas gehen soweit, eine Einstellung der EZ zu fordern, da dies die einzige Möglichkeit sei, Initiative zur Entwicklung zu fördern (Griffin 1991, Kabou 1993).
- Konventionelle Planungen wie auch Bewertungen der EZ klammern die langfristige Dynamik, die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Umfeld, aus, insbesondere die Bedeutung des »grauen Staatshaushaltes« der Entwicklungshilfe (vgl. Bierschenk und Elwert 1993). In vielen Ländern Afrikas machen die Mittel der EZ hohe Werte im Vergleich zu den Staatseinnahmen aus. Dieser Bereich ist praktisch unter Kontrolle der Geber und wird von den Empfängern bestenfalls schwach kontrolliert.
- Die statische Sicht von afrikanischen Gesellschaften (»traditionell«), die der EZ-Planung zugrundeliegt, wird ihrer komplexen Gesellschaftsstruktur nicht gerecht. Die Auswirkungen der EZ gehen weit über die angenommenen hinaus. Insgesamt läßt sich sagen, daß Gesellschaften nur sehr bedingt gezielt zu verändern sind. Die Forschung über die Folgen der EZ auf die Empfängerländer stecken noch in den Kinderschuhen.
Folgerungen für die Praxis der EZ sind daher: Sie sollten weniger Ideologie-bestimmt sein, mehr Realitätssinn haben, pragmatischer und bescheidener sein, und vor allem mehr mit afrikanischen Fachkräften arbeiten.
Die neuen BMZ-Richtlinien der EZ mit Afrika: ein Kommentar
Die enttäuschenden Erfahrungen mit der EZ in Afrika wurden vom BMZ in seinen Richtlinien von 1992 reflektiert (siehe Kasten). Diese stellt in der Tat eine erfrischende Abkehr von überkommenen Glaubensgrundsätzen dar, zeichnet sich durch einen sehr viel höheres Maß an Realismus aus und könnte die Grundlage für einen positiven Neuanfang sein:
- Es beendet die politisch bedingte Rücksichtnahme der »Nichteinmischung in innere Verhältnisse« und benennt die internen Ursachen der Stagnation.
- Es erkennt den unangepaßten Charakter der EZ und die Notwendigkeit zu grundsätzlichen Änderungen an. Die Notwendigkeit entwicklungspolitischer Arbeit auch im Norden wird gesehen – Veränderung ist nicht allein Sache der afrikanischen Länder, Entwicklungspolitik erschöpft sich nicht in »Entwicklungshilfe«.
- Die kritische Situation (Ressourcenverfügbarkeit) in vielen Ländern auch über längere Zeit und die Notwendigkeit, ggf. auch über längere Zeit Staatsausgaben mitzufinanzieren, wird benannt.
- Die Armutsbekämpfung wird wieder erste Priorität. Die anderen Schwerpunkte beziehen sich ebenfalls auf die z.Z. drängendsten Bereiche (Ökologie) bzw. auf die entwicklungspolitisch bedeutsamsten Bereiche (Bildung, Förderung des Privatsektors, regionale Integration).
Zu bedenken ist jedoch:
- Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Grundsätze tatsächlich in der praktischen Politik und Praxis vor Ort widerspiegeln. In der Vergangenheit hat sich nur zu oft eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit gezeigt.
- Die Glaubwürdigkeit der Kriterien, bspw. zu den Menschenrechten, ist dadurch eingeschränkt, daß dieser Grundsatz im Fall von Ländern, die auch wirtschaftlich von Bedeutung für die Bundesrepublik sind, praktisch außer Kraft gesetzt wird.
- Die Existenz von Mehrparteiensystemen ist kaum ein geeignetes Kriterium; zu oft haben diese ihr Versagen gezeigt und unweigerlich zur Militärherrschaft geführt (Nigeria, Sudan). Das Element der Rechenschaftspflicht ist weitaus wichtiger.
- Gerade weil es bei den »internen Rahmenbedingungen« mangelt, kann dies durch externen Druck nur zum kleineren Teil behoben werden. Vorschläge, Afrika wieder unter eine Treuhandschaft zu stellen, sind der Entwicklung nicht förderlich (vgl. Menzel 1991). Es muß vielmehr versucht werden, die internen reformorientierten Kräfte zu unterstützen, anstatt negative Politik zu bestrafen (positive Diskriminierung). Des weiteren muß mehr Gewicht auf die Einbeziehung einheimischer Fachkräfte gelegt werden.
- Der »Politikdialog«, d.h. die Einflußnahme auf die inneren Verhältnisse der Empfängerländer ist legitim und notwendig. Insofern bieten die Grundsätze eine notwendige Weiterentwicklung der ausschließlich ökonomischen Einflußnahme. Allerdings werden damit oft Illusionen bezüglich des Ausmaßes verbunden, in dem gesellschaftliche Prozesse von außen herbeigeführt und gesteuert werden können (vgl. die Auseinandersetzung von Waller und Weiss 1991). Wie sich nicht zuletzt in Somalia gezeigt hat, können massive Interventionen, die scheinbar schnelle Lösungen in Aussicht stellen, in Wirklichkeit langfristige Akzeptanz verspielen, zur Verstärkung tribalistischer und »nationaler« Emotionen führen und damit der Entwicklung einen Bärendienst leisten. Der Sudan ist ein trauriges Beispiel dafür, daß diktatorische Regimes auch ohne die Unterstützung des Westens überleben können – die hohen Kosten der Isolation tragen nicht die gesellschaftlichen Kräfte, die hinter dem Regime stehen, sondern eher die breite Masse einschließlich der Armen. Die Isolation verhilft dem Regime sogar teilweise zu dringend notwendiger Legitimität, da nationale Gefühle über die »äußere Bedrohung« mobilisiert werden können. Hier ist der Sudan leider keineswegs ein Einzelfall.
Letzten Endes ist die für Entwicklung notwendige Voraussetzung ein interner Prozeß der Interessenartikulation. Die externe Einflußnahme, sei es durch »Politikdialog«, sei es durch militärische Intervention, kann zwar aus humanitären Gründen angemessen und notwendig sein, sie hat aber auch Kosten in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklung. Diese Kosten sollten durch behutsames Vorgehen und vorherige Analyse der gesellschaftlichen Lage minimiert werden. Ohne die Identifizierung gesellschaftlicher Kräfte, die einen Reformprozeß tragen können, hat eine Intervention entwicklungspolitisch gesehen wenig Erfolgschancen.
Resumée
Die Bilanz der EZ in Afrika ist bestenfalls bescheiden. Trotzdem wird sie bleiben, wenn auch nicht auf dem Niveau, auf dem Weltbank und andere internationale Organisationen es wünschen – und es ist auch wünschenswert, daß sie bleibt.
Das Interesse an globaler Sicherheit gebietet es den reichen Ländern, sich für die Belange der Armen zu interessieren. Ganz abgesehen von ihrer moralischen Fragwürdigkeit, reicht die militärische Option auch sicherheitspolitisch gesehen nicht aus. Nur eine Politik, die auf globale Armutsbekämpfung und Wohlstandssteigerung zielt, verspricht langfristig Erfolg. Nach dem jetzigen Wissensstand können nur so die Probleme von Armutsflucht, Bevölkerungswachstum und Ökologie gelöst werden. EZ ist daher von essentiellem Interesse für die Sicherheitsinteressen der reichen Länder. Wenn auch momentan die Probleme Ostdeutschlands sowie Osteuropas uns näher liegen, so wird sich doch das Bewußtsein verbreiten, daß eine Abschottung vor den Problemen der anderen Erdteile langfristig nicht machbar ist.
Ein systematischer Zusammenhang zwischen EZ und Entwicklung läßt sich zwar kaum aufzeigen, genauso wenig ist es aber erwiesen, daß EZ unmöglich helfen kann oder daß Entwicklung besser ohne EZ funktionieren würde (vgl. Riddell 1987). Moralisch ist eine EZ daher weiterhin gerechtfertigt und geboten. Genauso klar ist aber, daß nicht jede EZ hilft: nur eine reformierte EZ kann in Afrika Erfolg haben und Legitimität aufweisen.
Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern Afrikas südlich der Sahara in den neunziger Jahren
Zentrale Aussagen der neuen Grundsätze des BMZ
- Ungünstige interne Rahmenbedingungen wie politische Entmündigung, mangelhafte Regierungsführung, fehlgeleitete staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen, Korruption, die Unterdrückung von Minderheiten, ethnische Konflikte und Bürgerkriege haben entscheidend zum Scheitern von Entwicklung beigetragen.
- Sie sind wichtiger als die negativen externen Rahmenbedingungen (sinkende Terms of Trade, steigende Zinsen, steigende Verschuldung), aber auch eine unangepaßte EZ hat zur Verschuldungskrise beigetragen.
- Die ärmsten Ländern in ASS verfügen nur über sehr begrenzte Ressourcen.
- Alle drei Faktoren führten zu einer dramatischen Zuspitzung der Lage (ökologische Zerstörung, ungehemmte Bevölkerungsexplosion, mangelnde Kreditfähigkeit, Abkoppelung von der Weltwirtschaft).
- Das Schwergewicht der EZ muß von der Projekthilfe, die nur isolierte Beiträge leisten kann, auf die Programmhilfe verlagert werden, die Teil von international koordinierten Strukturanpassungsprogrammen sein soll.
- Der Politikdialog soll intensiviert werden. Eine laufende Kontrolle der Mittelverwendung durch die Geber ist notwendig.
- Hilfe soll zwar im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe sein, viele Gebiete in ASS sind aber auch auf Dauer wenig entwicklungsfähig. Dort ist auch eine längerfristige Mitfinanzierung von Sozialausgaben und laufenden Kosten notwendig.
- Die Kriterien für Umfang und Gestaltung der EZ sind:
- Einhaltung der Menschenrechte (andernfalls Beschränkung auf humanitäre Maßnahmen)
- Beteiligung der Bevölkerung am politischen Prozess (Mehrparteiensysteme, Dezentralisierung)
- Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit
- Marktfreundliche Wirtschaftsordnung
- Entwicklungsorientierung staatlichen Handelns (Umschichtung der öffentlichen Ausgaben)
- Schwerpunkte der EZ sind:
- Armutsbekämpfung
- Umwelt- und Ressourcenschutz, Nutzung der natürlichen Ressourcen
- Bildung und Beschäftigung
- Förderung der privatwirtschaftlichen Entwicklung
- Regionale Integration
- Eine wichtige Aufgabe der Entwicklungspolitik ist es auch, sich innerhalb der Bundesregierung, im multinationalen Bereich und in der Öffentlichkeit für die Interessen der Entwicklungsländer einzusetzen (Reform der europäischen Agrarpolitik, Anpassung der Rückzahlungsverpflichtungen an Schuldendienstfähigkeit).
Literatur
Bierschenk, Thomas und Georg Elwert (Hrsg.), 1993, Entwicklungshilfe und ihre Folgen. Ergebnisse empirischer Untersuchungen in Afrika, Frankfurt/New York
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), 1992a, Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern Afrikas südlich der Sahara in den 90er Jahren
BMZ, 1992b, Journalisten-Handbuch Entwicklungspolitik 1993, Bonn
BMZ, 1993, Neunter Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung
Cassen, Robert, 1980, Entwicklungszusammenarbeit (engl. Originalausgabe: Does aid help?)
Griffin, Keith, 1991, Foreign aid after the Cold War, in: Development and Change, Vol. 22, S. 645-685
Hansohm, Dirk und Robert Kappel, 1993, Schwarz-weiße Mythen. Afrika und der entwicklungspolitische Diskurs, Hamburg/Münster
Hayter, Teresa, 1971, Aid as imperialism, Harmondsworth
Kabou, Axelle, 1993, Weder arm noch ohnmächtig. Eine Streitschrift gegen schwarze Eliten und weiße Helfer, Basel: Lenos
Menzel, Ulrich, 1991, Die Hilfe hilft nicht, Treuhandschaft wäre ein Weg, in: Frankfurter Rundschau, 3.Juni, S. 9
Riddell, Roger C., 1987, Foreign aid reconsidered, Baltimore/London
Waller, Peter P, 1991, Internationale Unterstützung des Reformprozesses in Entwicklungsländern im Rahmen von Auflagenpolitik und Politikdialog – das Beispiel patrimonialer Regime in Afrika, in: Hermann Sautter (Hrsg.), Wirtschaftliche Reformen in Entwicklungsländern, Berlin, S. 191-212
Weiss, Dieter, 1991, Korreferat zum Referat von Peter P. Waller, in: Hermann Sautter (Hrsg.), Wirtschaftliche Reformen in Entwicklungsländern, Berlin, S. 213-224
Quelle: BMZ (1992); Zusammenstellung: D. Hansohm
zum AnfangRegionale Konfliktregulierung – Beispiel: Die Intervention der von Nigeria dominierten ECOMOG in Liberia
von Peter Körner
Seit dem Ende des Kalten Krieges ist in Afrika – u.a. auf der Ebene der OAU7 – eine Diskussion entbrannt, ob nicht unter bestimmten Bedingungen das bisher sakrosankte Prinzip der nationalen Souveränität, der territorialen Integrität und der Nichteinmischung durch übergeordnete Ziele außer Kraft gesetzt werden kann. Das Augenmerk richtete sich dabei vor allem auf jene Fälle, in denen die Menschenrechte auf das gröbste verletzt werden, Hungerkatastrophen abzuwenden oder staatliche Strukturen einem fortschreitenden Zerfallsprozeß ausgesetzt sind8. Im folgenden Artikel werden Grundzüge des Krieges in Liberia, der Intervention der ECOMOG und der Friedenssuche auf der Ebene der ECOWAS dargestellt.
Die Diskussion über das Prinzip der Nichteinmischung und über Fragen wie Konfliktregulierung und Kriegsprävention wird nicht nur mit Worten geführt, sie hat bereits durch Taten – spätestens seit der von den USA geführten UNO-Intervention in Somalia (1992/93) – zusätzliche Dynamik erhalten. Ein außerhalb Afrikas bisher weniger beachteter Versuch, einen Krieg durch eine Militärintervention zu beenden, begann bereits im August 1990 in Liberia: Dort griff unter Federführung der Regionalmacht Nigeria eine rein afrikanische – genauer: westafrikanische – Streitmacht ein, um mit militärischen Mitteln eine Friedensregelung zu erzwingen. Offiziell erhielt diese Streitmacht die Bezeichnung ECOWAS (= Economic Community of West African States) Ceasefire Monitoring Group – kurz: ECOMOG9.
Dem seit Weihnachten 1989 dauernden Krieg in Liberia fielen nach Schätzungen der UNO mindestens 150.000 Menschen – fast 5 Prozent der 2,7-Mio.-Bevölkerung – zum Opfer. Der überwiegende Teil der Bevölkerung wurde durch den Krieg entwurzelt. Zahlreiche Flüchtlinge suchten im Ausland Unterschlupf. Im Juni 1993 lebten nach Angaben des UNHCR 450.000 Liberia-Flüchtlinge in Guinea, 250.000 in Côte d'Ivoire und 8.000 in Sierra Leone, weitere 10.000 in Ghana, 1.500 in Nigeria. Da der Krieg im März 1991 auf angrenzende Regionen Sierra Leones übergegriffen hatte, waren auch von dort Menschen geflüchtet, darunter 150.000 ausgerechnet nach Liberia10. Darüber hinaus wurden das Wirtschaftsleben, das soziale Gefüge und die Lebenschancen der Menschen schwer geschädigt. Die Produktion von Nahrungsmitteln und Exportprodukten ging in den vom Krieg betroffenen Landesteilen in Liberia und Sierra Leone drastisch zurück. Häufig trat an die Stelle der Geldwirschaft der Tauschhandel; Schwarzmarkt, informelle Wirtschaft, Kriminalität und Prostitution erlangten einen hohen Stellenwert. Nationale und internationale Hilfsorganisationen mußten aktiv werden, um das Überleben zu ermöglichen, konnten aber die Ausbreitung von Hunger und Krankheiten nicht verhindern.
Als am 1. August 1993 ein Waffenstillstand in Kraft trat, dem die Entwaffnung der Kriegsparteien, die Demobilisierung der Kämpfer und 1994 ein Frieden durch allgemeine demokratische Wahlen folgen sollen11, war Liberia faktisch ein militärisch geteiltes Land:
- Das Gebiet südöstlich einer gedachten Linie parallel zur sierraleonischen Grenze von Monrovia zur guineischen Grenze stand unter Kontrolle der National Patriotic Front of Liberia (NPFL) Charles Taylors, die 1989 zu den Waffen gegriffen hatte, um das Regime von Samuel Doe zu beseitigen. Die NPFL hatte 1990-92 fast das gesamte Territorium mit Ausnahme der Hauptstadt Monrovia erobert, war aber von den anderen Kriegsparteien 1992/93 militärisch in die Defensive gezwungen worden.
- Das Gebiet nordwestlich dieser Linie wurde weitgehend von der Organisation United Liberation Movement for Democracy in Liberia (ULIMO) kontrolliert, in der sich nach dem Tode Does (September 1990) etwa um Mitte 1991 Doe-Anhänger und ehemalige Mitglieder der im Krieg aufgeriebenen Doe-Armee versammelt hatten mit dem Ziel, die NPFL militärisch zu besiegen.
- Die Hauptstadt Monrovia und ein schmaler Küstenstreifen von Monrovia bis zur Hafenstadt Buchanan stand unter Kontrolle der 1990 eingesetzten Interimsregierung von Amos Sawyer, der ihr unterstellten kasernierten Überreste der regulären Armee und vor allem der im August 1990 entsandten westafrikanischen Streitmacht ECOMOG12.
- Die 1990 von der NPFL abgespaltene Independent National Patriotic Front of Liberia (INPFL) unter dem Warlord Prince Yormie Johnson ist seit der NPFL-Offensive auf Monrovia im Herbst 1992 faktisch nicht mehr existent. Die INPFL hatte im September 1990 den Diktator Doe getötet.
Die Anfänge der ECOMOG-Intervention
Die militärische Intervention der ECOMOG im August 1990 erfolgte vor dem Hintergrund, daß sich der Krieg – damals vorwiegend zwischen der NPFL Charles Taylors und der Armee des Regimes von Diktator Samuel Doe – zu einem blutigen Gemetzel entwickelt hatte, in dem Menschen allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit massakriert wurden13. Während das Doe-Regime und später die ULIMO sich hauptsächlich auf die Ethnien der Krahn und Mandingo stützten, entstammten die NPFL-Rebellen vorwiegend den Völkern der Gio und Mano aus der ökonomisch ausgebeuteten und politisch diskriminierten Provinz Nimba County. In den NPFL-Führungszirkeln gab es zudem einige Vertreter der bis zur Doe-Machtübernahme im Jahre 1980 politisch herrschenden Gruppe der Ameriko-Liberianer, Nachkommen freigelassener US-Sklaven, die 1847 den Staat Liberia gegründet hatten. (Taylor selbst ist Sohn einer Gio-Mutter und eines schwarzen US-Amerikaners.)
Aufgrund der bestialischen Ausprägung des Krieges ergingen im Mai/Juni 1990 Hilferufe verschiedener liberianischer Kreise – sowohl des Doe-Regimes als auch von regimekritischen Exil-Liberianern – an die traditionelle Vormacht USA, dem Blutvergießen durch eine Militärintervention Einhalt zu gebieten. Auf Seiten Does war damit nicht zuletzt die Hoffnung verbunden, seine Herrschaft retten zu können. Die USA jedoch lehnten ein militärisches Engagement ab und entsandten lediglich kleinere Marineeinheiten, deren Aufgabe es war, Einrichtungen der USA in Liberia (Botschaft, militärische Kommunikationseinrichtungen, CIA-Relaisstation etc.) zu schützen und bedrohte ausländische (vor allem US-) Bürger aus Liberia zu evakuieren14. Eines der Hauptargumente für die Zurückhaltung lautete, man befürchte eine unübersichtliche Situation wie im Libanon, in der auch eine militärische Großmacht mit Waffengewalt nicht allzuviel auszurichten vermochte. Im August 1990 schließlich sahen sich die USA in der Golfregion nach der irakischen Besetzung Kuwaits einer militärischen Herausforderung gegenüber, die weniger bedeutsamen Krisenfällen wie Liberia nur wenig Aufmerksamkeit ließ.
Aufgrund der Zurückhaltung der USA befaßte sich auf Initiative Nigerias ab Mai 1990 die ECOWAS mit dem Liberia-Konflikt. Zuständig wurde das neu gegründete ECOWAS Standing Mediation Committee (ESMC), das künftig in ähnlichen Konfliktfällen wie Liberia – eventuell sogar präventiv – vermitteln soll15. Dem ESMC gehören, ernannt für jeweils drei Jahre, fünf der insgesamt 16 ECOWAS-Staaten an – zunächst Nigeria, Ghana, Gambia, Togo und Mali. Die ESMC-Gründung stützte sich völkerrechtlich auf die 1978 und 1981 in der ECOWAS geschlossenen Abkommen zum Nichtangriff und gegenseitigen Beistand im Falle einer externen Aggression16. Die Befassung mit dem Liberiakonflikt ergab sich aus mehreren Faktoren: Zum einen hatte Diktator Doe als völkerrechtlicher Vertreter seines Landes ein Eingreifen der ECOWAS gefordert. Zum zweiten waren Bürger verschiedener ECOWAS-Staaten in Liberia akut an Leib und Leben bedroht – nach klassischem Völkerrecht war eine Aktion zu ihrer Rettung zulässig. Zum dritten ging vom Liberia-Krieg – u.a. durch grenzüberschreitende Flüchtlingsströme und die Beteiligung von Söldnern aus verschiedenen westafrikanischen Staaten auf Seiten der NPFL – eine latente Gefahr für die Stabilität der gesamten Region aus, die eine gemeinsame Strategie der Konflikteindämmung legitim erscheinen ließ. Schließlich wurde die Befassung der ECOWAS mit dem Liberiakonflikt auch humanitär gerechtfertigt: Namentlich Nigerias Staatschef Babangida trat mit dem Argument an die Öffentlichkeit, Afrika habe dem Blutvergießen unter afrikanischen Brüdern nicht länger tatenlos zuschauen dürfen17.
Das ESMC arbeitete einen Friedensplan aus, der u.a. einen Waffenstillstand, die Entwaffnung der Kriegsparteien und ein geregeltes Kriegsende durch allgemeine Wahlen und Installierung einer legitimen Regierung herbeiführen sollte. Eine gemeinsam von verschiedenen ECOWAS-Mitgliedern gebildete »Peace-keeping«-Truppe sollte den Übergangsprozeß absichern. Der Beschluß zur Umsetzung des Planes, der auch die Gründung der ECOMOG beinhaltete, wurde am 7. August 1990 von einer ESMC-Zusammenkunft gefaßt, an der zusätzlich Liberias von Flüchtlingsströmen stark betroffene Nachbarstaaten Guinea und Sierra Leone teilnahmen. Während die ESMC-Mitglieder Togo und Mali im Gleichklang mit anderen frankophonen Staaten die Zustimmung zu dem Beschluß mit dem Argument verweigerten, eine so weitreichende Vereinbarung dürfe nur von der Gesamtheit der ECOWAS-Mitglieder getroffen werden18, entsandten Nigeria, Ghana, Gambia, Sierra Leone und Guinea – alle anglophonen und nur einer von neun frankophonen ECOWAS-Staaten – Ende August 1990 insgesamt 2.500 ECOMOG-Soldaten nach Liberia19.
Umstrittene Legitimation der Intervention
Während die USA, die UNO und die OAU die Intervention als einen regionalen Beitrag zur Konfliktregulierung würdigten und billigten, kritisierten frankophone Staaten diese Intervention als Verstoß gegen das Völkerrechtsprinzip der Nichteinmischung20. Die ECOMOG trug zwar die Bezeichnung »ECOWAS« in ihrem Namen, tatsächlich jedoch wurde ihr von frankophonen Mitgliedsstaaten die Legitimität abgesprochen. Die Kritik verbarg, daß mit Côte d'Ivoire und Burkina Faso zwei aus ihren Reihen – gedeckt durch das mit Nigeria auf westafrikanischer Ebene machtpolitisch rivalisierende Frankreich21 – die NPFL unterstützten. Hinter der Ablehnung der ECOMOG verbargen sich einerseits ökonomische und politische Interessen Frankreichs und seiner Ex-Kolonien an einer Zusammenarbeit mit der NPFL, andererseits die Furcht vor der regionalen Dominanz Nigerias22. Charles Taylor und die mit Frankreich kooperierenden Regierungen der Côte d'Ivoire und Burkina Fasos favorisierten statt eines ECOWAS-Engagements die Einschaltung der UNO – was aber die USA und die UNO selbst zunächst ablehnten.
Waffenstillstand in Liberia und Ausdehnung der Kampfhandlungen auf Sierra Leone
Da die Voraussetzung des Liberia-Einsatzes der ECOMOG, ein Waffenstillstand, nicht gleich zustande kam, die ECOMOG-Teilnehmer ihre Truppen dennoch in das Kriegsland entsandten, wurde das »Peace-keeping«-Mandat in einen »Peace-enforcement«-Auftrag umgewandelt. Zugleich entschwand der Begriff »Ceasefire« aus der Langfassung der Bezeichnung ECOMOG. Außerdem übernahm Nigeria das ECOMOG-Oberkommando, das zunächst Ghana zugesprochen worden war. Durch den Kampfeinsatz vertrieb die Interventionsstreitmacht die NPFL aus Monrovia und verhinderte so die Machtübernahme durch Charles Taylor; zudem nahm sie die Überreste der militärisch geschlagenen liberianischen Armee und die Verbände der INPFL in der Hauptstadt unter Kontrolle, erreichte die Trennung der Kriegsparteien, erzwang – per Ende November 1990 – einen Waffenstillstand und setzte eine Interimsregierung unter dem Politikprofessor Amos Sawyer ein, die durch eine Nationalkonferenz aller relevanten politischen Kräfte Liberias mit Ausnahme der NPFL getragen wurde.
Die ECOMOG konnte indes nicht verhindern, daß die NPFL nach dem Waffenstillstand weiterhin militärische Nadelstiche setzte und im März 1991 den Krieg in Grenzregionen des Nachbarstaates und ECOMOG-Teilnehmers Sierra Leone hineintrug, wo sie mit einer einheimischen Rebellenorganisation namens Revolutionary United Front (RUF) kooperierte. Dies führte dort im April 1992 zum Zusammenbruch der Herrschaft von Präsident Momoh und zur Machtübernahme durch eine Militärjunta unter Hauptmann Valentine Strasser. In Reaktion auf den NPFL/RUF-Überfall bildete sich aus Überresten der Doe-Armee und Doe-Sympathisanten, die nach Sierra Leone und Guinea geflüchtet waren, die ULIMO, die in einer Allianz mit der sierraleonischen Armee sowie auf bilateraler Basis entsandten Truppen aus Guinea und Nigeria gegen die NPFL-RUF-Koalition vorging.
Das Abkommen von Yamoussoukro
Da zwischenzeitlich in Liberia ein militärisches Patt entstanden war, war der Versuch einer politischen Konfliktlösung unumgänglich. Mit massivem finanziellen und politischen Druck zwangen die USA die NPFL-Unterstützer Côte d'Ivoire und Burkina Faso, einer solchen Lösung eine Chance zu geben. Als Konzession durfte Côte d'Ivoire die Federführung bei den politischen Verhandlungen zur Beilegung der Liberiakrise übernehmen. Die ivorische Hauptstadt Yamoussoukro wurde Schauplatz von insgesamt vier Treffen, die im Oktober 1991 zum sog. Yamoussoukro-Abkommen führten. Da der Kurswechsel der Côte d'Ivoire und Burkina Fasos die NPFL politisch isoliert hatte, blieb dieser kaum eine andere Wahl, als sich an der Übereinkunft zu beteiligen.
In dem Yamoussoukro-Abkommen, das neben NPFL-Chef Taylor die liberianische Interimsregierung, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso und Senegal unterzeichneten, wurde eine politische Lösung vereinbart, die einen Waffenstillstand, die Entwaffnung und Demobilisierung der Kriegsparteien sowie allgemeine Wahlen vorsah. Die ECOMOG sollte den Friedensprozeß militärisch absichern, d.h. die Waffenruhe überwachen und die Entwaffnung vornehmen. Um das bisherige, für die NPFL inakzeptable Übergewicht Nigerias in der ECOMOG zu relativieren, entsandte Senegal ein militärisches Kontingent von 1.500 Mann nach Liberia, das dem nigerianischen Oberkommando unterstellt wurde. Damit hatte die ECOMOG im Herbst 1991 eine Stärke von fast 10.000 Mann erreicht, darunter 5.000 aus Nigeria und ebenfalls 1.500 aus Ghana23. Darüber hinaus beteiligte sich das ESMC-Mitglied Mali mit einigen Offizieren symbolisch an der ECOMOG.
Die Yamoussoukro-Vereinbarungen, die im April 1992 durch eine weitere Übereinkunft in Genf bekräftigt und konkretisiert wurden, hatten entscheidende Schwächen, die zum Scheitern führten:
- Die Kriegspartei ULIMO war an dem Abkommen nicht beteiligt worden und fühlte sich an die Verpflichtung zur Entwaffnung nicht gebunden. Von Sierra Leone aus setzte sie den Krieg gegen die NPFL bald auch auf liberianischem Territorium fort. Die NPFL ihrerseits hatte dadurch einen Vorwand, die Vereinbarungen zurückzuweisen und den Kampf um die Macht in Monrovia wiederaufzunehmen.
- Die ECOMOG sollte in Liberia als neutrale Konfliktschlichtungstruppe auftreten, während ihre Teilnehmer Nigeria, Guinea und Sierra Leone in Sierra Leone weiterhin Kriegsgegner der NPFL blieben. Dieser Widerspruch blieb unauflösbar.
- Das Yamoussoukro-Abkommen sah vor, die Kriegsschauplätze in Liberia und Sierra Leone durch eine von der ECOMOG zu errichtende Pufferzone an der Grenze zu trennen. Eine solche Zielsetzung unterschätzte die grenzüberschreitende Dynamik des Krieges und den wechselseitigen Zusammenhang der Kriegsschauplätze.
Die erneute Eskalation des Krieges
Als die NPFL im Herbst 1992, von Sierra Leone her durch die ULIMO militärisch zunehmend bedrängt, eine erneute Offensive auf Monrovia unternahm, schlug die auf 16.000 Mann aufgestockte24 ECOMOG sie in die Defensive. Das offene Auftreten der ECOMOG als Kriegspartei ließ indes die Kluft zwischen anglophonen und frankophonen Staaten wiederaufreißen und eine politische Lösung in weite Ferne rücken. Der 1992 zum ECOWAS-Vorsitzenden gewählte Präsident des frankophonen Staates Benin, Soglo, kritisierte die Parteilichkeit der ECOMOG, Burkina Faso geißelte die ECOMOG als Aggressionstruppe und verlangte ihren Abzug aus Liberia, Senegal zog im Januar 1993 – mit dem vagen Hinweis auf militärischen Eigenbedarf in seiner Konfliktregion Casamance – sein Kontingent ab. Côte d'Ivoire bekannte sich formal zu den Beschlüssen von Yamoussoukro, nahm aber offenbar gemeinsam mit Burkina Faso heimlich die Unterstützung der NPFL wieder auf.25
Die Einschaltung der UNO und das Abkommen von Cotonou
Im Frühjahr 1993 stellte sich erneut heraus, daß keine der Kriegsparteien den Krieg militärisch zu entscheiden vermochte. Abermals mußten Anstrengungen unternommen werden, eine politische Lösung der Krise zu erreichen. Da die ECOWAS aufgrund des Zerwürfnisses zwischen den anglophonen und der Mehrheit der frankophonen Staaten nicht in der Lage war, aus eigener Kraft eine solche Lösung herbeizuführen, beantragte sie die Einschaltung der UNO und der OAU. Die UNO unterstrich in den Sicherheitsratsresolutionen 813 vom November 1992 und 856 vom März 1993 zunächst die Option auf eine regionale Konfliktlösung und bekundete Unterstützung für die ECOMOG, erkannte jedoch im Zuge langwieriger Sondierungen von Sonderbotschaftern der UNO und der OAU, daß nicht nur die militärische Situation im Patt gemündet war, sondern auch ein Entgegenkommen gegenüber den Positionen der NPFL und frankophoner Staaten erforderlich war, um einen Ausweg aus der Krise zu weisen.
Resultat war das – auf einer einwöchigen Konferenz in Genf vorbereitete – Abkommen von Cotonou/Benin im Juli 1993. Wie in Yamoussoukro wurden auch diesmal ein Waffenstillstand (per 1. August 1993), die Entwaffnung und Demobilisierung der Kriegsparteien und ein Friedensschluß durch allgemeine Wahlen vereinbart. Die Übergangsregierung sollte durch einen Übergangsstaatsrat abgelöst werden, in den die NPFL, die ULIMO und die bisherige Interimsregierung Vertreter entsenden sollten. Die ULIMO war also, wie von der NPFL und den frankophonen Staaten gefordert, Vertragspartei. Der Waffenstillstand, die Entwaffnung und der Friedensprozeß bis zu den Wahlen sollten durch eine modifizierte ECOMOG überwacht werden. Der Anteil Nigerias an der Streitmacht sollte – auch dies entsprach den Forderungen der NPFL und der frankophonen Staaten – erheblich reduziert, militärische Kontingente von Staaten außerhalb der westafrikanischen Region zusätzlich eingegliedert werden. Dafür kamen die anglophonen Staaten Uganda, Tanzania, Zambia, und Zimbabwe sowie Ägypten und vorübergehend Marokko ins Gespräch. Schließlich wurde – ebenfalls eine Konzession an die NPFL und die frankophonen Staaten – vereinbart, daß die UNO den gesamten Friedensprozeß einschließlich der für Februar 1994 in Aussicht gestellten Wahlen zu überwachen und die Neutralität der »Peace-keeping«-Streitmacht, die trotz Erweiterung die Bezeichnung ECOMOG behalten sollte, zu garantieren hatte.
Versuche zur Umsetzung des Abkommens von Cotonou
Die Umsetzung des Cotonou-Abkommens gestaltete sich sehr schwierig, weil sich die Vertragsparteien mißtrauisch belauerten, die Modifizierung der ECOMOG zunächst nicht in Gang kam und die Entsendung eines UNO-Beobachterteams auf sich warten ließ. Zwar hielt der am 1. August eingetretene Waffenstillstand in weiten Teilen des Landes, jedoch gab es einige Verstöße von Seiten der ULIMO und der NPFL. Zudem entwickelten sich Kämpfe zwischen rivalisierenden NPFL-Gruppierungen einerseits, sowie der ULIMO-Abspaltung Liberia Peace Council (LPC) gegen die NPFL nahe der ivorischen Grenze andererseits. Dennoch konstituierten sich – mit Verzögerung gegenüber dem Zeitplan – der Interimsstaatsrat und ein Interimsparlament. Außerdem bildete die UNO – mit Geldern vor allem der USA – einen Liberia-Treuhandfonds, der ECOMOG-Zusatzkontingente aus Ägypten, Uganda, Tanzania und Zimbabwe finanzieren soll. Derzeit erscheint allerdings noch immer ungewiß, ob die bisher ergriffenen Schritte dynamisch und konsensfähig genug sind, um den Friedensprozeß zu tragen. Es wäre eine Überraschung, wenn sich der Wahltermin im Februar 1994 realisieren ließe. Darüber hinaus blieb durch das Cotonou-Abkommen unklar, wie mit dem Kriegsschauplatz Sierra Leone zu verfahren war.
Vorläufige Bilanz
Die von Nigeria geführte ECOMOG-Intervention in Liberia ist in ihrem rein regionalen Zuschnitt gescheitert, hatte dennoch aber einige beachtliche Teilerfolge: Daß überhaupt eine solche Militäraktion auf regionaler Basis realisiert werden konnte, hätte noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Die beträchtlichen ökonomischen, militärischen und logistischen Kapazitäten der Regionalmacht Nigeria haben die Intervention ermöglicht. Ohne nigerianisches Engagement wäre eine solche Aktion undenkbar. Am Horn von Afrika zum Beispiel fehlt eine solche Regionalmacht. Deshalb kam dort zunächst nur eine von außerafrikanischen Mächten getragene Intervention in Frage. Die ECOMOG-Intervention hat in Liberia 1990 das bestialische Blutvergießen beendet und die – sonst kaum zu vermeidende – Machtübernahme durch Charles Taylor verhindert.
Negativ schlug zu Buche, daß Nigeria ebenso wie Frankreich und die USA vor der Aufgabe des »Peace-keeping« und politischen Bemühungen zur Beendigung der Krise nationale Interessen verfolgte, die auf einen militärischen Sieg über die NPFL zielten. Führte einerseits die fehlende Friedensbereitschaft der liberianischen Kriegsparteien zur Verlängerung des Krieges, so waren es andererseits neben den Interessen der USA und Frankreichs auch die Interessen Nigerias, die eine überparteiliche Konfliktschlichtungsaktion der ECOMOG verhinderten. Zudem haben die USA und die UNO – sowie auch die OAU – zu lange dem Politikansatz vertraut, trotz der Kenntnis über die Kluft zwischen Nigeria und der Mehrheit der frankophonen Staaten mittels der ECOWAS eine regionale Lösung für ein regionales Problem zu finden. Erst Mitte 1993 hat die UNO einen Kurswechsel vollzogen, als das Scheitern des regionalen Krisenlösungsansatzes seit langem offensichtlich war. Trotzdem ist noch offen, ob die UNO nunmehr die Überparteilichkeit der (modifizierten) »Peace-keeping«-Streitmacht wird garantieren können. Partikularinteressen verschiedener in den Liberiakonflikt involvierter Staaten (Nigeria, frankophone Staaten, USA, Frankreich) könnten dies verhindern.
zum AnfangDas externe wirtschaftliche Umfeld: Afrika zwischen Schuldenfalle, Rohstoffpreisverfall, nachlassender Entwicklungshilfe, zerstörerischer Nahrungsmittelhilfe und ungebrochenem Protektionismus des Nordens
von Cord Jakobeit
Nach dem Ausklingen der ersten Welle der Demokratisierungsbemühungen ist in den meisten Staaten Afrikas die anfängliche Euphorie inzwischen allgemeiner Ernüchterung gewichen. Dennoch sehnt sich sicher nur eine Minderheit nach repressiver Diktatur, Folter, willkürlichen Verhaftungen und der Friedhofsruhe der Vergangenheit zurück. Allerdings ist in den meisten Fällen eine der wichtigen Stufen im Demokratisierungsprozeß, die mit freien Wahlen ermöglichte Ablösung der alten Herrscher durch die demokratische Opposition, eher die Ausnahme als die Regel geblieben. Wo sie dennoch erreicht wurde, mußte die Bevölkerung – ebenso wie bei den Fällen nunmehr formal demokratisch legitimierter alter Herrschaft – rasch einsehen, daß zwischen Versprechungen des Wahlkampfes und deren Realisierung in der Zeit danach vielfach eine große Lücke besteht. Selbst die Respektierung der individuellen Menschenrechte ist längst noch nicht allgemein gewährleistet. Im wirtschaftlichen Bereich mußten überspannte Erwartungen angesichts fehlender Ressourcen fast zwangsläufig enttäuscht werden. Damit stellt sich die Frage, welche Rolle das wirtschaftliche Umfeld für die Zukunft des Demokratisierungsprozesses in Afrika spielt. (…)
Analytisch könnte man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach internen Faktoren, die eine demokratische Regierung entscheidend beeinflussen kann, und externen Faktoren, die sich einer direkten Beeinflussung weitgehend entziehen, unterscheiden. Natürlich sind Maßnahmen gegen die Korruption, die schlechte Qualität der öffentlichen Dienstleistungen und die vielfach falschen Signale in der heimischen Preis- und Wirtschaftsstruktur notwendig und möglich. Selbstverständlich haben fehlende Diversifizierung, Verschuldung durch Kapitalflucht, Prestigeinvestitionen sowie falscher Umgang mit Entwicklungshilfe handfeste interne Ursachen. Dennoch verlangt ein effektives Vorgehen gegen diese Mißstände im wirtschaftlichen und politischen Bereich kurzfristig finanzielle Mittel, die im notwendigen Umfang zunächst nur von außen kommen können. (…) Dieser Beitrag befaßt sich daher mit den Entwicklungen, die das externe Wirtschaftsumfeld der Demokratisierungsbemühungen bestimmen. Eine Untersuchung der Verschuldungsproblematik, der Rohstoffpreisentwicklung, der Höhe der finanziellen Gebertransfers, der Auswirkungen von Nahrungsmittelhilfe und der Chancen auf eine Minderung des Handelsprotektionismus der Industrieländer erlaubt zumindest kurz- bis mittelfristig eine Einschätzung darüber, inwiefern von außen eher mit Rückenwind zu rechnen wäre, bzw. ob der schwierige und sicher langwierige Demokratisierungsprozeß in Afrika auch weiterhin mit starkem Gegenwind rechnen muß.
Verschuldungsmisere ohne Ende: Kosmetik statt Korrektur
Am Anfang der Überlegungen zur Verschuldung in Afrika südlich der Sahara müssen deren Struktur und relative Bedeutung erläutert werden. Afrikas Verschuldung hat sich seit 1980 auf inzwischen US-$ 183,4 Mrd. mehr als verdreifacht (vgl. die Zahlenangaben der Weltbank zur Verschuldung in Afrika, hier nach Böhmer 1993: 7 f.). Zwar liegt Afrikas Anteil an der Gesamtverschuldung der Dritten Welt nur bei rund 13%, wobei Nigeria allein rund 20% der Verschuldung des Kontinents abdeckt, aber alle Verschuldungsindikatoren zeigen, daß die Dramatik des Problems in Afrika mit Abstand am größten ist. Im Vergleich zur gegenwärtigen Produktions- und Rückzahlungsfähigkeit hat Afrikas Verschuldung längst ein Ausmaß angenommen, das eine vollständige Rückzahlung definitiv ausschließt. Während in Lateinamerika und der Karibik bzw. in Südasien die Gesamtverschuldung nur rund 35% des Bruttosozialprodukts ausmacht, liegt dieser Wert in Afrika bei fast 110%. Afrika muß jährlich rund US-$ 10 Mrd. für den Schuldendienst aufbringen. Zwischen 1983 und 1992 floßen US-$ 96,8 Mrd. an Zins- und Tilgungszahlungen ab, ohne daß alle Forderungen der Gläubiger bedient werden konnten. Die Gesamtverschuldung stieg daher weiter an. Im afrikanischen Durchschnitt müssen fast 20% der Exporteinnahmen für die Bedienung der Schulden aufgewendet werden. Das sind Mittel, die dringend für die Reparatur der Infrastruktur, für Krankenhäuser, Schulen usw. gebraucht würden. Während jedoch in Südamerika nur rund ein Drittel der Verschuldung auf öffentliche bzw. öffentlich garantierte Kredite entfällt, besteht Afrikas Verschuldung zu über 80% aus Krediten, die von bilateralen bzw. multilateralen Gebern gewährt wurden. Da sich private Geber bisher beharrlich weigern, Entschuldung und Schuldenstreichung ernsthaft und umfassend zu diskutieren, (…) hat Afrika angesichts der sehr viel größeren Bedeutung der bi- und multilateralen Geber wenigstens in diesem Punkt einen Vorteil, da seine Verschuldungssituation potentiell durch direktes staatliches Handeln der Geber verbessert werden kann.
Für Afrika stellt sich schon seit langem nicht mehr nur die Frage, ob Schulden gestrichen werden sollen. Es kommt vielmehr darauf an, daß Schulden nicht unkoordiniert, zu gering und zu spät gestrichen werden, sondern so, daß dadurch ökonomische und politische Reformen gefördert und die Lebensbedingungen für die Menschen verbessert werden. Wird das bisherige Handeln der bi- und multilateralen Geber einem solchen Anspruch gerecht?
Zwar haben zwischen 1986 und 1990 über 30 afrikanische Staaten Umschuldungsvereinbarungen unterzeichnet, darunter etliche mehrfach, dennoch ist in diesem Zeitraum die Gesamtverschuldung um 48% gestiegen. Umschuldungen ohne Schuldenstreichung erhöhen nur die Gesamtverschuldung, da die geänderten Zahlungsfristen und -modalitäten durch höhere Verzugszinsen und Gebühren erkauft werden müssen. Im Rahmen des sogenannten Toronto-Paketes wurde daher ab 1988 erstmals in größerem Umfang damit begonnen, bei Umschuldungen Teile der Schuld zu erlassen. Die Toronto-Konditionen enthalten ein Schenkungselement von rund 20% und wurden bis Mitte 1991 bei 18 afrikanischen Staaten mit niedrigem Einkommen angewendet. Weitergehende Vorschläge, wie die Trinidad- und die Bangkok-Konditionen, haben das Schuldenstreichungselement erweitert. Bis Ende 1992 haben mit Ausnahme der USA und Japans alle westlichen Industriestaaten Schuldenstreichungen bei den ärmeren afrikanischen Staaten vorgenommen, die etliche ärmere Staaten entlastet haben. Außerdem gehörten 1992 nach der Klassifizierung der Weltbank schon zehn Staaten in die Gruppe der Staaten ohne Verschuldungsprobleme. Da auf diese Gruppe jedoch nur 4,4% der gesamten Auslandsverschuldung des Kontinents entfällt, muß dennoch festgestellt werden, daß die bisherigen Schuldenstreichungen im Vergleich zur Gesamtverschuldung marginal geblieben sind. (…) Um dem Demokratisierungsprozeß nachhaltig von außen unter die Arme zu greifen, reichen die bisherigen Zugeständnisse und die bisherigen Modelle einer erweiterten Schuldenstreichung jedoch für rund die Hälfte der Staaten des Kontinents nicht aus.
Forderungen an die multilateralen Geber: Kontrollierte Streichung statt endlose Streckung
Im Vergleich zu den bilateralen Gebern ist die Lage bei den multilateralen Gebern noch problematischer. Obwohl sich deren Anteil an der Gesamtverschuldung seit 1980 im Durchschnitt auf inzwischen 24,2% fast verdoppelt hat, und obwohl der Anteil von Weltbank und Währungsfonds am gesamten jährlichen Schuldendienst Afrikas inzwischen bei fast 50% liegt, beharren die beiden wichtigsten multilateralen Geber weiter darauf, daß ihre Kredite nicht abgeschrieben bzw. reduziert werden können. Mit dem Ausbruch der Schuldenkrise zogen sich die privaten Geber fast vollständig vom Kontinent zurück, während gleichzeitig die bilateralen Geber ihre Entwicklungshilfeleistungen von Strukturanpassungsprogrammen der jeweiligen Staaten mit Währungsfonds und Weltbank abhängig machten. Da die Kredite des Währungsfonds auf die Beseitigung kurzfristiger Zahlungsbilanzprobleme abzielen, die afrikanische Verschuldungskrise – und nicht nur die – aber zum dauerhaften Problem geworden ist, fließen seit Mitte der 80er Jahre mehr Mittel an den IWF zurück als umgekehrt an neuen Krediten von ihm vergeben werden (vgl. Tab. 2). Lediglich den »weichen« Konditionen der Weltbanktochter IDA ist es zu verdanken, daß der Mittelfluß durch die multilateralen Geber insgesamt positiv geblieben ist.
(…)
Statt den ökonomischen und politischen Reformprozeß durch Schuldenstreichung zu unterstützen, ziehen sich die multilateralen Geber auf ihre Satzungen zurück, die Schuldenstreichungen ausschließen. Es werden lediglich neue konzessionäre Mittel bereitgestellt und die alten Zahlungsunfähigkeitskriterien neu definiert. Daneben wird jedoch unverändert argumentiert, daß weitergehende Schritte, insbesondere Schuldenstreichung bzw. Schuldenverzicht, die eigene Bonität an den internationalen Finanzmärkten einschränken, zu gefährlichen Präzedenzfällen in anderen Kontinenten führen und die reformorientierten und zahlungsbereiten Staaten benachteiligen müßten.
In der Tat wäre eine Schuldenstreichung, die es afrikanischen Staatsklassen problemlos erlaubt, zu den Fehlern der Vergangenheit zurückzukehren, eindeutig die denkbar schlechteste Alternative. Angesichts der besonderen Schwäche afrikanischer Volkswirtschaften sollte jedoch eine an politische und ökonomische Bedingungen geknüpfte Schuldenstreichung in Etappen weder zu Prestigeverlusten der beiden wichtigen multilateralen Geber an den Finanzmärkten noch zu einem Dammbruch in der Zahlungsmoral der Schuldner führen. (…) Die bestehende ökonomische Konditionalität in der Strukturanpassungspolitik – Steigerung der Deviseneinnahmen, Abwertung der Währung, Abbau des Staatsdefizits durch drastische Ausgabenkürzungen, usw. – klammert die mittel- und langfristige Brisanz der Verschuldungssituation aus. Dies kann leicht zum paradoxen Ergebnis führen, daß selbst ein Staat, der die bittere Medizin der multilateralen Geber willig schluckt, schon mittelfristig von seiner Schuldenlawine überrollt wird. Es ist lange überfällig, daß die multilateralen Geber und die sie kontrollierenden Staaten des Nordens ihre Schuldenpolitik gegenüber Afrika grundlegend modifizieren, wenn der Demokratisierungsprozeß nicht weiter in der Verschuldungsfalle stranguliert werden soll.
Rohstoffpreisentwicklung – Freier Fall ohne Netz
Ohne steigende Deviseneinnahmen läßt sich weder der notwendige Schuldendienst aufbringen noch können die dringend benötigten Importe und Investitionen finanziert werden, um die Wirtschaft neu zu beleben. Der Kontinent hängt jedoch seit den Tagen der kolonialen Inwertsetzung wesentlich vom Export seiner agrarischen und mineralischen Rohstoffe in Richtung Norden ab, da es weder gelungen ist, die industrielle Entwicklung voranzutreiben noch den regionalen Handel nachhaltig zu beleben. Afrika ist weiterhin in besonderem Maße von der Preisentwicklung auf den Internationalen Rohstoffmärkten abhängig. Tab. 1 zeigt, daß sich seit Mitte der 80er Jahre aus der Perspektive aller Entwicklungsländer keine Verbesserung der Lage ergeben hat, (…). Selbst bei den landwirtschaftlichen Rohstoffen und den Metallen und Mineralien, deren Preisniveau relativ besser zu sein scheint, stagnieren die Notierungen um das höhere Niveau, das schon 1987/88 erreicht wurde.
Unverändert dramatisch ist dagegen weiter die Situation für die tropischen Genußmittel, die als klassische Kolonialwaren in vielen Ländern West-, Zentral- und Ostafrikas eine besondere Bedeutung haben, weil sie vorwiegend als kleinbäuerliche Familienkulturen angebaut werden. Während die Teepreise bei dieser Untergruppe noch ein gewisses Gegengewicht liefern konnten, fehlen für die Preisstürze bei Kakao und Kaffee sogar die historischen Parallelen. So war der 1992 für Kakao ausgewiesene durchschnittliche Weltmarktpreis real der niedrigste seit 1854, d.h. dem Jahr, seit verläßliche Weltmarktnotierungen für Kakao statistisch erfaßt werden.
(…)
Die Gründe für das massive Überangebot von Kakao und Kaffee auf den Weltmärkten liegen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Die Anbieter haben auf die vergleichsweise hohen Weltmarktpreise Ende der 70er Jahre z.T. mit massiven Neuanpflanzungen reagiert. Bei einigen landwirtschaftlichen Produkten sind außerdem in Südostasien neue Anbieter in die Märkte eingestiegen, wodurch sich der Preisdruck verstärkt hat. Im Rahmen der Strukturanpassungspolitik seit Beginn der 80er Jahre haben die multilateralen Geber unterschiedslos alle bisherigen Anbieter zunächst zur Wiederherstellung und Verbesserung der traditionellen Exportprodukte gedrängt und damit zum Überangebot beigetragen. So wurde pro-zyklisch gehandelt, statt anti-zyklisch das Angebot zu verknappen. Hinzu kommt, daß vielen der kleinbäuerlichen Anbieter häufig kurz- oder mittelfristig die Alternative für den Gelderwerb schlicht fehlt,
(…)
Als Folge der ökonomischen Einbrüche nach dem revolutionären Wandel in Mittel- und Osteuropa zeichnen sich zudem zwei weitere, für Afrika nachteilige Entwicklungen ab. Erstens fallen diese Märkte bis auf weiteres für die Aufnahme afrikanischer Rohstoffe aus, und zweitens verfügen sie mittelfristig mit ihren Mineralien und verarbeiteten Erzeugnissen über das Potential, sich zu ernsthaften Mitbewerbern auf den Märkten der Industrieländer zu entwickeln.
Langfristig dürfte für Afrika kaum etwas an der Notwendigkeit vorbeiführen, über Diversifizierung, Weiterverarbeitung und zunächst agrar-orientierte Industrialisierung die Abhängigkeit von den traditionellen Agrarprodukten zu reduzieren, um den tendenziellen Bedeutungsverlust der landwirtschaftlichen Rohstoffe auffangen zu können.
Die Position der Industrieländer bei den Rohstoffverhandlungen: Neues Verständnis statt Beibehaltung der Ideologie der Vergangenheit
Wie steht es um die Bereitschaft der Industrieländer, den Entwicklungsländern im Demokratisierungsprozeß bei den laufenden Rohstoffverhandlungen entgegenzukommen? Zunächst ist es erstaunlich, daß seit einigen Monaten überhaupt wieder ernsthaft über neue internationale Kakao- und Kaffeeabkommen verhandelt wird. Noch Ende der 80er Jahre waren in der Bundesrepublik die Industrieverbände, deren Mitglieder tropische Genußmittel importieren und verarbeiten, der Meinung, daß nur das freie Spiel von Angebot und Nachfrage über den Preis bestimmen sollte. Ausgerechnet für diesen Teil des Weltmarktes sollte gelten, was bei den eigenen Industrieexporten längst keine Gültigkeit mehr beanspruchen konnte. (…)
Woher also nun der plötzliche Sinneswandel? Festzuhalten ist zunächst, daß er nichts mit einer politisch gewollten ökonomischen Unterstützung der Demokratisierungs- und Strukturanpassungsbemühungen zu tun hat. Sonst würden nicht relativ sinkende Ausgaben für die Entwicklungshilfe in der Bundesrepublik in so eklatanter Weise mit den gestiegenen Steuereinnahmen aus dem Rohstoffimport in Widerspruch stehen. Beispielsweise erzielte die Bundesrepublik 1980 bei einem Gesamtwert der Rohkaffeeimporte von DM 2,8 Mrd. Einnahmen aus der Kaffeesteuer in Höhe von DM 1,5 Mrd. Im Jahre 1991 hatte sich dagegen der Gesamtwert der Rohkaffeeimporte auf DM 1,8 Mrd. verringert, während gleichzeitig die Einnahmen aus der Kaffeesteuer auf DM 2,2 Mrd. angestiegen waren. Die niedrigen Preise für die Rohstoffe der Dritten Welt haben den Besteuerungsspielraum der Bundesregierung verbessert, während gleichzeitig die Ausgaben für die Entwicklungshilfe bezogen auf die Wirtschaftskraft des Landes relativ zurückgingen.
Ursache für den Sinneswandel bei den Rohstoffverhandlungen ist eine andere Befürchtung. Die Preise haben sich nach dem Auslaufen des internationalen Kaffeeabkommens keineswegs stabilisiert, sondern sind drastisch gefallen. Die Gefahr wird immer größer, daß vorhandene Plantagen nicht mehr gepflegt und abgeerntet werden, und daß Neuanpflanzungen mangels Kapital gänzlich unterbleiben, so daß es schon mittelfristig zu erheblichen Preissprüngen auf dem Weltmarkt kommen könnte. Wenn diese Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden müssen, entbrennt in der Branche der Verdrängungswettbewerb wieder mit voller Kraft. Wenn man jetzt wenigstens wieder miteinander spricht, geht es also nicht primär um die Interessen der Produzenten, sondern vornehmlich um die Partikularinteressen des Zwischenhandels auf Seiten der Konsumenten. (…) Funktionierende Rohstoffabkommen sind jedoch die Voraussetzung dafür, daß das Integrierte Rohstoffprogramm der UNCTAD – 1976 konzipiert und 1989 endlich in Kraft gesetzt – zumindest versuchen kann, den freien Fall der Rohstoffpreise zu stoppen.
Trotz gewisser Hoffnungsschimmer muß das Fazit für wichtige Rohstoffe daher ebenso lauten wie bei der Verschuldungsproblematik. Daran können auch die verschiedenen Kompensationsbemühungen der multilateralen Geber – die Lomé-Vereinbarungen mit der EG, die Ausgleichsfazilitäten des IWF sowie die diversen Hilfsprogammen speziell für Afrika – wenig ändern, da die bereitgestellten Mittel bei weitem nicht ausreichen, um dem Rohstoffpreisverfall wirkungsvoll begegnen zu können.(…)
Afrika am Tropf: Die Konkurrenz Osteuropas um knapper werdende Mittel
Wenn weder eine Lösung der Verschuldungskrise bevorsteht noch mit einer nachhaltigen Preisbelebung auf den Rohstoffmärkten zu rechnen ist, wird der schwierige Demokratisierungsprozeß dann wenigstens durch einen kräftigen Mittelzufluß aus öffentlichen und privaten Quellen gefördert? Auch die Initiatoren der Strukturanpassung hatten in ihren theoretischen Vorüberlegungen erkannt, daß ein massiver Zufluß von Direktinvestitionen und finanziellen Hilfen eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der Reformpolitik wäre. Tab. 2 zeigt, daß sich diese Hoffnungen kaum oder nur in Ansätzen erfüllt haben.
Entgegen einem verbreiteten Vorurteil hat es zwar für den Kontinent insgesamt keinen Nettokapitalabfluß gegeben, aber die z.T. hohen Nettoabflüsse an den IWF, beim Vermögenstransfer und bei der Bedienung der Schuldenlast werden inzwischen fast ausschließlich von der internationalen Entwicklungshilfe aufgefangen. Aufgrund der politischen und ökonomischen Instabilität sowie wegen der dramatischen Verschuldungssituation spielt Afrika im internationalen Vergleich sowohl bei den Direktinvestitionen als auch im Kalkül der privaten Banken praktisch keine Rolle mehr. Als Investitionsstandort, als Zielregion für Exportkredite und als Empfänger öffentlicher, Entwicklungshilfe schiebt sich gerade aus der westeuropäischen Perspektive Mittel- und Osteuropa immer stärker in den Vordergrund, wo im Zweifel auf schneller sichtbare Erfolge gesetzt wird. So sind im Haushalt für die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik für 1993 nicht nur reale Kürzungen zu verzeichnen, sondern auch Umschichtungen zugunsten der Osteuropahilfe.
Natürlich bedeutet der Wandel in Osteuropa auch, daß die früher sozialistischen Staaten weitgehend als Geber ausgefallen sind. Wenn die Entwicklungszusammenarbeit nicht gänzlich eingestellt wurde, so wurde sie in jedem Fall auf kleine Programme der Technischen Hilfe reduziert. Drastische Kürzungen gab es in jüngster Zeit auch bei der Hilfe aus arabischen Quellen, da die Unterstützung der Golfstaaten nach dem zweiten Golfkrieg zwangsläufig zurückgegangen ist.
Bleibt also nur die Internationale Entwicklungshilfe von Seiten der OECD-Länder. Zwar hat sie sich seit Beginn der 80er Jahre mehr als verdoppelt und dabei auch das Zuschußelement immer weiter gesteigert, aber der Nettoressourcenfluß hat sich seit Ende der 80er Jahre nicht mehr deutlich verbessert. Berücksichtigt man dann das Sinken der Entwicklungshilfe aus den Staaten des ehemals sozialistischen Lagers sowie aus der arabischen Welt, so muß Afrika südlich der Sahara seit Beginn des Demokratisierungsprozesses faktisch mit geringeren Hilfen von außen kalkulieren.
Zerstörerische Nahrungsmittelhilfe: Das Beispiel der EG-Fleischexporte nach Westafrika
Ein Plädoyer gegen das schleichende Herausstehlen der Industrieländer aus der Verantwortung, für Afrika darf jedoch nicht vor einer Kritik an bestimmten Formen der Hilfe zurückschrecken. Zwar wird niemand ernsthaft die moralische Verpflichtung zur Katastrophen- und Soforthilfe bei akuten Notlagen in Frage stellen, aber wenn diese Hilfe, zu einer institutionalisierten Nahrungsmittelhilfe wird, bewirkt dies häufig eine dauerhafte Nachfrage nach Lebensmitteln, die nicht oder nicht in ausreichenden Mengen im Land produziert werden können, wodurch wiederum die eigenen Bauern mit ihren Produkten vom lokalen Markt verdrängt werden. Inzwischen werden mindestens drei Viertel aller Nahrungsmittelhilfen in einer institutionalisierten Dauerform, also unabhängig von akuter Not, vergeben. Diese Form der Hilfe trägt nicht zu Lösungen bei; sie ist selbst Teil und Ursache vieler Probleme.
(…)
Eine unrühmliche Rolle spielt in diesem Zusammenhang besonders die Europäische Gemeinschaft. Sie verwendete in den 1980er Jahren im Durchschnitt über 30% ihrer Entwicklungshilfe für die Nahrungsmittelhilfe, wobei es primär darum ging, die chronischen Überschüsse der verfehlten gemeinsamen Agrarpolitik auf Drittmärkten abzustoßen. So hat die EG z.B. mit massiv subventionierten Rindfleischexporten nach Westafrika die Existenzgrundlage von Millionen von Nomaden existentiell bedroht bzw. zerstört. Während der Verbraucher in der EG durchschnittlich DM 15 pro kg Rindfleisch zahlt, wird es für den Export nach Westafrika auf weniger als DM 3,40 pro kg heruntersubventioniert. Mit diesem Dumpingpreis wird die lokale Konkurrenz aus der westafrikanischen Savanne ausgeschaltet, da hier Frischfleisch kaum unter DM 4,40 pro kg angeboten werden kann. Auf diese Weise hat die EG ihre Rindfleischexporte nach Westafrika in den 1980er Jahren versiebenfacht. Die Schizophrenie dieser Politik wird dadurch komplettiert, daß im gleichen Zeitraum mit bilateralen und EGMitteln Projekte zur Förderung der Fleischproduktion in mehreren Staaten Westafrikas finanziert wurden, ohne daß eine Aussicht auf wirtschaftliche Tragfähigkeit bei dem gegebenen Rindfleisch-Dumping der EG abzusehen wäre. Zwar wird von verschiedener Seite inzwischen auf diese Mißstände hingewiesen, aber die politische Korrektur steht in der Sache immer noch aus. Für den subventionierten Weizenexport der USA oder für den von Japan finanzierten Export asiatischer Reisüberschüsse nach Afrika lassen sich ähnliche Mißstände auch bei den anderen großen Gebern aufzeigen. Statt die eigenen Überschüsse zu Lasten afrikanischer Produzenten auf die Märkte zu werfen, sollte eine sinnvolle Politik dafür sorgen, daß im Katastrophenfall zunächst die in zahlreichen Staaten Afrikas produzierten Überschüsse bei den lokalen Grundnahrungsmitteln aufgekauft werden. Die institutionalisierte Nahrungsmittelhilfe trägt in ihrer jetzigen Form dagegen dazu bei, daß das wirtschaftliche Umfeld für einen politischen und ökonomischen Neubeginn mit einer weiteren Hypothek belastet bleibt.
Handelsprotektionismus des Nordens: Von einer Öffnung der Märkte weit entfernt
Zwar lassen sich die durch den Protektionismus der Industrieländer verursachten Export- und Wohlstandseinbußen nur schwer abschätzen, alle Studien stimmen jedoch darin überein, daß ein konsequenter Abbau des Protektionismus z.T. erhebliche Wohlstandseffekte für die Entwicklungsländer mit sich brächte. Selbst die niedrigsten Schätzungen kommen zu dem Schluß, daß die Entwicklungsländer bei einer umfassenden Handelsliberalisierung – einschließlich einer weiteren substantiellen Zollsenkung und eines konsequenten Abbaus der nicht-tarifären Handelshemmnisse – den Export von Gütern und Dienstleistungen um mindestens 5% erhöhen könnten, was Mehreinnahmen in Höhe von rund US-$ 60 Mrd. bedeuten würde. Diese Summe entspricht in etwa den gesamten jährlichen Entwicklungshilfeleistungen der Industrieländer.
Wie steht es um die Realisierungschancen eines solchen Schrittes? Als Indiz für die geringe Bereitschaft der Industrieländer zum Abbau des Protektionismus mag der Verweis auf den mehr als schleppenden Verlauf der GATT-Verhandlungen genügen. Das GATT wird von den Zynikern nur noch als »General Agreement to Talk and Talk« bezeichnet. (…) Die Interessen und die Gegensätze der Industrieländer bestimmen Ablauf und Gegenstand der Verhandlungen, während gleichzeitig die Tendenzen in Richtung auf eine regionale Blockbildung immer unübersehbarer werden.
Außerdem muß klargestellt werden, daß Afrika von einer umfassenden Liberalisierung des Welthandels weniger begünstigt würde, als die besser gestellten Entwicklungsländer. Es wären lediglich indirekte Vorteile zu erwarten. Afrika exportiert primär unverarbeitete Rohstoffe auf die Märkte der EG, die schon jetzt im Rahmen der Lomé-Assoziierung unbeschränkten Zugang erlauben. Profitieren könnte der Kontinent nur von der Mehrnachfrage nach Rohstoffen, die in der Folge eines liberalisierungsbedingten Wachstumsschubs für die Weltwirtschaft zu erwarten wären.
(…)
Insgesamt sollte Afrika einen möglichen Protektionsabbau dennoch begrüßen, denn dadurch stiege die Chance für eine Industrialisierung, die bei der Weiterverarbeitung der eigenen Rohstoffbasis ansetzt.
Die Perspektiven: Demokratisierungschancen bei einem schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeld
Es gibt im außenwirtschaftlichen Umfeld zwar einige Hoffnungsschimmer, der fundamentale Wandel der Rahmenbedingungen, der für einen schnellen Erfolg des ökonomischen und politischen Reformprozesses notwendig wäre – umfangreiche Schuldenstreichungen, Kompensationszahlungen für Rohstoffpreiseinbrüche und höhere Bereitschaft zum Abschluß von internationalen Rohstoffvereinbarungen sowie Steigerung der Entwicklungshilfe bei gezielter Konditionalität zum Erreichen der Armutsgruppen und entschlossenem Abbau kontraproduktiver Nahrungsmittelhilfe –, läßt aber weiter auf sich warten. Auch was den Marktzugang in den Ländern des Nordens betrifft, zeigen sich die Industrieländer weiterhin nicht bereit, den weltweiten Prozeß der Demokratisierung ökonomisch abzusichern. Der afrikanische Demokratisierungsprozeß findet in einem außenwirtschaftlichen Umfeld statt, das die spezifischen Probleme des Kontinents weitgehend außer acht läßt. Ist er damit notwendigerweise zum Scheitern verurteilt?
Ob durch Revolution, Militärputsch oder durch Abwahl, Regierungen scheitern dann, wenn es ihnen nicht gelingt, die Lebensbedingungen für die Mehrheit der Bevölkerung zu verbessern bzw. sie mindestens zu stabilisieren. Umgekehrt erhalten sie große politische Legitimität, wenn es gelingt, das Los einer Mehrheit nachhaltig zu verbessern. Selbst bei ökonomischen Erfolgen geht die Legitimität durch permanente Menschenrechtsverletzungen und mangelnde Partizipation an den Entscheidungen verloren, wenn damit nicht sogar auch die Dauerhaftigkeit des ökonomischen Erfolges ernsthaft in Frage gestellt wird.
Selbst bei fehlender außenwirtschaftlicher Unterstützung erscheint es daher nicht unmöglich, durch interne Reformpolitik politische Legitimität zu halten und zu gewinnen. Eine demokratisch gewählte Regierung, die die Menschenrechte respektiert, sich eine Armutsbekämpfungs- und Entwicklungsorientierung auf die Fahnen schreibt, vom zentralen Kommandostaat abrückt, dezentralen und föderalen Strukturen eine Chance gibt und zudem ernsthaft versucht, diese Ziele auch umzusetzen, muß nicht notwendigerweise scheitern. Der Spielraum für eine andere Akzentsetzung bei internen ökonomischen Entscheidungen ist sicher noch nicht ausgereizt. Diese Aufgabe ist allerdings ungleich schwerer zu lösen, als wenn sie gezielt von außen unterstützt würde. Angesichts der bleiernen Schwere der außenwirtschaftlichen Faktoren muß unter den gegenwärtigen Bedingungen daher davor gewarnt werden, den politischen Demokratisierungs- und Lernprozeß in Afrika allzu optimistisch zu beurteilen. Selbst bei allerbestem Willen einer demokratisch legitimierten Regierung in Afrika bleiben die Hürden hoch. Es deutet wenig darauf hin, daß der Norden seiner besonderen Verantwortung für diesen Prozeß gerecht wird.
| Tab. 1: Rohstoffpreisindices
des IWF, Jahresdurchschnittswerte, 1985-1992 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamt- index |
IL | EL | Nahrungs- mittel |
trop. Genuß- mittel |
landwirt. Rohst. |
Metalle u. Min. |
| 1985 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1986 | 96 | 94 | 99 | 88 | 115 | 102 | 94 |
| 1987 | 104 | 107 | 102 | 90 | 83 | 136 | 112 |
| 1988 | 128 | 135 | 120 | 115 | 83 | 149 | 161 |
| 1989 | 127 | 136 | 117 | 119 | 69 | 145 | 164 |
| 1990 | 118 | 125 | 109 | 108 | 60 | 139 | 150 |
| 1991 | 112 | 118 | 105 | 107 | 56 | 135 | 134 |
| 1992 | 112 | 119 | 103 | 109 | 49 | 139 | 130 |
| Anteile am Gesamtindex in % | 31,4 | 18,2 | 22,5 | 27,9 | |||
| ohne Erdöl und Gold; Nahrungsmittel: Öle und Ölsaaten, Getreide, Zucker, Fleisch, Bananen; Tropische Genußmittel: Kaffee, Kakao, Tee; Landwirtschaftliche Rohstoffe: Baumwolle, Wolle, Kautschuk, Häute und Felle, Jute und Sisal; Metalle und Mineralien: Kupfer, Eisenerz, Zinn, Aluminium, Zink, Nickel, Blei Quelle: IMF, International Financial Statistics, Washington, D.C.: IMF, versch. Jhg. |
|||||||
| Tab. 2: Öffentlicher und privater Nettokapitaltransfer nach Afrika südlich der Sahara, 1982-1991,(in Mrd. US-$) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer / Jahr | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1990 | 19911 |
| Nettoressourcenfluß2 | 12,8 | 14,5 | 22,3 | 23,5 | 24,1 | 24,6 |
| Davon: | ||||||
| Öffentl. Finanzhilfe (ODF) | 10,5 | 11,8 | 17,9 | 19,4 | 23,1 | 23,8 |
| - öffentl. Entwicklungshilfe (ODA) | 8,9 | 10,7 | 14,9 | 17,5 | 20,2 | k.A. |
| - bilateral | 6,4 | 7,5 | 10,6 | 12,2 | 14,2 | k.A. |
| - multilateral | 2,5 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,0 | k.A. |
| Exportkredite | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | -0,6 | -0,3 |
| Private Transfers | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 1,9 | 1,6 | 1,1 |
| - Direktinvestitionen | 0,3 | -0,2 | 1,2 | 2,5 | 1,1 | k.A. |
| - Bankkredite | 1,1 | 0,8 | 1,7 | -1,6 | -1,0 | k.A. |
| - Zuschüße von NRO3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | k.A. |
| Zusatzangaben: | ||||||
| Netto-Kreditfluß vom IWF | 1,5 | k.A. | -0,5 | -0,4 | -0,3 | k.A. |
| Vermögenstransfers | -1,3 | -3,3 | -1,9 | -3,3 | -3,2 | k.A. |
| Zins- und Dividendenzahlungen (brutto) | -6,3 | -6,3 | -6,6 | -8,0 | -6,3 | k.A. |
| Offizielle Zuschüsse | 5,6 | 7,4, | 9,2 | 11,5 | 15,2 | k.A. |
| 1) Schätzungen; 2) Nettoressourcenfluß: ODF + Exportkredite + Private Transfers; 3) NROs: Nichtregierungsorganisationen ; k.A.: Keine Angaben . Quelle: OECD, Financing and External Debt of Developing Countries, 1991 Survey, Paris: OECD 1992 |
||||||
Literatur
Bierschenk. T. u.a.(Hrsg.): Entwicklungshilfe und ihre Folgen: Ergebnisse empirischer Untersuchungen in Afrika. Frankfurt/Main u.a. 1993
Böhmer, J.: Die Auslandsverschuldung Subsahara-Afrikas: Entwicklung, neuere Initiativen der Gläubiger und Ansatzpunkte für eine Problembewältigung. In: Afrika Spectrum 28 (1993) 1, S. 5-35
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit: Konsequenzen eines Protektionismusabbaus der EG für die Entwicklungsländer. Informationsvermerk für den Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Bonn, 4. 2. 1993
Ekzenwe, U.: The African Debt Crisis and the Challenge of Development. In: Intereconomies 28 (1993) 1, S. 35-43
Herbst, J.: U.S. Economic Policy Toward Africa. New York: Council on Foreign Relations, Press 1992
Jakobeit, C.: Die Zukunft der Rohstoffökonomien in Afrika. In: Hofmeier, R./Tetzlaff, R./ Wegemund, R. (Hrsg.): Afrika – Überleben in einer ökologisch gefährdeten Umwelt. Münster und Hamburg 1992, S. 90-102
Kühne, W.: Demokratisierung in Vielvölkerstaaten unter schlechten wirtschaftlichen Bedingungen. Ein Diskussionsbeitrag am Beispiel Afrikas. In: Nord-Süd aktuell 6 (1992) 2, S. 290-300
Meyns, P./Nuscheler, F.: Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika. In: Nohlen, D./Nuscheler, F. (Hrs.): Handbuch der Dritten Welt. Band 4: Westafrika und Zentralafrika, 3. Auflage, Bonn 1993, S.13-101
Molt, P.: Chancen und Voraussetzungen der Demokratisierung Afrikas. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament (1993), B 12-l3, S. 12-21,
Schmieg, E.: Factors Influencing Price Developments of Commodities. In: Intereconomics 28 (1993), S. 138-143
Tetzlaff, R.: Demokratisierung von Herrschaft und gesellschaftlicher Wandel in Afrika: Perspektiven der 90er Jahre. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 1991
Anmerkung
Durch die freundliche Genehmigung des Autors und des Herausgebers konnte dieser Artikel aus dem »Afrika Jahrbuch 1992. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika südlich der Sahara« (Hrg. Institut für Afrika-Kunde, Rolf Hofmeier, Leske + Budrich, Opladen 1993) übernommen werden.
Anmerkungen
1) Im folgenden wird, soweit aus dem Kontext nichts anderes hervorgeht, unter »Afrika« die Region des Kontinents südlich der Sahara verstanden. Die Entwicklungen in Ägypten und Algerien werden gleichwohl erwähnt. Zurück
2) Alle numerischen Angaben sind Daten der »Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung«. Die AKUF, eine Gruppe von fortgeschrittenen Studierenden und Graduierten, widmet sich unter der Leitung von Prof. Dr. K.J. Gantzel der systematischen Beobachtung und Analyse des laufenden Kriegsgeschehens. Zurück
3) Zur hier verwendeten operationalen Definition des Begriffs vgl. Gantzel/MeyerStamer 1986 oder knapper: Gantzel/Schwinghammer/Siegelberg 1992. Zurück
4) Die ausgeschriebenen Formen der Vielzahl von Befreiungsbewegungen und Kampfverbänden auf dem afrikanischen Kontinent würden den Rahmen dieses Textes sprengen. Für die Eigennamen dieser Organisationen wende man sich an die Länderkapitel der diversen Ausgaben des »Afrika Jahrbuch« (1987ff.). Zurück
5) Siehe hierzu den Beitrag von P. Körner in diesem Dossier. Zurück
6) Einige dieser Fälle sind hier nur deshalb nicht als »Kriege« kategorisiert, weil nicht alle der oben genannten Kriterien der operationalen Definition erfüllt sind. Das sollte indes nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese Konflikte von den Betroffenen als Kriegssituationen erlebt werden. Zurück
7) Organization of African Unity, 1963 gegründet, über 50 Mitglieder Zurück
8) Siehe insbesondere Africa Leadership Forum, Kampala Document for a Proposed Conference on Security, Stability, Development and Cooperation in Africa (CSSDCA), Kampala 1991 sowie die Berichterstattung über den OAU-Gipfel 1993 in »West Africa«, »Jeune Afrique« und anderen Medien mit Afrikabezug Zurück
9) Siehe dazu auch: Kathrin Eikenberg/ Peter Körner, Bewaffnete Humanität oder Interessenpolitik? Militärinterventionen in Liberia und Somalia, in: Institut für Afrika-Kunde, Rolf Hofmeier (Hrsg.), Afrika Jahrbuch 1992, Opladen 1993: 34-45 Zurück
10) Siehe UNHCR Bulletin, 1 Oct. 1993: 9-10 Zurück
11) Siehe Le Monde 27.7.1993 Zurück
12) Siehe Margaret A. Vogt (Ed.), The Liberian crisis and ECOMOG: a bold attempt at regional peace keeping, Lagos 1992 Zurück
13) Die nachfolgende Darstellung orientiert sich im wesentlichen an der detaillierteren Aufbereitung von Fakten in den Ausgaben 1990 bis 1992 des »Afrika Jahrbuchs« (hrsg. v. Institut für Afrika-Kunde). Siehe dort die Länderartikel Liberia, Sierra Leone, Nigeria/Außenpolitik, Ghana/Außenpolitik, Senegal/Außenpolitik, Côte d'Ivoire/Außenpolitik, Burkina Faso/Außenpolitik, Guinea/Außenpolitik, Benin/Außenpolitik, Gambia/Außenpolitik sowie die Regionalüberblicke »Westafrika«. Für 1993 siehe besonders »West Africar« und »BBC Summary of World Broadcasts«. Zurück
14) Siehe Michael Clough, The United States and Africa: the policy of cynical disengagement, in: Current History, Vol. 91, No. 565, May 1992: 193-198 Zurück
15) Gründungstext im Anhang von Vogt 1992 Zurück
16) Texte im Anhang von Vogt 1992 Zurück
17) Siehe Margaret A. Vogt, Nigeria's participation in the ECOWAS Monitoring Group – ECOMOG, in: Nigerian Journal of International Affairs, Vol. 17, No. 1, 1991: 101-121 Zurück
18) Am deutlichsten formulierte Burkina Fasos Staatschef Compaoré die Position; siehe Jeune Afrique, 22.5.1991: 53. Zurück
19) Siehe West Africa, 20.8.1990: 2329 Zurück
20) Siehe Emeka Nwokedi, Regional integration and regional security: ECOMOG, Nigeria and the Liberian crisis, Centre d'Etude d'Afrique Noire, Univ. de Bordeaux, Travaux et Documents, No. 35, 1992, passim; Vogt 1991: 105ff Zurück
21) Siehe Patrick de Saint Exupéry/ Sophie Roquelle, La France parie sur le Libéria de Charles Taylor: La »montagne de fer« que convoite l'Elysée, in: Le Figaro 8.1.1992 4 Zurück
22) Siehe Nwokedi 1992: 12 Zurück
23) Siehe West Africa, 11.11.1991: 1886 Zurück
24) Siehe Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report Liberia 2/1993: 27 Zurück
25) Siehe Detailinformationen in diversen Ausgaben von »West Africa« und »BBC Summary of World Broadcasts« seit August 1992 Zurück
Dr. Peter Körner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Afrika-Kunde, Hamburg.
Klaus Schlichte ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der »Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung« an der Uni Hamburg.
Dirk Hansohm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Aufbaustudiengang „Small Enterprise Promotion and Training» und in der Afrika-Studiengruppe an der Universität Bremen.
Dr. Cord Jakobeit ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Internationale Politik der FU Berlin.