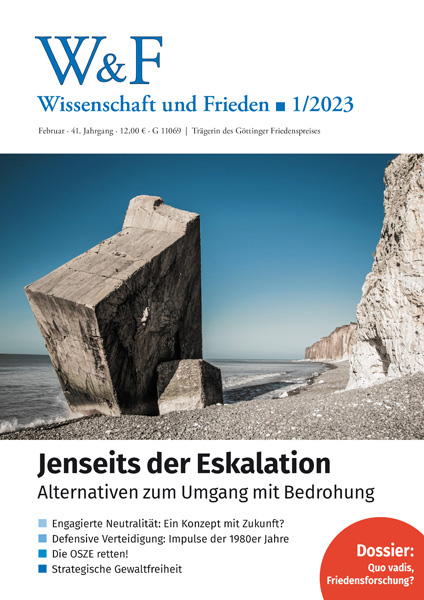Friedensforschung und (De-)Kolonialität
Workshop, Universitäten Klagenfurt und Augsburg, Klagenfurt, 05.-07. Juli 2022
Was bedeutet es, eine dekoloniale Perspektive auf die Forschung anzuwenden, insbesondere wenn es um die Friedens- und Konfliktforschung selbst geht? Welche Verantwortung und Rechenschaftspflicht haben Forscher*innen – und wem gegenüber? Wie können wir sicherstellen, dass die Forschung nicht gewaltsame und koloniale Praktiken innerhalb und außerhalb akademischer Einrichtungen reproduziert, sondern stattdessen privilegienbewusst und konfliktsensibel ist?
Diese und viele weitere Fragen wurden während eines dreitägigen Workshops an der Universität Klagenfurt im Juli 2022 diskutiert. Dieser Workshop war eine Erweiterung und Vertiefung eines Online-Workshops, der im Oktober 2021 zum gleichen Thema stattgefunden hatte (siehe W&F 1/2022). Der Workshop wurde von Claudia Brunner, Viktorija Ratković und Daniela Lehner (alle Universität Klagenfurt, Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung) sowie Christoph Weller und Christina Pauls (beide Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg) organisiert und durch die Deutsche Stiftung Friedensforschung gefördert.
Ziel des Workshops war es, die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis, Haltungen und Handlungen in der Friedens- und Konfliktforschung weiter zu beleuchten und Methoden und Praktiken innerhalb des Feldes selbst, insbesondere im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der Ukraine, kritisch zu hinterfragen. Daher wurden im Laufe des Workshops vor allem Fragen aufgeworfen, anstatt Antworten gegeben – und diese ermöglichten intensive Diskussionen, aus denen neue Allianzen und Ansätze für dekoloniale Arbeit in der Friedensforschung und -bildung hervorgegangen sind. Viele dieser Aufgaben wurden durch den Online-Workshop schon 2021 initiiert, nun hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ihre Themen zu vertiefen und praktisch zu erkunden. Alle Beiträge wurden nach dem »Gegenleseprinzip« präsentiert, d.h. der Text wurde nicht von Autor*innen, sondern von anderen Teilnehmer*innen vorgestellt und in der Gruppe diskutiert. Neben der reinen Textarbeit hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, an einer von Christoph Weller (Universität Augsburg) konzipierten und moderierten Sitzung teilzunehmen, die sich dem Ukrainekrieg als Herausforderung für Friedensstudien, Friedenserziehung und (De-)Kolonisierung widmete, und in einem von Joschka Köck (Theater der Unterdrückten Wien) gestalteten Begegnungsraum einen Einblick in das körperliche und szenische Forschen zu erhalten.
Der Beitrag von Sebastian Garbe befasste sich mit der Positionierung von Forscher*innen im wissenschaftlichen Prozess und reflektierte die Doppelrolle von Aktivist*innen und Forscher*innen, wobei er den Unterschied zwischen Selbstzentrierung und Transparenz der Forschung hinterfragte. In der Diskussion sind die Teilnehmer*innen zu der Einsicht gelangt, dass auch hegemoniale Selbstkritik selbst Forscher*innen in den Mittelpunkt stellen kann und dass Phänomene, die von Natur aus relational sind, nicht immer von einer einzigen Person angemessen erklärt bzw. theoretisiert werden können. Daher sprach sich Garbe für mehr Transparenz in der Kommunikation von Forschungsmethodologie, -prozessen und -ergebnissen aus. Das zentrale Thema seines Beitrags war jedoch die Solidarität mit und von den Mapuche als Forschungssubjekten, insbesondere basierend auf einem relationalen Verständnis von Solidarität, sowie die Ausübung von Solidarität als Einzelperson oder bei fehlenden Ressourcen. Relationale Verständnisse von Solidarität basieren weder auf Gegner*innenschaft noch auf Abgrenzungen von »Innen« und »Außen«, sondern betrachten Solidarität als eine gegenseitige dauerhafte Verpflichtung, die immer wieder neu ausgehandelt werden muss.
Juliana Krohn setzte das Gespräch über Solidarität fort, indem sie auf die Diskrepanzen zwischen den erklärten Verpflichtungen zur Beendigung institutioneller Gewalt und dem tatsächlichen Mangel an Solidarität in der Praxis hinwies. Sie warf auch die Frage auf, wer zur Rechenschaft gezogen werden sollte, wenn in bestimmten Situationen Gewalt beobachtet oder ausgeübt wird. Auch wenn es in vielen Fällen nicht möglich ist, eine generalisierte Anleitung für diese Fälle zu finden, waren sich die Diskussionsteilnehmer*innen einig, wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Impliziertheit, wie auch den eigenen Gefühlen der Ohnmacht und Überforderung als Zeug*innen auseinanderzusetzen, um diejenigen zu unterstützen, die direkt von Gewalt betroffen sind. Die Autorin betonte, dass selbst an Universitäten Gewalt ausgeübt wird, und dass die Friedens- und Konfliktforschung selbst möglicherweise nicht konfliktsensibler als andere Disziplinen ist, sondern sogar eine geringere Selbstwahrnehmung haben kann, wenn es um den Umgang mit unterschiedlichen Formen von Gewalt, wie institutioneller und symbolischer Gewalt, geht. Die Problematik läge darin, dass Vertreter*innen der Disziplin sich für besonders friedensorientiert und konfliktsensibel halten, aber in eigenen lebensweltlichen Kontexten kaum gegen Gewalt einstehen. Dadurch sei die Lücke zwischen Theorie und Praxis der Friedens- und Konfliktforschung sehr groß, was die Glaubwürdigkeit von Vertreter*innen der Disziplin zunehmend reduziere.
Den zweiten Tag des Workshops begann Cora Bieß mit einer Diskussion über den »Do No Harm«-Ansatz, indem sie ihn mit dem »HEADS UP«-Tool von Vanessa Andreotti konterkarierte (siehe S. 37ff. in dieser Ausgabe). Es wurde darüber diskutiert, wer definiert, was als schädlich oder wohltuend definiert wird. Um zu vermeiden, dass Do No Harm zu einem leeren Slogan ohne Substanz verkommt, muss sichergestellt werden, dass sich alle Konfliktparteien darüber im Klaren sind, wer die Entscheidungsgewalt darüber hat, was als nützlich und was als schädlich in einem bestimmten Kontext angesehen wird. Die Diskussion führte zu einem Gespräch darüber, welche wissenschaftlichen Ansätze der Friedenspädagogik Schaden anrichten können und welche materiellen Konsequenzen verschiedene Ansätze haben können. Dabei wurde beispielsweise die Messbarkeit und Operationalisierbarkeit von Bildungsprozessen kritisiert, welche oft durch Projektlogiken begrenzt und verkürzt werden. Weitere potentielle Schäden könnten entstehen, wenn ein geringes Maß an Machtsensibilität besteht und Friedenspädagogik nur als konfliktsensibles, nicht aber machtsensibles Handeln aufgefasst wird. Es wurde auch darüber gesprochen, dass die strenge Einhaltung von HEADS UP auch dazu führen kann, dass bestimmte Projekte oder Interventionen, die nicht dem Ansatz entsprechen, gar nicht erst angefangen werden. Dies könnte direkte materielle Konsequenzen haben, wenn die finanziellen Ressourcen solcher Projekte an den erforderlichen Stellen nicht verfügbar sind. Der Beitrag hob auch die Bedeutung einer privilegien- und konfliktsensiblen Haltung in der Praxis der friedenspädagogischen Arbeit hervor und ging der Frage nach, wie Konflikte von den Beteiligten, einschließlich der Interventionspartei, transformiert werden können.
Michaela Zöhrer und Christina Pesch berichteten über das partizipative Forschungsprojekt »Farida Global«, das als Versuch gestartet wurde, denjenigen die Entscheidungsmacht und die Macht der Wissensproduktion zurückzugeben, deren Situation von Forscher*innen und Journalist*innen oft ausgenutzt wird, in diesem Fall den Überlebenden des Völkermords an den Jesiden. Es wurden Fragen der Repräsentation, der Präsenz und der Abwesenheit im wissenschaftlichen Kontext aufgeworfen sowie die Art und Weise, wie die Betroffenen selbst Wissen produzieren oder verfügbar machen können, wobei auch das Schweigen eine Form des Widerstands darstellt. In der Diskussion wurde festgestellt, dass die (universitären) Räume, in denen Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen, so gestaltet sein müssen, dass diese Menschen – Überlebende – einbezogen werden. Diese Inklusivität muss jedoch die Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigen und sie nicht nur um der Forschungsgerechtigkeit willen einbeziehen. Das könnte beinhalten, dass zentrale Begriffe von ihnen selbst hervorgebracht und mit Inhalt gefüllt werden, wie beispielsweise der Begriff des »respektvollen Umgangs«, den sich die Überlebenden von der Wissenschaft wünschen.
Widerstand als zentrales Element in der Menschenrechtsbildung wurde im Beitrag von Josefine Scherling ausführlich diskutiert. Sie ging darauf ein, was Widerstand ist und welche Arten von Widerstand in verschiedenen Gesellschaften erlaubt (oder legal) sind, sowie darauf, wie er manchmal romantisiert oder vereinnahmt wird. Im Gespräch wurde thematisiert, dass Widerstand nicht selten mit Gewalt, Unterdrückung und Konflikten einhergehe, auch wenn Gewaltfreiheit immer wieder deklariertes Ziel konkreter Widerstandsbewegungen sei: Widerstand ist gefährlich, in manchen Kontexten mehr als in anderen. Deshalb sollten Friedensforscher*innen sensibel dafür sein, wie sie über Widerstand nachdenken und ihre eigene soziale wie geographische Verortung mit einbeziehen. Die Genealogie der Menschenrechte wurde erörtert, insbesondere die Tatsache, dass sie in ihrer Entwicklung selbst soziale Hierarchien hervorgebracht haben. Ein weiterer Diskussionspunkt war ein nicht-eurozentrischer Blick auf die Geschichte der Menschenrechte, z.B. anhand einer Ausrichtung von Geschichtserzählungen an der Haitianischen Revolution, sowie auf Visionen und Alternativen und unterschiedliche lokale Bezugsrahmen zu diesem Thema. Dabei wurde festgehalten, dass Perspektiven aus dem Globalen Süden als Ausgangspunkt für historische Erzählungen der Menschenrechte dienen sollten.
Die Diskussion der Beiträge der Teilnehmer*innen wurde mit der Präsentation des Beitrags von Maria Zhiguleva abgeschlossen, in dem sie sich mit post- und dekolonialen Theorien und deren Anwendung im postsowjetischen Raum befasste: insbesondere mit den Möglichkeiten und Grenzen dieser Anwendungen. Obwohl es strukturelle Unterschiede zwischen den Imperien (in diesem Fall in Europa und Russland/UdSSR) gibt, sind die Beziehungen zwischen dem Zentrum in Moskau und den Regionen in der Peripherie zu beobachten, und der interne Kolonialismus kann für diese Region relevant sein. Ein Schwerpunkt lag auf den praktischen Implikationen für die Friedensbildung, wobei die Frage gestellt wurde, ob es Maßnahmen gibt, die ergriffen werden können, um das Ende der Gewalt gegenüber der Ukraine heute zu fördern und die Bedingungen und den Kontext des postkolonialen Friedens in der Region in Zukunft zu überprüfen. In der Diskussion sprachen die Teilnehmenden die Tatsache an, dass Kolonialität vielfältig und vielschichtig ist und dass es für die Analyse des Kolonialismus im postsowjetischen Raum sinnvoll sein könnte, spezifische Verbindungen zu neuen imperialen und maskulinen Regimen zu identifizieren. Darüber hinaus wurde Trauma als Instrument der Kolonisierung genannt, insbesondere das transgenerationale Trauma als Instrument zur Verursachung von Schäden, die über Generationen hinweg andauern – wie etwa am Beispiel des Stalinismus zu sehen.
Die Sitzung, die dem Krieg in der Ukraine als Herausforderung für die Friedens- und Konfliktforschung gewidmet war, wurde von Christoph Weller organisiert und moderiert. Ziel war es, die persönliche Positionierung, Erwartungen und Verantwortung jedes Einzelnen als soziales, politisches und wissenschaftliches Subjekt zu reflektieren. Fragen der Gewaltfreiheit als Thema, getrieben durch das Privileg, nicht in einem kriegsgebeutelten Land zu leben, wurden ebenso diskutiert wie Fragen der (Un-)Sichtbarkeit im Hinblick auf aktuelle Konflikte in anderen Weltregionen, die durch Doppelmoral und unterschiedliche Haltungen geprägt sind (z.B. Afghanistan oder Syrien). Gewaltfreiheit, Gewaltreduzierung und die Mittel zu ihrer Erreichung wurden im Zusammenhang mit dem Krieg (und Cyberwar) in der Ukraine erörtert, und die Positionierung des Westens und der deutschsprachigen Länder als Teil (oder nicht Teil) des Konflikts wurde ebenfalls diskutiert. Die Gruppe ist zu dem Schluss gekommen, dass Forscher*innen in der Friedens- und Konfliktforschung eine besondere Verantwortung haben, hegemoniale Konfliktquellen zur Sprache zu bringen und die Aufmerksamkeit für andere laufende Konflikte, in denen teils akute Unterversorgung herrscht, nicht zu verlieren. Die Positionierung Europas als »Friedensmacht« wurde hervorgehoben und kritisiert, ebenso wie die Notwendigkeit, die Analyse auf alle Aspekte des Krieges auszuweiten: der Diskurs über Waffenlieferung kann nicht andere wichtige Sachleistungen, Unterstützungsstrukturen und Programme der psychischen Gesundheit und psychosozialen Unterstützung ersetzen, die ebenfalls dringend notwendig sind.
Am dritten und letzten Tag des Workshops wurden die Teilnehmer*innen in einer von Michaela Zöhrer konzipierten und moderierten Abschlusssitzung gebeten, über die während des Workshops aufgeworfenen Fragen zu reflektieren, ihre Meinung zu offenen und ungelösten Lücken und Diskrepanzen zu äußern und über ihre Erwartungen sowie über mögliche Lösungen und nächste Schritte zu sprechen, die Forscher*innen in ihrer weiteren wissenschaftlichen Arbeit nutzen könnten. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, Aktion und Haltung, war eines der drängendsten Themen, die auf dem Workshop diskutiert wurden. Die Wichtigkeit, das eigene Selbstbild und die tatsächlichen Handlungen zu betrachten, sowie die Notwendigkeit, generell mehr zu handeln, wurde geäußert. Das Zusammentreffen im Workshop und die Arbeit in der Gruppe hat die Teilnehmer*innen dazu gebracht, über die Bedeutung von Gemeinschaft und Solidarisierung in der Friedens- und Konfliktforschung nachzudenken. In dem Rahmen wurde die Bedeutung der Schaffung sicherer – und mutiger – Räume praktisch erprobt und theoretisch als Grundlage dafür reflektiert, wie jede*r Forscher*in zu ihrer Schaffung beitragen kann, um die eigene Verantwortung zu übernehmen.
Kontakt: decolonizepeace@aau.at
Maria Zhiguleva