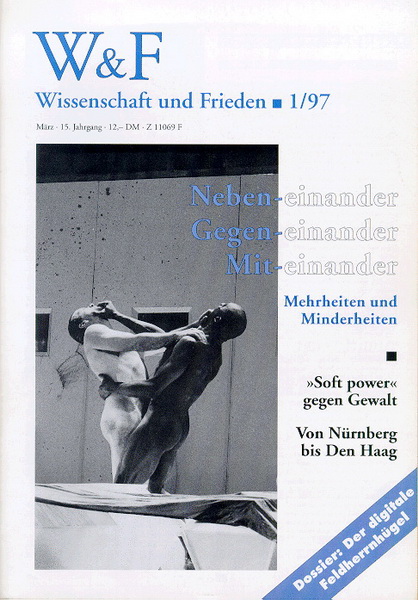Kein Frieden mit der Natur ohne Frieden unter den Menschen
von Jürgen Scheffran /Markus Jathe
Vom 29. November bis 1. Dezember 1996 fand in der Evangelischen Akademie Mülheim ein interdisziplinäres Fachgespräch zur Verknüpfung von Umwelt, Entwicklung und Frieden statt. Ziel war es, die Querbezüge zwischen der Diskussion über nachhaltige Entwicklung einerseits und der Friedens- und Konfliktforschung andererseits aufzuzeigen, um daraus integrierte Handlungsperspektiven abzuleiten. Die gegenseitige Durchdringung der Bereiche fand schon im Titel der Tagung »Frieden durch nachhaltige Entwicklung? Nachhaltige Entwicklung durch Frieden?« ihren Ausdruck. Dabei konnte an die ein Jahr zuvor am selben Ort veranstaltete Tagung zum Thema »Wissenschaft und nachhaltige Entwicklung« angeknüpft werden, die der Wuppertal-Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« gewidmet war. Veranstalter waren die Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (AFK), die Naturwissenschaftler-Initiative „Verantwortung für den Frieden“ und die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS) an der TH Darmstadt.
Die Annäherung an die Thematik erfolgte in drei Blöcken: einem Aufriß des Problemkomplexes, Beispielen aus den Konfliktfeldern Energie, Umwelt und Nord-Süd-Verhältnis sowie dem zukunfts- und lösungsorientierten Block »Leitbilder und Zukunftskonzepte«.
In einem Einführungsvortrag von Jürgen Scheffran wurde die These zur Diskussion gestellt, daß Frieden eine wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung nachhaltiger Entwicklung sei, zugleich aber nachhaltige Entwicklung auch eine Bedingung langfristiger Friedenssicherung. Ziel sei in beiden Fällen die Erhaltung und Entfaltung des Lebens auf der Erde. Die entscheidende Frage sei, wie ein Übergang von dem Teufelskreis aus Umweltzerstörung, Unterentwicklung und Krieg zu einer Positivkopplung von Umwelterhaltung, Entwicklung und Frieden erreicht werden könne. Um die wechselseitige Verstärkung von Wachstum, Macht und Gewalt, die der Schaffung nachhaltiger und friedlicher gesellschaftlicher Strukturen im Wege steht, zu überwinden, sei ein hohes Maß an Konfliktfähigkeit erforderlich. Eine konsequente Konfliktvermeidung wird um so dringlicher, als unter dem Schlagwort der »erweiterten Sicherheit« eine unzulässige Ausweitung des militärischen Auftrags auf alle Sicherheitsdimensionen erfolgt, inklusive der »ökologischen Sicherheit«. Daß ein entsprechender Paradigmenwechsel seit Ende des Kalten Krieges in vollem Gange ist und bereits in neuen Rüstungsprojekten und Militärplanungen seine Entsprechung gefunden hat, wurde eindrücklich in dem Beitrag von Wolfgang Vogt dargelegt. Zwar sei die militärische Bedrohung Europas zurückgegangen, doch um einen Rüstungsetat von 50 Mrd. DM zu sichern und eine Funktionserweiterung des Militärs vorzunehmen, werden neue Risikoszenarien – vom Islam bis zur Ölkatastrophe – an die Stelle alter Feindbilder gesetzt. Militärische Ansätze zur Krisenintervention und Katastrophenabwehr finden Akzeptanz in der Bevölkerung. Statt auf die nachträgliche militärische Bewältigung von Krisen und Konflikten zu vertrauen, sei für Europa die schwierigere Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung auf ein Zivilisierungsmodell erforderlich, das die Systemlogiken von Ökonomie, Politik, Technologie und Kultur an ökologischen Erfordernissen und menschlichen Bedürfnissen orientiert.
Betroffen macht, wie selbstverständlich die Logik militärischer Macht vom vergangenen Ost-West-Konflikt nunmehr auf den komplexeren Nord-Süd-Konflikt übertragen wird, den Franz Nuscheler als einen Verteilungskonflikt über Entfaltungschancen beschreibt. Während der für die globale Krise hauptverantwortliche Norden ökologische Strukturänderungen verzögert, mutet er dem Süden zu, den Verlockungen des westlichen Wirtschaftsmodells zu entsagen, um die Tragfähigkeit der Erde nicht überzubelasten. Demgegenüber beklagen Entwicklungsländer die Einschränkung des Rechts auf Entwicklung und erheben gegenüber dem Norden den Vorwurf des Ökoimperialismus, gegen den die »eigenen« Ressourcen verteidigt werden müssen. Angesichts der eklatanten Unterschiede kann ohne Gerechtigkeit, die der Dritten Welt die Befriedigung der Minimalbedürfnisse garantiert, Frieden dauerhaft nicht gesichert werden.
Die der Wissenschaft zugrundeliegende Ambivalenz beschrieb Wolfgang Liebert. Das von Bacon visionär gezeichnete Programm der Wissenschaft ist zwar in mancher Hinsicht Wirklichkeit geworden, doch herrscht Ernüchterung über den humanitären Gehalt und die destruktive Kraft der Wissenschaft. Wissenschaftlern das Management der Ökosphäre durch gezielte Eingriffe zu überlassen (Hubert Markl) würde bedeuten, die Katze zum Hüter der Mäuse zu machen (Hans-Peter Dürr). Noch problematischer ist der Beitrag zu Rüstung und Krieg. Zunehmend werden angesichts knapper Rüstungshaushalte und Militärkritik die zivilen wissenschaftlich-technischen Ressourcen dienstbar gemacht, unter Ausnutzung der Ambivalenz von Forschung und Entwicklung. Um den Deckmantel zu enthüllen und die Pflicht zur Mitnatürlichkeit auch in der Wissenschaft zur Geltung zu bringen, ist eine Ambivalenzanalyse ebenso erforderlich wie die Anwendung von Kriterien für Wissenschaft wie sie etwa vom Institut für sozial-ökologische Forschung entwickelt wurden.
Daß nicht nur die Wissenschaft mit widersprüchlichen Tendenzen zu kämpfen hat, sondern auch die Politik machte Thomas Fues (Bündnis 90 / Die Grünen) deutlich. Daß auf dem am selben Wochenende stattfindenden Parteitag der Grünen die Zustimmung zu Militäreinsätzen in Bosnien zur Abstimmung stand, zeigte nur, wie sehr einst von der Bevölkerungsmehrheit vertretende friedenspolitische Positionen in die Defensive geraten sind. Die Verengung auf die pragmatische Frage »Einsatz Ja oder Nein?« vermeidet das Erkennen größerer Zusammenhänge, was eine vorbeugende Konfliktvermeidung unmöglich macht und folgenschwere Grundsatzentscheidungen mit dem tagespolitischen Sachzwangargument durchdrückt.
Wie stark verschiedene Konfliktursachen bereits miteinander verwoben sind, wurde an einigen Beispielen exemplarisch untersucht. Einige Beiträge waren bestrebt, mit der Energienutzung verbundene Konfliktfelder aufzuzeigen. Diese betreffen nicht nur Konflikte aufgrund der Folgen der Energienutzung, etwa zu Klimakonflikten (Jürgen Scheffran) und zu den vielfältigen Risiken der Kernenergie (Martin Kalinowski), sondern auch Konflikte um die Verfügbarkeit von Energiequellen, die Verteilung ihres Nutzens oder die Vermeidung von Risiken. Daß sich auf der allgemeinen Zielebene zwar leicht Einigkeit erzielen läßt, bei konkreten Vorschlägen jedoch Kontroversen aufbrechen, wurde auf der Tagung selbst deutlich. So löste der in dem Beitrag von Sven Brückmann unternommene Versuch, im Konflikt um die Ölquellen des Nahen Ostens ökonomische Alternativen zu militärischem Eingreifen zu begründen, eine lebhafte Kontroverse darüber aus, ob das Einlassen auf solche Kalküle nicht bereits zu einer Anerkennung der auf fossilen Energieträgern basierenden Strukturen beitrage. Kritische Fragen wurden auch gegenüber Konzepten wie »Joint Implementation« aufgeworfen, die die Vermeidung von klimaschädigenden Emissionen im Westen durch Emissionsminderungen in der Dritten Welt ersetzen oder ergänzen sollen (Dirk Ipsen). Schließlich führte der von Manfred Fischedick vorgestellte und weitgehend positiv beurteilte Ansatz der Wuppertal-Studie, die für eine nachhaltige Energiepolitik notwendigen Verhaltensänderungen durch Leitbilder zu erreichen, zu der Frage, ob hierbei den Zielkonflikten um die Durchsetzung gegen gesellschaftliche Interessen und Widerstände nicht aus dem Weg gegangen werde.
Am Beispiel von Nahost und Afrika wurde deutlich, daß Umweltkonflikte um knappe Naturressourcen zwar an Bedeutung gewinnen, aber selten alleinige Konfliktursache sind. Die ausgiebig untersuchten Wasserkonflikte in Nahost (Manuel Schiffler) zeigen, daß das Konfliktverhalten der Akteure durch den übergreifenden politischen Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn dominiert wird und eine Konfliktlösung von Fortschritten im Friedensprozeß abhängt. Noch schwieriger stellt sich die Lage in Afrika dar, wo Land- und Umweltflucht zu grenzüberschreitenden Konflikten beitragen (Roland Richter). Im Falle Ruandas haben Bevölkerungswachstum und Bodendegradation zwar den Problemdruck erhöht, doch ist der Ausbruch des Völkermords vorwiegend auf politische Interessen und ethnische Gegensätze zurückzuführen.
Mit der Globalisierung der kapitalistischen Ökonomie ist eine weitere Zerstörung kultureller Zusammenhänge und eine Zunahme regionaler Konflikte zu befürchten. Neoklassische Ökonomie und neoliberale Politik zielen auf eine Deregulierung, die Gemeinschaftsgüter der privaten Verfügung und den Marktgesetzen unterwirft. Ausgehend von der Frage »Wem gehört die Natur?« setzte sich Mohssen Massarrat mit dem auf John Locke zurückgehenden Eigentumsbegriff bei Naturressourcen auseinander. Durch die Geldwirtschaft und die Akkumulation von Kapital wird die Anhäufung fremder Arbeit möglich. Wird ein derartiger Erwerb von Natureigentum als »gerecht« angesehen, können Maßnahmen »gerecht"fertigt werden, die auf die Verteidigung des Eigentums durch physische Gewalt oder die Enteignung indigener Völker von ihren Lebensräumen zielen (Beispiel Ogoni in Nigeria). Alternativen zur neoklassischen Ökonomie, die die Natur als Produktionsfaktor ignoriert und das Markgleichgewicht als konfliktfreien, harmonischen Zustand idealisiert, müssen eine Mengenregulierung des Angebots anstreben, also am Anfang der Pipeline ansetzen, und auf das Eigentum von knappen Naturressourcen verzichten.
Mit der Globalisierung ist zwar die verstärkte Durchlässigkeit nationaler Grenzen gegen Kapital und Information verbunden, doch zugleich werden Barrieren zwischen Nord und Süd gegenüber damit verbundenen Problemen errichtet, insbesondere gegen mögliche Flüchtlingsströme und militärische Bedrohungen. Die westlichen Zentren, insbesondere Europa, entwickeln sich in dieser Hinsicht zu Festungen, die auch militärisch verteidigt werden sollen. Von neuen Bedrohungsszenarien ausgehende Implikationen für den Rüstungssektor wurden von Götz Neuneck beleuchtet. Neue Rüstungstechnologien seien nach Ansicht des früheren US-Verteidigungsministers Perry auch deswegen notwendig, weil andere die alten schon haben. Aus Mangel an konkreten Feindbildern wird der Westen sich selbst zum größten Feind. Dies wird auch deutlich durch die Art und Weise, mit der die NATO an Atomwaffen festhält, auf Raketenabwehr setzt oder ihre Expansion nach Osteuropa gegen den Widerstand Rußlands durchsetzt.
Im abschließenden Teil der Tagung wurde bezugnehmend auf die Ausgangsfrage beleuchtet, wie Visionen und Leitbilder von Frieden und nachhaltiger Entwicklung sich gegenseitig befruchten können. Der Physiker und Studienleiter der Evangelischen Akademie Mülheim, Hans-Jürgen Fischbeck, wies darauf hin, daß die biblischen Visionen vom Frieden den Einklang zwischen Mensch und Natur voraussetzen.
Der Sozialethiker Wolfgang Bender lenkte den Blick auf Kants Entwurf »Vom Ewigen Frieden«. Im einzelnen diskutierte er sechs unterschiedliche Verhaltensweisen, wie Menschen in Lebensnot reagieren können. Während die in der heutigen Erlebnisgesellschaft verbreitete Grundhaltung, Problemen auszuweichen oder sie zu verdrängen nur eine befristete Entspannung bringt, sind Resignieren und Sublimieren typische Verhaltensweisen in der Risikogesellschaft. Im Extremfall kann dies zu völliger Verzweiflung, zu Haß und Vernichtungsbereitschaft gegen sich selbst oder andere führen. Demgegenüber stehen die Prinzipien des Fürchtens und Bewahrens, die von Hans Jonas in seinem »Prinzip Verantwortung« angesprochen wurden. Die von Ernst Bloch im »Prinzip Hoffnung« verfolgten Intentionen des Hoffens und Veränderns sind geeignet, umfassende Humanität anzustreben und auch zu realisieren. Bevorzugt wurden von Wolfgang Bender jedoch die ethischen Prinzipien der Erhaltung und Entfaltung des Lebens, die sowohl für Frieden wie auch für nachhaltige Entwicklung handlungsleitend sein können. Beide Prinzipien sind in Einklang zu bringen, um zu vermeiden, daß etwa die Entfaltung einiger Lebewesen die Erhaltung und Entfaltung anderer Lebewesen unzulässig beeinträchtigt. Die individuelle Freiheit endet bei der Freiheit anderer.
Durch eine derart umfassende Perspektive zum Widerspruch gereizt sah sich der Politikwissenschaftler Lothar Brock, der eine zu weitgehende Vermischung oder zu großzügige Ausweitung der Begrifflichkeiten ablehnte, da diese zu wertlosen Identitäten würden oder gar unerwünschte politische Implikationen hätten (wie bei der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs). Eine Gleichsetzung von Umweltzerstörung und Krieg sei ebensowenig angemessen wie die allgemeine These, daß Umweltzerstörung zum Krieg führe. Ein eindeutiger Zusammenhang sei kaum nachzuweisen. Eher komme es darauf an, in den jeweiligen Konfliktfeldern Umwelt, Entwicklung und Frieden enge analytische Kategorien zu entwickeln, die Probleme im Detail zu betrachten und praktische Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Ausgehend von der in Rio 1992 erarbeiteten Agenda 21 für Umwelt und Entwicklung und der vom damaligen UN-Generalsekretär Bhoutros-Ghali vorgestellten Agenda für den Frieden lenkte er den Blick auf konkrete Politikkonzepte, von völkerrechtlichen Verträgen bis hin zu humanitär oder ökologisch begründeten Interventionen.
Wie praktische Politik für »Ökologie von unten« aussehen kann, zeigte der Vortrag von Ulrike Kronfeld-Goharani, die anhand von konkreten Beispielen vorführte, wie die Agenda 21 von der globalen auf die lokale Ebene umgesetzt werden kann. Die Perspektive wurde zum Abschluß der Tagung wieder erweitert durch Ulrich Albrecht, der die Interaktion zwischen Politik und Ökonomie in den Blick nahm, insbesondere die politischen Dimensionen von Globalisierung, die damit verbundene Entstaatlichung von Gesellschaft und das (noch diffuse) Konzept der Weltgesellschaft.
Die Tagung konnte zwar neuartige Perspektiven und Diskussionsfelder eröffnen und Zusammenhänge aufzeigen, machte jedoch deutlich, daß das interdisziplinäre Zusammenführen verschiedener Forschungs- und Politikbereiche selten schnell greifbare Resultate liefert, die zu politischen Handlungsperspektiven führen. Es wurde vereinbart, ein Projekt zum Thema Frieden und Nachhaltigkeit fortzuführen, das die Wechselbeziehungen der drei Problemkomplexe Umwelt, Entwicklung und Frieden in Richtung auf integrierte Lösungskonzepte und Handlungsvorschläge für die Politik untersuchen soll. Eine Verbesserung der Forschungszusammenarbeit wird angestrebt, ein Tagungsband ist geplant.
Dr. Jürgen Scheffran ist wissenschaftlicher Assistent, Dr. Markus Jathe wissenschaftlicher Mitarbeiter bei IANUS an der TH Darmstadt.