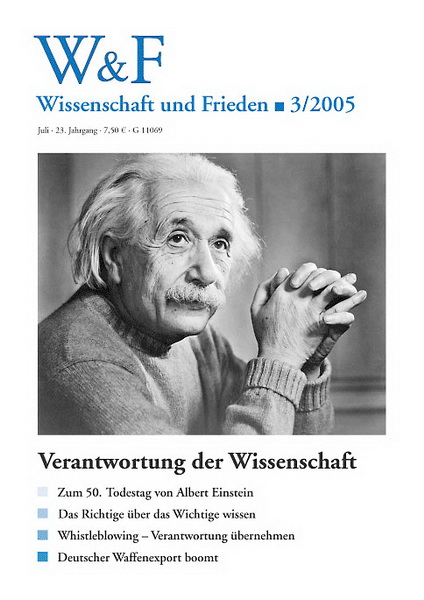Quo vadis DSF?
Zu den Schwierigkeiten der Forschungsförderung in Sachen Frieden / Interview mit Christiane Lammers
von Christiane Lammers und Jürgen Nieth
Die Wiederaufnahme der Förderung der deutschen Friedensforschung zählte zum Wahlprogramm von Rot-Grün 1998. Tatsächlich wurde sehr schnell nach der Wahl die gemeinnützige Stiftung Deutsche Friedensforschung gegründet und mit einem Startkapital von 50 Millionen DM ausgerüstet. Christiane Lammers, Mitarbeiterin der LAG Friedenswissenschaft in NRW und Mitglied der W&F-Redaktion war seit ihrer Gründung am Aufbau der Stiftung beteiligt und fast 5 Jahre stellvertretende Vorsitzende der DSF. Im April ist sie von dieser Funktion zurückgetreten. Jürgen Nieth sprach mit ihr über die Arbeit der Stiftung und die Hintergründe ihres Rücktritts.
W&F: Darf man fragen, was die Gründe für diesen plötzlichen Rücktritt waren?
C. L.: Ich mag personell festgefahrene Gremien nicht und halte es für gut, wenn durch Wechsel an den Spitzen von Gremien neue Ideen, andere Hintergründe und bereichernde Erfahrungen zum Tragen kommen können…
W&F: …dafür gibt es Wahlperioden, dann kann mensch auf eine erneute Kandidatur verzichten…
C. L.: …prinzipiell stimmt das! Meinen Rücktritt habe ich vor dem Stiftungsrat auch damit begründet, dass in der Arbeit des nach dem Tod von Dieter S. Lutz neu zusammengesetzten Vorstands Unstimmigkeiten auftraten. Nach außen sichtbar ging es zunächst vor allem um Detailfragen, die mir aber eine produktive Kooperation zunehmend schwerer gemacht haben. Im Hintergrund standen unterschiedliche Prämissen, die die Ausrichtung der Stiftung im Zuge der nun nach fünf Jahren geschaffenen Etablierung betreffen. Insofern spielten inhaltliche Gründe bei meinem Rücktritt auch eine Rolle.
W&F: Kannst Du das etwas spezifizieren? Was waren Deine Zielsetzungen?
C. L.: Im September 2000 habe ich in einem Brief an den Kollegen und an der Konzeptionierung der Stiftung intensiv beteiligten späteren Vorsitzenden des Stiftungsrats, Dieter S. Lutz, umrissen, welche Ziele bei der Stiftungsgründung für mich eine herausragende Bedeutung haben. Diese betrafen die Auswahl der Personen für den Stiftungsrat, die inhaltlichen Prioritätensetzung, die strukturellen Defizite der Friedensforschung und auch den Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft/Politik/Öffentlichkeit.
W&F: Und was sollte die Stiftung auf diesen Gebieten leisten?
C. L.: Ich habe damals betont, dass meines Erachtens tagespolitische Probleme – wichtige Mainstreamer der Friedensforschung focussierten z.B. auf das Problem der sogenannten Rückkehr des Krieges nach Europa – zu große Beachtung fanden und im Vorfeld der Stiftungsgründung die in der Friedensforschung selbst liegenden Defizite eine zu kleine Rolle spielten. Konkret ging es mir um Folgendes, ich darf zitieren: „Die Theorie- und Methodenbildung der Friedensforschung ist unterentwickelt; dies hängt stark mit der mangelnden Implementierung in der Lehre zusammen. Interdisziplinarität findet höchstens in einigen wenigen Forschungsprojekten – außeruniversitär – statt, wobei einige Fachdisziplinen leider so gut wie keine Rolle spielen. Gerade in Bezug auf die Naturwissenschaften machen sich die meisten FriedensforscherInnen, die in der Regel SozialwissenschaftlerInnen sind, keine Vorstellungen über Hindernisse und Schwierigkeiten. Die »Hardware«-Friedensforschung – Militärtechnologien, militärische Strukturen, Ökonomie – findet an Hochschulen und auch sonst kaum statt.“ Wir waren uns damals einig, dass der Nachwuchsförderung, der fächerübergreifenden, problemorientierten Zusammenarbeit sowie dem Einbringen friedenswissenschaftlicher Expertise in die gesellschaftliche Debatte eine besondere Bedeutung zukommt. Wir hatten außerdem die vielleicht etwas naive Vorstellung, dass innovative, noch nicht so abgesicherte und etablierte Wissenschaftsansätze eine Chance zur Förderung erhalten könnten und das Förderungsprozedere seitens der Stiftung wesentlich zeitnaher und unbürokratischer als üblich ablaufen könnte.
W&F: Und wie sieht die Bilanz aus?
C. L.: Für mich liegt der wesentlichste Erfolg der Stiftung in der Verwirklichung des Nachwuchsförderungsprogramms. Hier vor allem in der Implementierung der Masterstudiengänge, mit denen ich die Hoffnung verbinde, dass NachwuchswissenschaftlerInnen in einer quantitativ nennenswerten Größenordnung ausgebildet werden. Somit kann eine personelle Basis geschaffen werden, die nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den mehrheitlich außerhalb der Forschung befindlichen Berufsfeldern zur Professionalisierung der Friedensarbeit beiträgt. Besonders erfreulich ist auch, dass die geförderten Studiengänge unterschiedlich disziplinär und inhaltlich/strukturell ausgerichtet sind und trotzdem bei allen praxisorientierte und fachübergreifende Lehrangebote integriert wurden. Den zweiten Erfolg sehe ich in der im Herbst anlaufenden naturwissenschaftlichen Stiftungsprofessur in Hamburg. Ich hoffe, dass es dort gelingt, nicht nur die dringend notwendige naturwissenschaftliche Expertise in der Friedensforschung zu stärken, sondern dass diese auch in die grundständige Lehre der Naturwissenschaften ausstrahlt. Vielleicht erweist sich die erhebliche finanzielle Mittel bindende Förderungsart »Stiftungsprofessur« ja als so erfolgreich, dass die Stiftung in einigen Jahren zu dem Entschluss kommt, in dem anderen, völlig unterbelichteten Bereich, nämlich den Wirtschaftswissenschaften, Ähnliches zu wagen.
W&F: Das hört sich ja sehr positiv an, womit bist Du unzufrieden?
C. L.: Nicht ganz so sicher ob des Erfolges bin ich mir bei der Projektförderung, d.h. dem, was gemeinhin als Kerngeschäft der Forschungsförderung definiert wird. Für mich stellt sich die Frage, ob bei der gegenwärtigen Strategie wirklich gesichert ist, dass die Projekte und ihre Ergebnisse sowohl für die durchführenden Institutionen wie auch für die mitarbeitenden WissenschaftlerInnen, für die Friedensforschung wie auch für die Friedensarbeit eine größere Relevanz entwickeln können. Völlig unbefriedigend finde ich, dass wir seitens der Stiftung die mangelnde Interdisziplinarität in der Forschung zwar als Problem erkannt, aber bisher keinen Handlungsansatz hierfür gefunden haben. Für mich ist die fächerübergreifende Zusammenarbeit deshalb so wichtig, weil sie adäquater auf die Problem- und Praxisorientierung hinführt.
W&F: Du hattest oben von Vorschlägen zur Struktur und zumTransfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft/Politik/Öffentlichkeit gesprochen…
C. L.: Der Transfer von Wissen bedarf heute eigener Kompetenzen, die nicht unbedingt zu den Qualifikationsmerkmalen und engeren Arbeitsfeldern von WissenschaftlerInnen gehören. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass die Stiftung hier unterstützend tätig werden sollte z.B.
- durch Organisation von Veranstaltungen und Arbeitskreisen, deren Adressaten nicht nur die Parteien sind, sondern auch die in diesem Feld engagierten zivilgesellschaftlichen Gruppen;
- durch Erstellung von Exposés und adäquate Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung von speziellen Forschungsregistern und Handbüchern;
- durch Vergabe von finanziellen Veröffentlichungshilfen und Serviceleistungen für MultiplikatorInnen, Weiterbildungseinrichtungen etc.
Für diese Tätigkeiten fehlen der DSF bisher die Ressourcen, und offen ist, ob die Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn, mit der die Stiftung begonnen hat zu kooperieren, mittelfristig institutionell gesichert ist.
Kritisch sehe ich weiter, dass sich die dem Bürokratismus immanente Tendenz sich stetig auszuweiten, leider auch die Stiftung zunehmend erfasst. Dies betrifft den sehr misslichen zeitlichen Abstand zwischen Antragstellung und Bewilligung, aber auch die zunehmende Focussierung auf konventionelle Arbeitsformen in der Wissenschaft. Dass innovative Projekte, die sich inhaltlich, methodisch oder strukturell auf neuem Boden oder nicht im Mainstream bewegen, geringere Chancen zur Förderung haben, halte ich nicht für gut. Die Stiftung könnte sich hier auf einen dezidiert anderen Arbeitsauftrag berufen als etwa die DFG:
Ich habe übrigens auch vor dem Stiftungsrat betont, dass ich die Geschäftsführung der Stiftung in Osnabrück ausdrücklich hierfür nicht verantwortlich mache, da sie sich sehr bemüht, die Verwaltungsdimensionen zugunsten des inhaltlichen Auftrags der Stiftung einzudämmen. Es handelt sich um grundsätzlichere Fragen, mit denen sich schon die Entscheidungsträger auseinandersetzen müssten.
W&F: Wenn ich Deine anfangs skizzierten Punkte richtig verstanden habe, siehst Du zusätzlich auch ein Problem in der Bodenhaftung der Stiftung, also in der Frage, wen oder auch was will die Stiftung mit der von ihr geförderten Forschung erreichen?
C. L.: Ja! Vor allem kritisiere ich, dass die Zivilgesellschaft als Bezugspunkt der Friedensforschung und Friedensarbeit völlig unterschätzt wird. Ihre Einbindung in die Entscheidungsgremien der Stiftung wurde zu keiner Zeit diskutiert, vermutlich gibt es hierüber auch seitens der beteiligten Wissenschaftler/-innen keinen Konsens. Ist es nicht paradox, wenn wir einerseits in der Forschung im Kontext postkonfliktualer Gesellschaften den Focus so stark auf die Rolle und die Handlungskompetenz der zivilgesellschaftlichen Akteure legen und andererseits im eigenen Land Politikberatung und -gestaltung fast ausschließlich in Richtung auf staatliche und parlamentarische Funktionsträger hin definieren? Friedens-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen sind oft unbequem, sie haben ebenso wie die Parteien, die Gewerkschaften und die Kirchen an Basis verloren. Trotzdem sind dort Menschen engagiert, deren Arbeit und gesellschaftliche Funktion, gerade in einer sich individualisierenden, entsolidarisierenden Demokratie, geschätzt und unterstützt werden sollte.
W&F: In der Gründungsurkunde der Stiftung heißt es: „Die DSF soll das friedliche Zusammenleben der Menschen und Völker fördern. Sie soll mithelfen, Voraussetzungen und Bedingungen dafür zu schaffen, dass Krieg, Armut, Hunger und Unterdrückung verhütet, Menschenrechte gewahrt und die internationalen Beziehungen auf die Grundlage des Rechts gestellt werden.“ Ist sie dem gerecht geworden?
C. L.: Letztlich knüpft dies an die sehr schwierige Frage an, inwiefern Wissenschaft überhaupt zu einer »besseren« Welt beitragen kann. Friedenspolitik ist, wie die Umweltpolitik beispielsweise auch, eine Frage der Aufklärung, der Entwicklung von Alternativen, aber letztlich auch der politischen Entscheidungen. Hier haben wir gerade in den letzten Jahren erlebt, wie schwierig es ist, in diesem Land friedenspolitische Notwendigkeiten gegenüber anderen Interessen geltend zu machen.
W&F: Du hast nun ein sehr breites Aufgabenfeld der Stiftung gezeichnet. Kann sie das überhaupt leisten?
C. L.: Man muss noch mal darauf hinweisen, dass zum Ende der Regierung Kohl die Förderung der Friedensforschung fast auf Null zurückgefahren war. Da waren die Gründung und Finanzierung der Stiftung wichtige Schritte nach vorne, und die DSF hat sicherlich Bedeutsames und vor allem Nachhaltiges geleistet. Andererseits war die Bundesförderung der Friedensforschung zehn Jahre vor Rot-Grün, also Anfang der neunziger Jahre, noch wesentlicher höher, als was die Stiftung heute jährlich verausgaben kann. Selbst der Bundesrechnungshof hat in seinem Prüfbericht festgestellt, dass eine Erhöhung des Stiftungskapitals vonnöten ist, um die Stiftung wirklich ihren Aufgaben entsprechend dauerhaft zu erhalten. Trotz dieser Faktenlage war der politische Wille in der Koalition zugunsten einer nennenswerten Erhöhung des Stiftungskapitals – etwa um 15-20 Mio. Euro – nicht herzustellen, ganz im Gegensatz zu milliardenschweren Entscheidungen im Rüstungssektor. Ich hoffe, dass auch nach den anstehenden Bundestags-Neuwahlen die bisherigen Leistungen der Stiftung seitens der in den Stiftungsgremien mit entscheidenden Regierungsvertretern/innen anerkannt bleiben und vielleicht mit einer stärker insistierenden Opposition die Notwendigkeit einer Wissenschaft für den Frieden mindestens ebenso respektiert aufblüht.
W&F: Vielen Dank!
Geförderte Großprojekte der DSF:
Laufende Forschungsprojekte:
- Neue Formen der Gewalt im internationalen System: Möglichkeiten und Grenzen der Prävention. Projektleitung (PL): Prof. Dr. Wolf-Dieter Eberwein, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
- Präventive Rüstungskontrolle: Analyse von Potentialen für Rüstungskontrolle und Verifikation biologischer Waffen unter besonderer Berücksichtigung neuer Entwicklungen in der Biotechnologie. PL: Prof. Dr. Kathryn Nixdorf, TU Darmstadt, Institut für Mikrobiologie und Genetik
- Kernwaffenrelevante Materialien und Rüstungskontrolle. PL: Dr. Wolfgang Liebert, TU Darmstadt, Internationale Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS)
- Between past and future. An assessment for the transition from conflict to peace in post-genocide Rwanda. PL: Prof. Dr. Lothar Brock, HSFK
- Demobilisierung und Remobilisierung in Äthiopien ab 1991. PL: Prof. Dr. Helmut Bley, Universität Hannover, Historisches Seminar
- Rüstungskontroll-Expertengemeinde und Diskursgestaltung. PL: Prof. Dr. Harald Müller / Dr. Bernd W. Kubbig, HSFK
- Informationsanforderungen bei der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts nach der Charta der Vereinten Nationen. PL: Prof. Dr. Joachim Wolf, Institut für Friedenssicherung und Humanitäres Völkerrecht, Ruhr-Universität Bochum
- Die OSZE und der Aufbau multiethnischer Polizeien auf dem Balkan. Analyse eines bedeutenden Beitrags zum internationalen Post-Conflict Peacebuilding. PL: Dr. Wolfgang Zellner, Centre for OSCE Research (CORE), Hamburg
- Die Rolle externer wirtschaftlicher Akteure in Bürgerkriegsökonomien und ihre Bedeutung für Kriegsbeendigungsstrategien in Afrika südlich der Sahara. PL: Dr. Michael Brzoska, Bonn International Conversion Centre (BICC)
- Geschichte der Kriegsberichterstattung in 20. Jahrhundert: Strukturen und Erfahrungszusammenhänge aus der akteurszentrierten Perspektive. PL: Prof. Dr. Ute Daniel, Historisches Seminar TU Braunschweig
- Der Beitrag des Zivilen Friedensdienstes zur zivilen Konfliktbearbeitung in Bosnien-Herzegowina und Kosovo. PL: Dr. Ulrich Ratsch, Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST)
- Der Anschlag von New York und der Krieg gegen Afghanistan in den Medien – Eine Analyse der geopolitischen Diskurse. PL: Prof. Dr. Paul Reuber und Dr. Günter Wolkersdorfer, Institut für Geographie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- Die De-/Konstruktion von Krieg in der internationalen meinungsführenden Presse: Der »Fall« Irak (2003). PL: Prof. Dr. Una Dirks, Universität Hildesheim, und Prof. Dr. Rüdiger Zimmermann, Universität Marburg
- Neue nicht-tödliche Waffen – Physikalische Analysen für vorbeugende Begrenzungen. PL: Prof. Dr. Dieter Suter, Universität Dortmund
- Post-Conflict: Rebuilding of States – Völkerrechtliche Aspekte der Wiederherstellung von Staatlichkeit. PL: Prof. Dr. Volker Epping, Universität Hannover, und Dr. Hans-Joachim Heintze, Universität Bochum
- Die Wirkungsweise gewaltfreier Praxis: Zentrale Konfliktaustragungskonzepte im interkulturellen Vergleich. PL: Prof. Dr. Heinz-Günther Stobbe, Universität Siegen
- Waffenkontrolle durch Wissenschaftskontrolle? Zur Rolle der Naturwissenschaftler(inne)n in staatlichen Biowaffen-Programmen. PL: Dr. Jan van Aken, Universität Hamburg
- Staatszerfall als friedens- und entwicklungspolitische Herausforderung: Was können multidimensionale Governance-Ansätze leisten? Eine konzeptionelle Untersuchung mit empirisch-analytischer Anwendung auf Somalia und Afghanistan. PL: Dr. Tobias Debiel, INEF, und Dr. Conrad Schetter, ZEF, Universität Bonn
- Die internationale Organisation des Demokratischen Friedens. PL: Prof. Dr. Andreas Hasenclever, Universität Tübingen, und Dr. Matthias Dembinski, HSFK
- Ethnopolitische Konflikte im nördlichen Schwarzmeergebiet: Gedächtnis, Gewalt und Geschichtspolitik im postsowjetischen Raum. PL: Prof. Dr. Stefan Troebst, GWZO Universität Leipzig