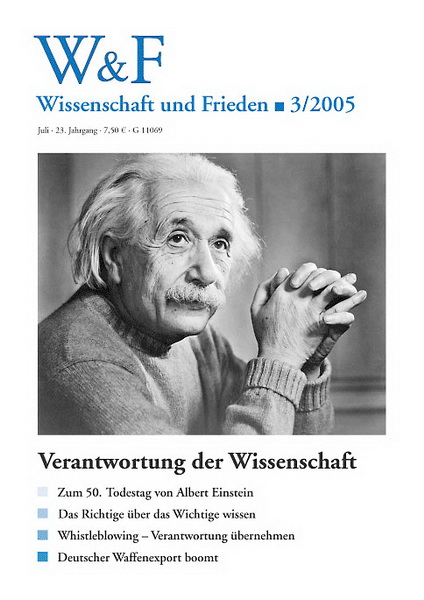Verantwortung als Quelle einer friedfertigen Weltgesellschaft
von Alfred Hirsch
Der Verantwortungsbegriff hat Konjunktur. Von Eigenverantwortung über Unternehmensverantwortung bis hin zur globalen Verantwortung lassen sich zahlreiche und äußerst ungleiche Bereiche und Felder aufzählen für die Verantwortung reklamiert wird. Die Inflation der Begriffsverwendung steht hier – wie so oft in anderen Zusammenhängen – in umgekehrter Proportion zur Schärfe und Klarheit des Begriffs. Was heißt und ist Verantwortung? Woher stammt der Begriff? Und in welcher Beziehung steht er zum Problem und Zweck des Friedens?
Der erste und erstaunlichste Befund, der sich in einem Bemühen um die Beantwortung dieser Fragen ergibt, ist, dass es in der traditionalen Ethik und praktischen Philosophie von Aristoteles bis Kant keinen wirklichen Verantwortungsbegriff gibt. Es ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, dass dieser für die gegenwärtige Ethik des Sozialen, Politischen, Ökonomischen und Ökologischen so zentrale Begriff allem Anscheine nach erst in einer mittleren Phase der Entwicklung der Moderne und erster Rechtsstaaten sowie in einer schon späten Phase der Industrialisierung auftaucht. Die Vermutung liegt nahe, dass der Verantwortungsdiskurs zu einem Zeitpunkt einsetzt, an dem einerseits eine starke Abstraktion und dingliche Vermittlung sozialer Beziehungen sich entfaltet und andererseits zugleich ein Prozess der Verrechtlichung soziale und politische Interaktionen umfassender zu regeln beginnt. Für diese Annahme spricht auch, dass die noch immer vorherrschende und paradigmenbildende Fassung des Verantwortungsbegriffs von einer nahezu rein juristischen Konstruktion ausgeht. Er erfasst die Beziehung zwischen einem handelnden Subjekt und einem Objekt der Bewertung. Einem Subjekt werden die Folgen seines Handelns zugerechnet oder zugeschrieben. Dabei ist die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt selbst keineswegs wesensmäßig oder natürlich festgelegt, sondern wird diskursiv gestiftet und dabei zweifelsfrei der Veränderung von menschlichen Praktiken angepasst. Eine scharfe Trennung von Mensch und Natur ist im Verantwortungsbegriff damit implizit vorausgesetzt. Inwieweit Subjekt und Objekt selbst von solch diskursiver Stiftung erfasst sind, bleibt noch zu erörtern. Denn dem topos der Zurechnung wird im moralischen wie rechtlichen Sinne unmittelbar die Idee eines autonomen und frei entscheidenden sowie handelnden Subjekts zugeordnet.
Was ist Verantwortung?
Bemerkenswert ist, dass der Begriff der Verantwortung, der sich auch etymologisch und semantisch auf einen dialogischen Vorgang, d.h. der Wechselbeziehung von Frage und Antwort, der »response« einer Adressierung, bezieht, in einer historischen Phase aufkommt, in der die interpersonalen und interlokutionären Beziehungen mehr und mehr zugunsten industrieller und politischer Großinstitutionen und komplexer sozialer Prozesse in den Hintergrund treten. Zunehmende Arbeitsteilung und fortschreitende Technisierung schaffen ein weit verzweigtes Netz von Verweisungen, in dem an einer bestimmten Wirkung zahlreiche Handlungsschritte und -kausalitäten beteiligt sind. Es „schieben sich zwischen das handelnde Individuum und die durch dieses Handeln bewirkten Effekte vermittelnde Instanzen, die eine Zurechnung der Handlungsfolge auf bestimmte Individuen erschweren oder gar unmöglich machen.“1 Der ursprünglich also eher aus sozialen Mikroprozessen und interpersonalen Beziehungen stammende Begriff wird zu einem Zeitpunkt für die Ethik relevant, an dem gerade die Zuständigkeit dieser Kontexte wegbricht. Oder anders formuliert: in dem Augenblick, in dem die Kausalität und Linearität der Folgen einer Handlung sich kompliziert oder sich gar ganz verwischt, tritt ein Begriff auf die Szene, der scheinbar diese Kausalität und Linearität beschwört. Wenn wir es also mit gesellschaftlichen, kollektiven oder Systemverantwortlichkeiten zu tun haben, scheint der Begriff der Verantwortung, gedacht und verwendet im Sinne der Zuschreibung einer Wirkung an ein handelndes Subjekt, nur noch eingeschränkt zu greifen. Und doch haben sich gerade auf juristischer und politischer Ebene eine Reihe von Komplementierungen dieser ursprünglichen Verantwortungskonzeption durchgesetzt, die im Kern gleichwohl an dieser selbst festhalten. Gerade die technische Industrialisierung hat eine Reihe unterschiedlichster Unglücke mit zum Teil erheblichen Schäden und Zerstörungen hervorgebracht. Juristisch bleibt die Frage nach der Verantwortung als Zuschreibung entscheidend, da hier personale Haftung ein systemkonstituierendes Gewicht hat. Wenn niemand für einen Schaden, der beispielsweise an einem Gebäude auftritt und einen Einsturz zur Folge hat, der viele Menschen verletzt, haftbar gemacht werden kann, kann auch niemand sein Recht auf Entschädigung für die erlittenen Verletzungen und Verluste geltend machen. Elementare Rechte werden folglich in dem Augenblick negiert, in dem für eine aufgetretene Folge keine Handlungsverpflichtungen mehr freigelegt werden können. Rechte gibt es nur solange, wie Pflichten bestehen. Entsteht also die Verantwortung nicht aus einer linear rekonstruierbaren Handlungsursache, muss – um die Korrelation von Rechten und Pflichten aufrecht zu erhalten – irgendein Subjekt per Haftungszuschreibung die Verantwortung übernehmen.
Neben dieser Bedeutung enthält schon seit dem Aufkommen des Begriffs dieser eine semantische Orientierung, die Beziehung eines Subjekts zur Erhaltung und Herstellung eines als bejahenswert und positiv eingeschätzten Zustandes zu bezeichnen. Nicht nur die Zuschreibung negativer Folgen einer Handlung, sondern auch der mit vermutlich positiven Folgen versehene Umgang mit einer Sache ist Verantwortung zu nennen. Haben wir es dort mit einer ex post factum Zuschreibung zu tun, haben wir es hier mit einer ex ante factum Sorge um … zu tun. Das Englische unterscheidet hier zwischen accountability und responsibility. Die Verantwortung, die sich um die Herstellung und Bewahrung eines positiven Zustandes sorgt, ist daher auch eher prospektiv, während die Zurechnungsverantwortung eher respektiv einsetzt. Auch ein solcher Typ von Verantwortungsdiskurs korrespondiert mit modernen Zuständen, wie etwa der Verantwortlichkeit für die Herstellung einer friedfertigen und gerechten Gesellschaft oder die Sorge um die Bewahrung des ökologischen Gleichgewichts usw. Es ist unter anderen Hans Jonas zu verdanken, ein besonderes Gewicht auf diesen Aspekt des Verantwortungsdiskurses gelegt zu haben. Jonas geht es um einen Begriff von Verantwortung, „der nicht ex-postfacto Rechnung für das Getane, sondern die Determination des Zu-Tuenden betrifft; gemäß dem ich mich also verantwortlich fühle nicht primär für mein Verhalten und seine Folgen, sondern für die Sache, die auf mein Handeln Anspruch erhebt. Verantwortung zum Beispiel für die Wohlfahrt Anderer ‘sichtet’ nicht nur gegebene Tatvorhaben auf ihre moralische Zulässigkeit hin, sondern verpflichtet zu Taten, die zu keinem anderen Zweck vorgehabt sind. Das ‘für’ des Verantwortlichseins hat hier offenbar einen völlig anderen Sinn als in der vorigen, selbstbezogenen Klasse.“2 In der Idee einer prospektiven Verantwortung, die Jonas in seinem Buch »Das Prinzip Verantwortung« entwickelt, deutet sich eine Dimension des Verantwortungsdiskurses an, in dem eine Verbindlichkeit an der Sache und an dem Zustand, der andere betrifft, ausgerichtet ist. Für jemanden und etwas verantwortlich zu sein, heißt sich ganz und gar an den Ansprüchen dieses jemanden und dieses etwas zu orientieren. Nun findet sich bei Jonas gleichwohl keinerlei Auskunft über die Herkunft und die Genese einer solchen Verantwortungsdimension. Warum ist ein Mensch überhaupt verantwortlich für andere Menschen und soziale sowie ökologische Zustände, die ihn nicht unmittelbar selbst betreffen und in großer räumlicher und manchmal auch zeitlicher Entfernung stattfinden? Warum gibt es ein Gefühl oder einen Impuls der Verantwortung, der ganz ohne institutionelle Verpflichtungen auskommt und diesen sogar vorausgeht? Lässt sich eine Verantwortung, die für etwas oder jemanden verantwortlich ist, überhaupt begrenzen, so als könne man nach getaner Hilfeleistung feststellen, nun müssten die Bedürftigen für ihr Schicksal alleine aufkommen, da man seine Verantwortung abgeleistet habe?
Offensichtlich verhält es sich anders und es wird deutlich, dass es für eine Verantwortung, die für andere übernommen wird, prinzipiell keine Begrenzung gibt. Kaum ein Autor hat dies so insistierend und nachdrücklich beschrieben, wie Emmanuel Levinas: „Der Mensch ist“, schreibt er, „verantwortlich für die Welt (responsable de l’univers), Geisel des Geschöpfs (otage de la créature). […] Außerordentliche Würde (Dignité extraordinaire). Unbegrenzte Verantwortung (Responsabilité illimitée) … Der Mensch gehört nicht zu einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern eine begrenzte Verantwortung (responsabilité limitée) überträgt. Er ist Mitglied einer Gesellschaft mit unbeschränkter Verantwortung (responsabilité illimitée).“3 Und dabei handelt es sich um eine Verantwortung für etwas, das ich nicht getan habe, für Zustände, die ich nicht herbeigeführt habe und für die Zukunft einer Welt, deren Entwicklung ich in keiner Weise voraussehen kann. Auch gibt es keine Beschränkung bei den Menschen für die ich verantwortlich bin. Es ist nicht möglich, mich für diese oder jene zuständig zu befinden und für andere nicht. Die Verantwortung kommt ohne mein Wollen und ohne meine Intention auf mich zu und nötigt mich, das Leid der anderen auf mich zu nehmen und dies gilt ganz ohne Zweifel auch für das Leid, das ihnen nicht durch mich angetan wurde. Die Zuschreibung von Schäden, die durch mein Handeln verursacht wurden, ist im Vergleich zu dieser unbeschränkten moralischen Verantwortung, von der Levinas spricht, nahezu en passent zu tragen und zu erfüllen. Auch bedarf es keiner Intention oder eines freien autonomen Entschlusses zu einer bestimmten Handlung, um verantwortlich zu sein. Vielmehr bestätigt sich diese Art der Verantwortlichkeit, wenn Menschen sich für das Leid anderer irgendwo auf der Welt weit entfernt verantwortlich fühlen und wissen, obschon sie in keiner Weise als handelnde und planende Subjekte in dieses Leid verstrickt sind. Die Verantwortung für Frieden in unserer Weltregion und in solchen, die weit entfernt sind, ergibt sich aus diesem Zusammenhang. Wie aber sieht der Frieden aus, für den wir verantwortlich sind, ohne diese Verantwortung ausdrücklich und bewusst übernommen zu haben?
Frieden zwischen vielen Singularitäten
Setzt man einen himmlischen Frieden, als schlechthin gewaltlosen und erlösten Zustand der Menschheit als Maß eines vollkommen Friedenszustandes voraus, dann ist jeder in der irdischen Wirklichkeit sich einstellende Frieden gemessen an diesem Anspruch der friedsamen Vollkommenheit ein nur bescheidener Anfang. Jeder irdische Frieden müsste – gemessen an dem himmlischen Frieden – als ein Unfrieden dargestellt werden. Gemessen an der rein negativen Bestimmung des Friedens als Abwesenheit von Krieg, wird umgekehrt jeder Zustand, der von keiner offenen Gewaltauseinandersetzung gekennzeichnet ist, zum Frieden erklärt. Weder in der absoluten Versöhnung noch in dem bloßen Absenz von kriegerischer Gewalt kann mithin eine inhaltlich positive Bestimmung des Friedens gewonnen werden. In der Abweisung dieser Extreme gesellt sich zudem die ebenfalls zeitgebundene Erkenntnis, dass Frieden nicht ein für allemal endgültig gewonnen werden kann, sondern immer wieder und von neuem angestrebt und realisiert werden muss. Frieden, der sich als politischer und – wie noch hervorgehoben werden wird – als interpersonaler sowie sozialer Prozess vollzieht, hat von Beginn in pluralen und singulären Konstellationen und deren Bezügen zu nisten. Erst im Ausgang einer Beziehung der vielen Ungleichen, die trotz Andersheit, Differenz und Heterogenität zu einem wirklichen Verhältnis miteinander finden, lässt sich von einem spätmodernen Friedenskonzept sprechen.
Frieden ist also mehr als bloße gewaltfreie Verhältnislosigkeit, vielmehr eröffnet sich gerade über die Qualität des Verhältnisses eine inhaltliche materielle Bestimmung von Frieden: „Frieden ist“ wie Max Müller schon vor dreieinhalb Dekaden schrieb „keine bloße Koexistenz, nicht nur die Toleranz des Sein-Lassens und Raum-Gebens, sondern vielmehr ein ‘Zusammen’, das ein Zusammenwirken um eines Gemeinsamen willen voraussetzt, weil sonst die Zufälligkeit des Nebeneinanders doch in einem jeden Moment einen Zusammenstoß entfachen kann. In diesem ,Gemeinsamen‘ als einem gemeinsamen, verbindenden ‘Umwillen’, welches dem Frieden Grund, Boden und Richtung gibt, liegt das ‘normative Element’.“4 Dieses Zusammen und dieses Gemeinsame, sollen sie nicht als bloße communio oder religiös als Gemeinde verstanden werden, bedürfen einer genaueren Bestimmung und Beschreibung. Denn an welche Art Integration als Zusammen von Eigen- und Fremdkollektiv und Selbst und Anderem ist hier zunächst zu denken?
Eine erste Anknüpfung bietet das noch vorneuzeitliche, mittelalterliche Denken in den Überlegung zu einer Friedensontologie des Augustinus. Nach Augustinus ist der Frieden die Voraussetzung und nicht Gegenstand der Lebensführung, d.h. jedes menschliche Leben setzt bereits ein gewisses Maß an geordnetem Zusammen und an Integration voraus, um überhaupt existieren zu können. Frieden im Sinne Augustinus ist folglich primär und er radikalisiert diesen Gedanken, wenn er schreibt: „Was ist, ist befriedet, sonst wäre es nicht.“ Mag sein, dass diese Einsicht in solcher Allgemeinheit formuliert – und es wäre sicherlich noch einiges zur Differenzierung im Augustinischen Sinne hinzuzufügen – eine Schräglage bekommt. Aber als entscheidend soll an ihr markiert werden, dass entgegen den in der Nach-Hobbessianischen-Zeit eingeübten sozialen und politischen Konstitutionsbedingungen des ursprünglichen Krieges, menschliche Formen der Kooperation immer schon Achtungsverhältnisse voraussetzen, die ein hohes Maß an Befriedung aufweisen.
Auch hat es den Anschein, als schwinge in der Friedensontologie Augustinus’ nicht mehr oder noch nicht jener Zwang zur Einheit und Ganzheit mit, der in der Neuzeit als wesentliches Charakteristikum des Friedens gedacht wird. Die Einheit aller Teile einer sie umfassenden Ordnung ist zu gewähren durch die Entdeckung bereits latent vorhandener Gemeinsamkeiten, wie das allen menschlichen Individuen gemeinsame Überlebensinteresse oder die allen Subjekten gemeinsame universelle Vernunft. Ein solcher, aus der Zusammenfügung und Identifizierung aller Einzelner erzeugbarer Einheitsfriede hat seinen epistemologischen Höhepunkt in der neuzeitlichen Dialektik einer Verschmelzung von anderem und selben. Nichts kann einer solchen Synthese der Gegensätze noch entkommen und gerade hieran wird die entscheidende methodische Vorkehrung für eine praktische Befriedung humaner und politischer Beziehungen festgemacht. Hingegen werden Anderes und Fremdes, die nicht – zumindest in wesentlichen Teilen – der Einheit der Ordnung eingefügt werden können, als Störung und Hindernis des ordinalen Friedens betrachtet. Frieden wird als Angleichung und Absorption des Anderen nicht wirklich als Beziehung zwischen zwei absolut voneinander getrennten Singularität entworfen. Vielmehr wird, ob interpersonal, sozial, kulturell und politisch, immer schon so getan, als gebe es auf tieferer oder höherer Ebene eine unhinterfragbare Identität und Einheit, deren Friedsamkeit dann in Frage gestellt ist, wenn eine unintegrierbare Andersheit auftaucht. Besonders deutlich wird diese stets im neuzeitlichen Denken des Friedens vorausgesetzte Einheitlichkeit der Seienden in der Beschreibung und Darstellung kultureller und ethnischer Begegnungen und Beziehungen. Der »Clash of Cultures« Huntingtons spricht laut von der gewissermaßen notwendigen Friedlosigkeit miteinander in Kontakt tretender Kulturen.
Eine wirkliche Wende in dieser Tradition des Friedensdenkens ließe sich erst erreichen, wenn Frieden als Beziehung mit einem Anderen beschrieben wird, der sich unvorhersehbar und unendlich meinem Vermögen entzieht. Oder mit den Worten Levinas: „Frieden als Beziehung mit dem Anderen in seiner logisch ununterscheidbaren Andersheit, in seiner Andersheit, die nicht auf die logische Identität einer letzten Differenz reduzierbar ist, die einer Gattung hinzugefügt wäre. Frieden als stetiges Wachwerden für diese Andersheit und für diese Einzigkeit.“5 Nicht also die vorschnelle Vereinheitlichung und Rahmengebung des Selben und des Anderen weist ein friedensnahes Procedere auf, sondern umgekehrt die Sensibilität für die Andersheit des Anderen stiftet die Voraussetzung einer friedsamen Beziehung zu ihm. Vor dem Hintergrund der erwähnten Tradition wird deutlich, welch großer Mut auch in den praktischen Vollzügen politischer und sozialer Beziehungen dazu gehört, Gemeinsamkeiten auf der Basis nichtreduzierbarer Unterschiede und nie aufhebbarer Singularitäten erreichen zu wollen. Frieden als Zusammen und Gemeinsames – sei es in interpersonalen oder politischen Beziehungen – gilt es solchermaßen als Integration und Solidarität von Ungleichartigen zu entwerfen. Und aus der Perspektive des Selbst kann eine solche Bewegung der Befriedung nur vom Anderen aus anheben, sein Frieden hat Priorität vor dem meinen. Denn auch den politischen und sozialen Konventionen gemäß bleibt eine Ahnung von einem gestörten Frieden, wenn es in unserem Teil der Welt weitgehend befriedete sozialen und politische Verhältnisse gibt, in anderen Regionen der Welt aber nicht. Wir können nicht von einem echten Frieden sprechen, wenn an anderer Stelle und anderem Ort der Welt Menschen zur selben Zeit ihr Leben, ihre Familie, ihre Freunde oder ihr Hab und Gut verlieren.
Auch drängt sich mit Blick auf die Konstitution eines Gemeinsamen in der Beziehung zum ganz Anderen eine weitere Revision des modernen Friedensbegriffes auf. Denn wenn Frieden vorrangig als Beziehung zum Anderen und Fremden gedacht wird, dann gilt es einen rein zwischenstaatlichen, und das heißt politisch und rechtlich entworfenen Friedensbegriff wieder ein Stück weit in den sozialen und den interpersonalen Raum zurückzuholen. Ein Zusammen und Gemeinsames, das sich auf ein Verhältnis zwischen den Menschen in Staaten, Kollektiven, Kulturen und Ethnien gründet, geht bereits zurück auf das Geschehen interpersonaler Beziehungen und sozialer Begegnungen. Diese vollziehen sich nicht als den jeweils anderen anerkennende Integration »freier Willen«, sondern als den einzelnen und seinen Weltzugang erst konstituierendes Ereignis.
Um erneut mit Levinas zu sprechen, handelt es sich um das Ereignis der Nähe, das nicht mehr abgestreift werden kann, nachdem es einmal geschehen ist. Und in genau dieser Nähe zwischen selbst und anderem vollzieht sich auch die jeder Willensentscheidung vorausgehende Übernahme einer Verantwortung, die ich weder zurückgeben, noch ihr vollständig gerecht werden kann. Aber diese überbordende Verantwortung, der ich nie und an keinem Ort gerecht werden kann, fordert zu einer Überführung und Transformation mikrosozialer Kooperationsformen qua sozialer Beziehungen in komplexere Formen und Ordnungen der Kooperation heraus. Vor dem Hintergrund der Überlegung, dass Frieden als konstitutive Bedingung einer gemeinsamen menschlichen Ordnung zu beschreiben ist, die als ursprüngliche Verantwortungsbeziehung anhebt, ergibt sich auch ein inhaltlich differenzierter Friedensbegriff. Denn aus der ursprünglichen Verantwortung und der Nähe ergibt sich die Notwendigkeit und das Verlangen nach sozialer und politischer Integration und Kooperation, die zentrale Elemente und Charakteristika wie Gerechtigkeit, Freiheit, die Chance auf soziale und wirtschaftliche Entwicklung ebenso beinhaltet wie den gewaltfreien Austrag von Konflikten.
Verantwortung entsteht in Gesellschaftswelten
Es drängt sich angesichts der aktuellen Situation der Globalisierung die Beschreibung einer Gewaltsamkeit auf, die Johann Galtung mit dem Begriff der strukturellen Gewalt eingeführt hat – wenngleich ich den Begriff hier in einem etwas anderen Sinne als Galtung verwenden möchte. Die spezifischen Formen der Gewaltsamkeit der globalen strukturellen Gewalt betreffen zunehmend nicht mehr nur die Menschen in den »armen Staaten«, sondern sind längst auch in den »reichen Staaten« des Westen und Nordens mit ihren Immigranten, Arbeits- und Obdachlosen angekommen. Je eindringlicher diese Entwicklung desto luzider ist aber auch, dass neben den weltweit neu entstandenen Formen von inter- und transnationaler Öffentlichkeit zugleich inter- und transnationale Zivilgesellschaften im Entstehen begriffen sind, die sich teilweise aus Reflexion der Gemeinsamkeit eines Opferstatus und teilweise aus den Wohlstandsressourcen zunehmender interpersonaler und sozialer Kontakte einer sich formierenden globalen Gesellschaftswelt jenseits des Staates und der Staaten entwickelt. Als Gesellschaftswelten möchte ich bezeichnen, was sich als Ereignis des Sozialen, als unkontrollierbares Geschehen der Begegnung von Selbst und Anderen, Eigenem und Fremden und doch als friedenskonstituierender Prozess vollzieht. Die interpersonalen Beziehungen haben einen wesentlichen Einfluss auf Werden und Vergehen der Gesellschaftswelten, aber sie sind nicht alleiniger Antrieb oder alleiniges Hindernis. Bestimmte Formen von Dialog und Diskurs, mediale Öffentlichkeit, Geschwindigkeit der Ortswechsel und Kommunikation sowie ein zunehmender »appeal« anderer und fremder Kulturen eröffnen und konstituieren die Prozesse der globalen Gesellschaftswelten. Dass sich aus diesen Gesellschaftswelten, die ich als nicht steuerbare Prozesse und unvorhersehbare Ereignisse beschreibe, mit zunehmender Intensivierung eine – von diesen zu unterscheidende – Weltgesellschaft entwickelt, lässt sich anhand einer Reihe empirischer Daten erfassen. Der Begriff der Weltgesellschaft wird schon seit Jahrzehnten gebraucht und doch hat sich sein Gehalt in entscheidender Weise verschoben und modifiziert. War die Weltgesellschaft in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine die Beziehungen souveräner Staaten, also die Weltpolitik, bloß ergänzende Sphäre, gewinnt sie mit den achtziger und neunziger Jahren, d.h. den Jahren einer forcierten Globalisierung an Gewicht und Eigenständigkeit. Die schon beschriebene vielschichtige Erosion der Nationalstaaten, aber auch die aus politischen Entscheidungen hervorgehenden transnationalen Organisation bis hin zur UNO haben zur anfänglichen Etablierung einer Weltgesellschaft geführt. Den diese realisierenden sozialen Prozess, der sich genuin als Geschehen von Ansprüchen und Verantwortungsverhältnissen jenseits und vor den politischen Ordnungen entfaltet, vollzieht sich in den Gesellschaftswelten. Diese sind keine Orte berechenbarer Symmetrien und institutionalisierter Rechtszusammenhänge. Vielmehr gehen sie diesen voraus als Werden von Normen, die sich in einem interpersonalen, sozialen und diskursiven Verantwortungsprozess auch in einem globalen Kontext ergeben. Verantwortung auf dieser Ebene ist nicht delegierbar oder übertragbar, sie entfaltet sich prospektiv und sprengt die räumliche wie zeitliche Einengung und Beschränkung. Diese Verantwortung lastet dem Einzelnen mehr auf, als er tragen kann und verlangt von ihm mehr, als er geben kann.
Zugleich ist sie aber auch der Vollzug eines sozialen und interpersonalen Friedens, der nach Gerechtigkeit und ihrer Instituierung im Politischen verlangt. Dort angelangt schmilzt die Verantwortung des einzelnen auf ein kalkulierbares und begrenzbares Maß zusammen. Die Verantwortung wird zurechenbar auf den einzelnen bezogen und von diesem eingefordert. Aber mit dem Augenblick ihrer Instituierung im Recht und im Politischen erlöschen die Ereignisse der Gesellschaftswelten und hinterlassen Spuren in einer Weltgesellschaft, die heute mehr und mehr zum Widerpart des Politischen und des Ökonomischen wird. Mit dem Einzug der gesellschaftsweltlichen Geschehen in die Weltgesellschaft wird auch der Frieden zu einem ihrer konstitutiven Bestandteile. Denn Frieden ist nach der anfänglichen Etablierung einer Weltgesellschaft nicht mehr vorrangig der Name für eine Beziehung zwischen den Staaten, sondern er benennt die gesamten Verhältnisse im Innern einer globalen Gesellschaft. Oder mit den Worten Georg Pichts: „Die These von der Unteilbarkeit des Friedens besagt also sehr viel mehr als nur die Feststellung, dass es unter den heutigen technischen und ökonomischen Bedingungen immer schwieriger wird, bewaffnete Konflikte zu begrenzen. Sie besagt darüber hinaus, dass sich ein Zustand, den man Frieden nennen könnte, nur noch als innere Ordnung einer Weltgesellschaft verstehen und angemessen beschreiben lässt.“6 Anders als zwischen den souveränen Staaten entfaltet sich diskontinuierlich aber zugleich dauerhaft in der Weltgesellschaft im Ausgang gesellschaftsweltlicher Prozesse eine Friedensverantwortung, die sowohl Menschen wie Gruppen, Organisation und Institutionen betrifft. Auf der Ebene des Völkerrechts sprechen wir eher von einer Friedenspflicht, die auf der Grundlage einer rechtlich bindenden Vereinbarung das Verhältnis der unterzeichnenden Staaten regelt. Auch hier ist es erst im Verlaufe eines langen Prozesses zum zwingenden zwischenstaatlichen Gewaltverbot gekommen: „Vom Recht der souveränen Staaten zum Krieg ist nichts mehr übriggeblieben. Die Staaten haben nicht mehr die Möglichkeit, Krieg oder Frieden zu wählen, sondern sind kraft allgemeinen Völkerrechts verpflichtet, den Frieden zu erhalten“… heute ist „auf der Grundlage der allgemeinen Friedenspflicht der Friede das oberste Ziel, dem selbstverständlich die Mittel angepasst werden müssen.“7 Diese Beschreibung der Normentwicklung im Völkerrecht Otto Kimminichs scheint plausibel und steht doch zugleich in einem auffälligen Missverhältnis zu den Entwicklungen seit den frühen neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, seit dem sogenannten 2. Golfkrieg. Das Recht auf Krieg, das sich einige Staaten nehmen und die USA sogar als Recht auf Präventivkrieg fordern, lässt die aus dem Völkerrecht hervorstrahlende Friedenspflicht der Staaten verblassen. Und doch bleiben – auch diese Entwicklung ist beobachtbar – aufmerksam agierende globale Gesellschaftswelten in den Ordnungen des Politischen virulent und fordern diese heraus. Entfacht und gestärkt wird dieser Stachel der Irritation durch ein längst nicht mehr in die Grenzen der einzelnen Staaten zurückzudrängendes soziales Ereignis, das neben einer weltweiten Forderung nach Frieden zugleich die nicht delegierbare Verantwortung für ihn unablässig neu hervorbringt.
Anmerkungen
1) Kurtz Bayertz: Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung, in: ders. (Hg.): Verantwortung. Prinzip oder Problem?, Darmstadt 1995, S. 25.
2) Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt/M.1979, S. 174.
3) Emmanuel Levinas: Du sacré au saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques, Paris 1977, S. 139. – Dt.: Vom Sakralen zum Heiligen. Fünf neue Talmud-Lesungen, übers. von F. Miething, Frankfurt/M. 1996, S. 137.
4) Max Müller: Der Friede als philosophisches Problem, in: Dieter Senghaas (Hg.), Den Frieden denken, Frankfurt/M. 1995, S. 31.
5) Emmanuel Levinas: Frieden und Nähe, übers. von Pascal Delhom, S. 6 (Ms der Übersetzung)
6) Georg Picht: Was heißt Frieden?, in: Dieter Senghaas: Den Frieden denken, a.a.O., S. 184.
7) Otto Kimminich: Das Völkerrecht und die friedliche Streitschlichtung, in: Dieter Senghaas: Den Frieden denken, a.a.O., S. 152.
Dr. Alfred Hirsch, Privatdozent (Philosophie) an der Universität Hildesheim und Leiter der Forschungsgruppe »Kulturen der Verantwortung – Zu den kulturellen Voraussetzungen komplexer Verantwortungsgesellschaften» des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen