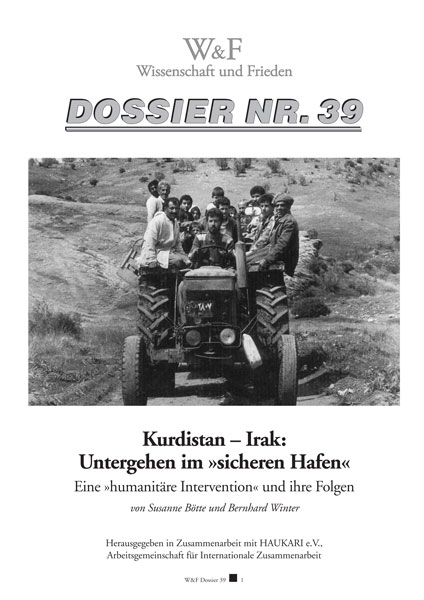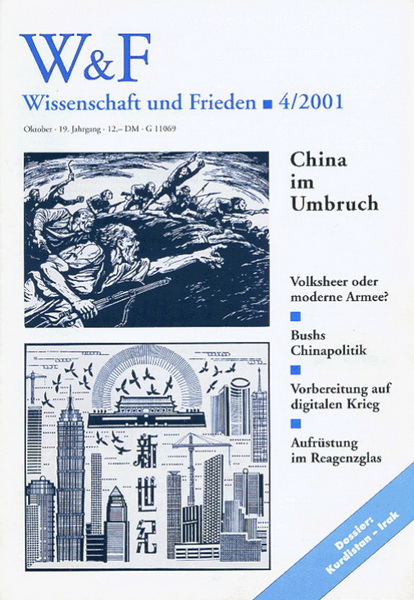Eine »humanitäre Intervention« und ihre Folgen
Kurdistan – Irak: Untergehen im »sicheren Hafen«
von Susanne Bötte und Bernhard Winter
Nach dem gescheiterten kurdischen Aufstand in Folge des zweiten Golfkriegs1 erschütterten im Frühjahr 1991 die Bilder Hunderttausender aus dem Irak in die schneebedeckten Berge des Taurusgebirges im türkisch-irakischen Grenzgebiet geflohener Kurdinnen und Kurden die Weltöffentlichkeit. Dies blieb nicht ohne Wirkung. Eine erneute militärische – als humanitär deklarierte – Intervention unter der Bezeichnung »Provide Comfort« und groß angelegte internationale Hilfsaktionen waren die Folge. Inzwischen ist Irakisch-Kurdistan wieder zum Nichtthema geworden. In unserer medialen Welt wurde es zu einem weißen Flecken. Allenfalls finden sich sporadisch in den Zeitungen noch Kurzmeldungen über Kämpfe zwischen rivalisierenden kurdischen Parteien. Das Fernsehen zeigt gelegentlich eine Sequenz mit kurdischen Flüchtlingen auf einem schrottreifen Frachter im Mittelmeer. Damit ist die Berichterstattung zu diesem Thema beendet. Ähnlich verhält es sich mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Irak. Hier vermag allenfalls die Auseinandersetzung um die Aufhebung der UN-Sanktionen kurzzeitig den Schleier der Interesselosigkeit zu lüften.
Im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung um humanitäre Interventionen2 stand bisher das Spannungsfeld zwischen moralischer Integrität einerseits und völkerrechtlicher Legitimität andererseits. In der völkerrechtlichen Diskussion berufen sich die Gegner humanitärer Interventionen darauf, dass dieses Instrument in der UN-Charta, die der territorialen Integrität und Souveränität von Staaten einen hohen Stellenwert beimisst, nicht explizit genannt werde. Befürworter argumentieren, dass der Charakter der UN-Charta sie durchaus impliziere. Selbst wenn man unterstellt, das Völkerrecht biete keine Handhabe für humanitäre Interventionen, ist damit die Frage der Legitimität noch nicht beantwortet. Unser Interesse gilt daher insbesondere den Ergebnissen der Intervention, um auch eine politisch-moralische Beurteilung zu ermöglichen.
Mit der Operation »Provide Comfort« setzten die Alliierten der Flüchtlingstragödie im irakisch-türkischen Grenzgebiet ein Ende. Von beteiligten Militärs wurde sie als »Blaupause« für künftige humanitäre Operationen verstanden. Sie war denn auch das erste Glied einer Kette von Interventionen in den neunziger Jahren, in der die Militärs die »humanitäre Arena« betraten. Während zu Zeiten des Kalten Krieges Notsituationen in der Regel als politisch/militärisch oder humanitär von den politischen Akteuren, beispielsweise im Weltsicherheitsrat, definiert und gegeneinander abgegrenzt worden waren, greift diese Einteilung jetzt nicht mehr. Es sind zunehmend komplexe Notsituationen entstanden. Einen international verbindlichen Konsens, wie diese komplexe Notlagen zu handhaben sind, gibt es nicht.
Es gilt den unmittelbaren und dauerhaften Folgen dieser Intervention nachzuspüren. „Selbst die legitimste Intervention kann humane und finanzielle Kosten verursachen und unerwünschte Ergebnisse zeitigen, die die Intervention als unverhältnismäßig, ineffektiv und kontraproduktiv erscheinen lassen.“3 Diese hier aufgeworfenen Fragen sollen am Beispiel Kurdistan-Irak diskutiert werden.
Weiterhin soll untersucht werden, welchen nicht humanitären Interessen mittels einer auf Intervention ausgerichteten Politik Vorschub geleistet wurde. Schließlich ist zu fragen, ob die der Intervention vorausgegangen wesentlichen Krisenursachen erfasst und angegangen wurden.
Zur Situation der kurdischen Bevölkerung im Irak
Die Niederlage des Osmanischen Reiches im ersten Weltkrieg und sein dadurch hervorgerufener Zerfall erlaubten es Frankreich und Großbritannien, Mesopotamien und Syrien unter sich aufzuteilen. Dabei bekamen die Briten neben Palästina und Transjordanien die drei osmanischen Provinzen (Vilayets) Basra, Bagdad und Mosul als Völkerbundmandat zugesprochen. Aus diesen drei ehemaligen Vilayets wurde der heutige Staat Irak gebildet. Während die Provinzen Basra und Bagdad von AraberInnen bewohnt waren, dominierte in der wegen ihres Erdölreichtums heiß begehrten Provinz Mosul die kurdische Bevölkerung. Aus Sicht der britischen Kolonialpolitik war die kurdische Bevölkerung im Norden dazu geeignet, ein Gegengewicht gegen die schiitische Bevölkerung im Süden zu bilden. Entgegen den im August 1920 im Vertrag von Sèvres gemachten Zusicherungen wurde kein kurdischer Staat geschaffen. Kurdistan wurde unter den sich jetzt bildenden Nationalstaaten aufgeteilt.
Formal wurde der Irak 1932 unabhängig, blieb allerdings ökonomisch und politisch vielfältig an Großbritannien gebunden. Im Juli 1968 kam die Arabische Sozialistische Baath-Partei durch einen Staatsstreich mit Unterstützung von Teilen der Armee an die Macht. Die Baath-Partei war 1944 in Damaskus gegründet worden und baute in den folgenden Jahren Ableger in mehreren arabischen Staaten auf. Sie vertrat eine hauptsächlich von Michel Aflaq formulierte suprastaatliche, elitär-antidemokratische Ideologie, wobei sie sich selbst als panarabische Befreiungsbewegung sah und sich zudem einer verschwommenen sozialistischen Rhetorik bediente. Die Vorstellungen vom Klassenkampf im marxistischen Sinne wurden strikt abgelehnt.
Gegenüber der Gesellschaft demonstrierte das Baath-Regime nach der Machtübernahme seinen absoluten Machtwillen durch Schauprozesse und öffentlich praktizierten Terror gegen tatsächliche und vermeintliche Oppositionelle.
Die Baath-Partei war sich der zentralen Bedeutung einer »Lösung der kurdischen Frage« bewusst. Ideologisch stand die kurdische Nationalbewegung dem arabischen Nationalismus, wie er von der Baath-Partei vertreten wurde, feindlich gegenüber. Zudem bedrohte sie einen Großteil der Erdölförderstätten und damit die ökonomische Basis des Regimes. Militärisch konnte sie von Anrainerstaaten instrumentalisiert werden, um den Irak zu bedrohen. Zudem bot sich Kurdistan-Irak als Rückzugsgebiet auch für andere oppositionelle Kräfte an. So war hier auch die Irakische Kommunistische Partei (IKP) fest verankert. Eine Autonomieregelung scheiterte 1974 an der willkürlichen Grenzziehung der autonomen Region durch das Baath-Regime. Dadurch wurden Erdölfördergebiete mit kurdischer Bevölkerungsmehrheit von der autonomen Region abgetrennt.
Daraufhin brach der bereits zuvor schwelende Bürgerkrieg zwischen den kurdischen Verbänden unter Mulla Mustafa Barzani und der irakischen Armee offen aus. Der kurdischen Bewegung wurde die feste Bindung an den Iran zum Verhängnis, als der Schah von Persien 1975 im Abkommen von Algier lange bestehende Grenzstreitigkeiten mit der irakischen Regierung beilegte und den kurdischen Aufständischen jegliche Unterstützung, insbesondere Waffenlieferungen, entzog. Innerhalb weniger Tage brach der militärische Widerstand vollständig zusammen, 100.000 Menschen flohen damals in den Iran.
Der irakisch-iranische Krieg und das Wiedererstarken des kurdischen Widerstandes führten in den achtziger Jahren zu einer Intensivierung bereits zuvor begonnener Deportationsmaßnahmen in den Grenzgebieten und in den Rückzugszonen der Guerilla. Dörfer und Städte wurden zerstört und zu verbotenen Zonen erklärt. Während der Volkszählung 1977 waren in der Provinz Sulaimaniya noch 1.877 Dörfer gezählt worden, zehn Jahre später waren es nur noch 186. Dies bedeutete de facto die Zerstörung der ländlichen kurdischen Kultur. Außerdem betrieb das irakische Regime eine systematische Vertreibung der kurdischen Bevölkerung aus den Erdölfördergebieten.
Die Geiselnahme Familienangehöriger vermeintlicher oder tatsächlicher Oppositioneller gehört im Irak des Baath-Regime zum Alltag. Diese Praxis der Repression erreichte in Irakisch-Kurdistan einen erneuten furchtbaren Höhepunkt, als 1983 Sicherheitskräfte 8.000 männliche Angehörige des Barzani-Stammes im Alter zwischen 12 und 70 Jahren in den Südirak verschleppten. Ihr Schicksal ist bis heute ungeklärt. Dies war offensichtlich eine Vergeltungsaktion für eine Offensive des Iran mit Beteiligung der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) unter Massoud Barzani, der die Parteiführung nach dem Tod seines Vaters übernommen hatte.
Als das irakische Regime 1987 in Folge des Kriegsverlaufes und der zunehmenden Aktivitäten der Peshmerga (kurdische Widerstandskämpfer) immer stärker in Bedrängnis geriet, bereitete es seine Lösung der kurdischen Frage vor. Minutiös geplant und bürokratisch ausgeführt begannen mit einem Giftgasangriff auf das Hauptquartier der PUK, der zweiten großen irakisch-kurdischen Partei, am 23. Februar 1988 die »Anfal-Operationen«. Der Name Anfal ist angelehnt an die Überschrift der achten Koransure und bedeutet soviel wie »legitime Beute«. Unter diesem Namen wurden bis zum 6. September 1988 acht Operationen durchgeführt.
Für alle Anfal-Operationen ergibt sich ein einheitliches Muster. Sie begannen mit der Bombardierung von Peshmerga-Stellungen und zentralen Dörfern, wobei häufig Giftgas verwandt wurde. Für die Jahre 1987 und 1988 sind mindestens vierzig Giftgasangriffe des irakischen Militärs auf kurdische Dörfer dokumentiert. Anschließend marschierten irakische Bodentruppen in das Gebiet, deportierten die Bevölkerung und zerstörten die Dörfer sowie die Infrastruktur. Um diese Zonen unbewohnbar zu machen, wurden die Brunnen gesprengt, die Felder z.T. vermint sowie Obsthaine und Wälder abgebrannt. In Übergangslagern wurden die Männer im Alter von 14 bis 50 Jahren und zahlreiche junge Frauen von ihren Familien getrennt. Diese sind bis heute verschwunden, die übrigen Familienmitglieder wurden in Umsiedlungslagern (sog. mujammaat) angesiedelt.
Sowohl die Anfal-Operationen, bei denen nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 50.000 und 180.000 Kurden »verschwanden«, als auch der Giftgasangriff auf Halabja im März 1988 hatten schon damals der Außenwelt den Charakter des irakischen Regimes offenbart – lange vor der Besetzung Kuwaits im August 1990.
Den verübten Menschenrechtsverletzungen wurde jedoch durch westliche Regierungen wenig Beachtung geschenkt, solange das Regime nicht die geostrategischen Interessen der führenden westlichen Staaten berührte und es im Gegenteil wichtige Funktionen erfüllen konnte. Entsprechend kam es auch auf westlicher Seite zu militärischen Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen, seien es Waffenlieferungen oder die Ausbildung von Militärs. Insbesondere die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen wäre ohne Unterstützung westlicher und insbesondere deutscher Firmen nicht möglich gewesen.
Der zweite Golfkrieg und seine Folgen
Die Besetzung und spätere Annexion Kuwaits, eines autokratisch regierten Staates, stellte eine eklatante Verletzung des Völkerrechts dar, zu dessen Kern die Änderung von Staatsgrenzen mit ausschließlich friedlichen Mitteln gehört. In diesem Punkt war die Meinung der internationalen Staatengemeinschaft einhellig, wie dies auch durch das entsprechende einstimmige Votum des UN-Sicherheitsrates dokumentiert wurde. Diese erneute Missachtung internationaler Prinzipien durch das irakische Regime wurde im Gegensatz zum ersten Golfkrieg, der mit einem Angriff Iraks auf den Iran begann, unverzüglich sanktioniert. Schrittweise wurden durch den UN-Sicherheitsrat die Wirtschaftssanktionen ab August 1991 eskaliert. Schließlich kam es zu der von den USA – bereits zu Beginn des Konfliktes – favorisierten militärischen Auseinandersetzung, die mit der Niederlage des Iraks endete.
Durch diesen Krieg am Golf ist eine neue Epoche der Kriegführung angebrochen. Erstmals wurden im großen Umfang strategische Überlegungen praktisch umgesetzt, die auf ein automatisiertes Schlachtfeld abzielen. Die Grenzen zwischen Krieg und Frieden verwischten sich. Durch den Einsatz fernlenkbarer Präzisionswaffen konnte das Risiko für Leib und Leben der alliierten Soldaten drastisch minimiert werden. Diese Waffen verführten dazu, sie auch nach dem Kriegsende im Februar 1991 in einem fortgeführten unerklärten Krieg immer wieder einzusetzen, wenn dies im anglo-amerikanischen Interesse lag.
Die Folgen dieser Art Kriegsführung für die irakische Zivilbevölkerung sind fragwürdig. Der Anteil der unmittelbar durch die Kampfhandlungen verursachten zivilen Opfer erschien verglichen mit anderen Kriegen des 20. Jahrhunderts, in denen sich über die Jahrzehnte betrachtet durchgängig der Anteil der Zivilisten an der Gesamtzahl der Verwundeten und Getöteten erhöhte, zunächst vergleichsweise gering. Da allerdings gezielt die Lebensnerven des Landes wie Elektrizitäts- und Wasserwerke zerstört wurden, stieg die Zahl der mittelbar durch den Krieg hervorgerufenen Opfer unter der Zivilbevölkerung in diesem urbanisierten Land – 70% der Bevölkerung lebt in Städten – dramatisch an. Dieser Effekt potenzierte sich durch das anhaltende Wirtschaftsembargo.
Der UN-Sicherheitsrat gab der US-Regierung mit seinem Votum, dass alle Maßnahmen zu ergreifen seien, die den Irak zum Abzug aus Kuwait zwingen, freie Hand in der Gestaltung des Konfliktes. Faktisch diktierte die US-Regierung das Geschehen. Sei es nun in der Festlegung des Kriegsbeginns oder in der Art der Kriegsführung. Die UN wurden, wenn es gelegen kam, allenfalls noch zur Legitimation der eigenen Politik benutzt, wie dies bei der Aufrechterhaltung der Sanktionen deutlich wurde. In anderen Situationen wie beispielsweise der willkürlichen Festlegung der Flugverbotszonen demonstrierte die US-Regierung, dass sie der UN in der Konfliktlösung nur eine untergeordnete Rolle zugestand. Die Autorität der UN als Organ zur Konfliktbewältigung wurde damit gezielt untergraben. Die UN wurde in der Interpretation ihrer eigenen Beschlüsse zum Zuschauer degradiert.
Operation »Provide Comfort«
Nach der Niederlage des Baath-Regimes gegen die Alliierten brach am 5. März, befördert durch die Erfolge der aufständischen Schiiten im Süden, die kurdische Intifatha aus. Der Aufstand weitete sich schnell aus und nach wenigen Tagen waren die meisten kurdischen Städte in der Hand der Aufständischen. Die Peshmerga konnten selbst bis in die Erdölstadt Kirkuk vordringen und kontrollierten die Umgebung der anderen Erdölmetropole Mosul.
Die Erfolge des Aufstandes währten nur kurz. Dem Bagdader Regime gelang es mit seiner Elitetruppe, den Republikanischen Garden, eine Gegenoffensive einzuleiten und den Aufstand brutal niederzuschlagen. Die Republikanischen Garden waren während des Golfkrieges von den Alliierten weit gehend unbehelligt geblieben. Dies deutet daraufhin, dass die Alliierten damit kalkuliert haben, das Baath-Regime selbst oder eine Militärregierung als regionale Ordnungsmacht insbesondere im Hinblick auf das islamisch-schiitische Regime in Iran zu erhalten. Trotz des im Rahmen der Waffenstillstandsverhandlungen verhängten generellen Verbotes von Militärflügen setzte die irakische Armee Hubschrauber und Kleinflugzeuge ein. Diese bombardierten die Aufständischen, aber auch die Zivilbevölkerung, mit Napalm- und Phosphorbomben. Eine Reaktion der Alliierten erfolgte nicht. Der kurdische Widerstand hatte der Gegenoffensive wenig entgegenzusetzen.
Die Aufstände der Kurden und Schiiten entsprachen nicht den Zielvorstellungen der Alliierten. Präsident George Bush, sen. hat zwar die Bevölkerung des Iraks zu einem Aufstand gegen Saddam Hussein ermuntert. Doch dies sollte wohl eher rhetorisch eine Modifizierung der amerikanischen Irak-Politik verdeutlichen, die zu diesem Zeitpunkt einen Militärputsch bei Erhalt der Machtstrukturen des Regimes favorisierte, denn eine tatsächliche Unterstützung der Opposition darstellen. Während der Aufstände ließ er keinen Zweifel daran, dass die USA den Aufständischen nicht zu Hilfe kommen werden. Die US-Regierung betonte immer wieder, dass sie den Irak als Staat in seiner jetzigen Form erhalten wolle. Zwei wichtige Verbündete der Alliierten, die Türkei und Saudi-Arabien, konnten aus innenpolitischen Gründen kein Interesse am Gelingen der Aufstände haben. Die türkische Regierung mußte befürchten, dass durch einen kurdischen Erfolg auch die Position der kurdischen Nationalisten in der Türkei gestärkt würde. Jedenfalls reagierten die Alliierten erst, als die Niederlage der Aufständischen besiegelt war. Dieses Verhalten der Alliierten steht in einem auffälligen Kontrast zu der Entschlossenheit, mit der sie in Kuwait vorgingen.
Die drohende Niederlage und die Erinnerung an die Vernichtungsoperationen in der unmittelbaren Vergangenheit lösten unter der kurdischen Bevölkerung eine Massenpanik aus. Ab dem 28. März flohen innerhalb von zwei Tagen ca. 2 Millionen Menschen in die benachbarte Türkei und in den Iran. Ungezählte harrten an den Hängen von Taurus- und Zagrosgebirge im Irak aus, um das weitere Geschehen abzuwarten. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) konstatierte den größten Massenexodus der vergangenen 40 Jahre.
Die Türkei schloss sofort ihre Grenzen. Dies bedeutete für Hunderttausende von Flüchtlingen, dass sie in den Bergen in Höhen von 1.500-2.000 m, unter z. T. noch schneebedeckten Gipfeln, ohne Trinkwasser und Nahrungsmittel ausharren mussten. Der Weg in die rettende Ebene wurde ihnen durch die türkische Armee auch unter Anwendung von Waffengewalt versperrt. 15- 20.000 Menschen, vor allem Säuglinge und Kleinkinder, starben in den folgenden Tagen an Wassermangel und Durchfallerkrankungen.
Die Aufnahme der Flüchtlinge im Iran war insoweit freundlicher, als ihnen gestattet wurde, die Grenze zu übertreten und zumindest im kurdischen Teil Irans Zuflucht zu suchen. Ein Teil der Flüchtlinge konnte bei Verwandten unterkommen.
Da die Medienpräsenz in der Region wegen des Golfkrieges noch groß war, gingen die Bilder von dem nicht enden wollenden Strom von Flüchtlingen, der die Berghänge an der irakisch-türkischen Grenze hinaufzog, bald um die ganze Welt. Hier trafen sie auf eine durch den Krieg emotional sensibilisierte Öffentlichkeit.
Vor dem Eintreffen der internationalen Hilfsorganisationen hatte die selbst weit gehend verarmte lokale kurdische Bevölkerung in der Türkei erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Flüchtlingen das Überleben zu ermöglichen.
Innerhalb von zwei Wochen lief eine große internationale Hilfsaktion an, wobei die katastrophenerprobten Hilfsorganisationen aus Westeuropa und den USA das Management der Hilfe zusammen mit den alliierten Militärs in die Hand nahmen.
Die Folgen der Massenflucht stellten die Alliierten vor neue Probleme. So befürchtete die türkische Regierung durch den Flüchtlingszustrom eine weitere Destabilisierung der grenznahen Provinzen, in denen sie selbst seit Jahren einen Krieg gegen die damals erstarkende PKK führte. Die Lage der kurdischen Bevölkerung in allen Teilungsstaaten erfuhr eine nie dagewesene Publizität.
Für die türkische Politik hatte es daher oberste Priorität, dauerhafte Flüchtlingslager auf türkischen Territorium zu vermeiden. Ein humanitäres Schutzgebiet im Irak selbst barg zwar aus türkischer Sicht auch die Gefahr, neue Freiräume für die türkisch-kurdische Guerilla zu öffnen. Dies schien allerdings für die türkische Machtelite die weitaus geringere Gefahr darzustellen.
Die Alliierten gerieten unter den Druck der Öffentlichkeit in ihren eigenen Ländern, die ein humanitäres Eingreifen forderte. Zunächst blieb unklar wie dies auf der operativen Ebene erfolgen sollte. Die US-Regierung entschied sich nur zögernd für die Intervention und griff erst nach neun Tagen den Vorschlag des britischen Premiers Major auf. Sie befürchtete ein längerfristiges militärisches Engagement im Irak. Schließlich entwickelten die Alliierten Pläne für ein erneutes militärisches Eingreifen, die in die Operation »Provide Comfort« (Trost bringen) mündeten.
Zeitgleich wurden im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Verhandlungen über das weitere Vorgehen in der Flüchtlingskatastrophe geführt. Diese mündeten in der Resolution 688 des UN-Sicherheitsrat vom 5.4.1991. Ihrer Annahme waren sehr kontroverse Diskussionen vorausgegangen. Dabei ging es im Kern der Auseinandersetzungen darum, ob dem Sicherheitsrat die Kompetenz zustehe, sich mit Menschenrechtsverletzungen zu befassen, oder ob er damit in die inneren Angelegenheiten eines Staates eingreife. Bei Gegenstimmen von Kuba, Jemen und Zimbabwe sowie Enthaltungen von China und Indien, war es die Resolution mit der geringsten Mehrheit aller zum Golfkonflikt verabschiedeten Resolutionen. In ihr wird vom Irak verlangt, unverzüglich die Repressionen einzustellen und darüber hinaus Maßnahmen zu ergreifen, die dem Frieden und der Sicherheit in der Region dienen. Zudem wird der Irak aufgefordert, internationalen Hilfsorganisationen in allen Landesteilen Zugang zu den Hilfsbedürftigen zu gewähren.
Bemerkenswert an der Resolution 688 des Weltsicherheitsrates ist, dass als Ursache der Gefährdung des Friedens in der Region nicht die Unterdrückung des kurdischen Volkes an sich, sondern die daraus resultierenden Fluchtbewegungen in die Nachbarstaaten angesehen wurden. Trotz der drohenden Sprache wurde diese Entschließung nicht ausdrücklich gemäß Kapitel VII der UN-Charta gefasst, der den Vereinten Nationen zugesteht, auch Zwangsmaßnahmen zur Erhaltung des internationalen Friedens zu ergreifen. Vielmehr bezog sich der Sicherheitsrat auf Artikel 2 Abs. 7 der UN-Charta, der die Souveränität der Mitgliedsstaaten gegenüber der Weltorganisation herausstellt, wobei dieses Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates von Maßnahmen nach Kapitel VII außer Kraft gesetzt werden kann. Auch wird in der Resolution nicht definiert, wie eine Missachtung sanktioniert werden soll. Sie enthält keinen Hinweis, ob dann ggf. UN-Blauhelme, die Golfkriegsalliierten oder ein anderes Militärbündnis eingreifen sollten. Allerdings wird explizit der Generalsekretär der Vereinten Nationen aufgefordert, alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, um das Flüchtlingselend zu lindern.
Gerade diese Resolution wurde von vielen PolitikerInnen als neue, allgemeinverbindliche Interpretation des Völkerrechts angesehen.
Die Resolution 687 des Weltsicherheitsrates, die am 03.04.1991 zwei Tage vor der Resolution 688 verabschiedet wurde und die Waffenstillstandsbedingungen beinhaltet, befasste sich überhaupt nicht mit der Menschenrechtslage im Irak.
Nachdem der Weltsicherheitsrat die Resolution 688 erlassen hatte, wurde von den Alliierten ein großer Teil der irakischen Provinz Dohuk zum »sicheren Hafen« erklärt. Die irakische Armee wurde von den Alliierten veranlasst, zumindest die Städte in diesem Gebiet zu räumen und von den vorgesehenen Flüchtlingslagern gebührenden Abstand zu halten.
Die US-Regierung erklärte im Juni 1991 zudem die Gebiete nördlich des 36. Breitengrads zu einer Flugverbotszone, in der keinerlei Flugbewegungen durch das irakische Militär gestattet wurden. Dabei umfasste die Flugverbotszonen nur einen Teil des kurdischen Siedlungsgebietes. Im August 1991 wurde auch der Südirak südlich des 32. Breitengrades von den Alliierten unter der Bezeichnung »Southern Watch« zur Flugverbotszone erklärt, nachdem irakische Militärflugzeuge verstärkt in Operationen gegen die schiitische Bevölkerung eingesetzt wurden. Die Festlegung der Flugverbotszonen erfolgte einseitig durch die US-Regierung in Absprache mit Frankreich und Großbritannien. Sie wurde nie durch eine UN-Resolution gedeckt.
Ein bemerkenswertes Beispiel der Neuinterpretation des Völkerrechts gab in diesem Zusammenhang der britische Außenminister Douglas Hurd in einem Radiointerview im August 1991: „ Nicht jede Aktion, die eine britische Regierung oder eine amerikanische Regierung oder eine französische Regierung unternimmt, muss durch eine spezifische Bestimmung in einer UN-Resolution gedeckt sein, vorausgesetzt wir stehen im Einklang mit dem Internationalen Recht. Internationales Recht anerkennt extreme humanitäre Not. (…) Wir stehen auf einer festen legalen als auch humanitären Grundlage, diese Flugverbotszone zu errichten.“4
Kritiker sahen darin einen Bruch des Völkerrechts, der zu einer »partiellen Entsouveränisierung« des Iraks geführt habe. Der Weltsicherheitsrat nahm das Vorgehen seiner drei ständigen westlichen Mitglieder schweigend hin.
Das weitere Vorgehen der Alliierten im Rahmen der Operation »Provide Comfort« folgte einer eigenmächtigen Interpretation der Resolution 688, insbesondere durch die US-Regierung, der sich andere alliierte Staaten anschlossen. Dieses Vorgehen war in keiner Weise vom Sicherheitsrat beschlossen worden. Auch hatte es der UN-Generalsekretär Perez de Cuellar abgelehnt, den alliierten Truppen für diese Operation das offizielle Mandat einer UN-Friedenstruppe zu verleihen. In der Resolution wird als zentrale Forderung der unbeschränkte Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen zu der notleidenden Bevölkerung verlangt. Man wird allerdings nur schwerlich die US-Army als humanitäre Hilfsorganisation ansehen. Es erscheint im Falle von „Provide Comfort« fraglich, ob die militärische Intervention durch die UN-Sicherheitsratsresolution 688 gedeckt war.
Weder die Resolution 688 noch eine andere den Irak betreffende UN-Resolution weisen Schutzzonen vergleichbar denen im zerfallenden Jugoslawien aus. Ausdrücklich verwies Perez de Cuellar auf die völkerrechtlichen Probleme, die der Einrichtung von Schutzzonen auf den Boden eines Staates ohne dessen Zustimmung entgegenstünden.
Im »sicheren Hafen« wurden derweil Zeltstädte errichtet, Lebensmittellager angelegt und Frischwasseraufbereitungsanlagen installiert. Dabei arbeiteten NGOs und Militär Hand in Hand. Dies war ein Novum. Hatten doch zahlreiche NGOs erst ihren Skeptizismus gegenüber dem Militär ablegen müssen. Nicht wenige Beobachter waren von der Geschwindigkeit dieses Prozesses überrascht und berichteten über NGOs, die sich geradezu enthusiastisch in die von den Militärs vorgegebenen Strukturen einbinden ließen.
Die Flüchtlinge, die sich vor die Wahl gestellt sahen, entweder in den Lagern ohne Wasser und mit kleinen Lebensmittelrationen zu verharren und dabei die Gewissheit zu haben von der türkischen Regierung nie offiziell als Flüchtlinge anerkannt zu werden oder in den Irak zurückzukehren, verließen allmählich die Berge. Einige hatten zudem die Illusion, dass die Alliierten dauerhafte Garanten ihrer Freiheitsrechte seien. Diese wurde durch die kurzzeitige Anwesenheit von bis zu 20.000 Soldaten in der Schutzzone gefördert. Diese alliierten Bodentruppen wurden zum überwiegenden Teil bis Mitte Juli aus dem Irak abgezogen, wobei lediglich in Zakho (an der Grenze zur Türkei) ein Verbindungsbüro – das Military Coordination Centre (MCC) – mit einer kleinen Truppenpräsenz beibehalten wurde. Seine Aufgabe beschränkte sich vorwiegend darauf, Informationen über relevante Ereignisse in der Region und an der Grenzlinie zum Irak zu sammeln und auszuwerten.
Unter der Bezeichnung »Poised Hammer« (angriffsbereiter Hammer) wurde parallel zum Abzug der Alliierten aus dem Nordirak in den türkischen Orten Silopi und Incirlik eine schnelle Eingreiftruppe mit 5.000 Mann stationiert. Diese Truppengröße wurde innerhalb weniger Monate auf eine Flugzeugstaffel zur Überwachung des nordirakischen Luftraumes reduziert. An den Kontrollflügen beteiligten sich neben US-Amerikanern, Briten und Franzosen auch türkische Beobachter, die die dabei gewonnenen Erkenntnisse auch im Kampf gegen die PKK nutzen.
Die Operation »Provide Comfort« hatte ihr Hauptziel, die Flüchtlinge aus der Türkei zur Rückkehr in den Irak zu bewegen, erreicht. Damit wurde diese Forderung des Bündnisgenossen Türkei erfüllt. Auch konnte die Öffentlichkeit in den USA und in Europa beruhigt werden. Militärstrategisch wurde das Ziel erreicht, eine längerfristige Stationierung von US-amerikanischen Bodentruppen im Irak zu vermeiden und sich lang andauernden Auseinandersetzungen zu entziehen, was seit dem Vietnamkrieg eine zentrale Doktrin für US-amerikanische Militäreinsätze darstellt. Aus amerikanischer Sicht war man daher bestrebt, das humanitäre Programm umgehend in die Hände der UN übergehen zu lassen.
Rasch relativierte sich dabei der oft versprochene internationale Schutz für die kurdische Bevölkerung Nordiraks. Das Schicksal der kurdischen Flüchtlinge im Iran war für das militärische Vorgehen der Alliierten vollkommen nebensächlich. Entsprechend wurden auch keine »safe havens« an der Grenze zum Iran errichtet. Zugleich überstieg der Umfang der von internationalen Organisationen und von Regierungen geleisteten materiellen Hilfe an die Türkei deutlich den Anteil, den der Iran erhielt.
Die UN verfolgten ihrerseits ähnlich wie die Alliierten das Ziel einer möglichst schnellen Rückführung der Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten. Sie versuchten dabei allerdings andere Wege zu gehen. Im Auftrag des UN-Generalsekretärs Perez de Cuellar verhandelte Sadruddin Aga Khan, damaliger UN-Koordinator für Flüchtlingsfragen, als Sonderbevollmächtigter mit der Bagdader Regierung. Vereinbart wurde am 18. April 1991, also unmittelbar nach Beginn der Operation »Provide Comfort«, ein humanitäres Hilfsprogramm für den gesamten Irak, das auch Rückkehrwillige unterstützen sollte. Bestandteil der Vereinbarung war, dass die Umsetzung dieses Programmes mit der Bagdader Regierung abgesprochen werden musste.
Ungeklärt blieben die Perspektiven für die Zurückkehrenden. Die Großstädte Arbil und Sulaimaniya sowie die in ihrer Umgebung liegenden gigantischen Umsiedlungslager wurden bis zum Herbst 1991 noch von den irakischen Militärs kontrolliert. Nach erneuten Aufständen zog sich das irakische Militär auch hier zurück. Zehntausende suchten Zuflucht in den Ruinen von Städten wie Quala Dize und Penjwin. Entlang der großen Überlandstraßen bildeten sich neue Flüchtlingslager.
Sicherlich war die Versorgung der Zurückkehrenden mit Lebensmitteln und Wasser im Binnenland besser gewährleistet als in den Gebirgslagern in der Türkei. Dennoch blieben ihre Gesundheit und ihr Leben ständig gefährdet. Dazu trugen die immer wieder aufflackernden Auseinandersetzungen zwischen Peshmergaeinheiten und der irakischen Armee bei. Zudem bestanden katastrophale hygienische Bedingungen in den Flüchtlingslagern und Notunterkünften. Eine Typhusepidemie forderte in den Sommermonaten 1991 zahlreiche Opfer.
Die größte Gefahr, insbesondere für die Landbevölkerung, ging gewiss von den Verminungen aus. Die Todesstreifen entlang der Staatsgrenzen hatten bereits während der Flucht zahlreiche Menschen schwer verletzt und getötet. Bei dem Versuch in die zerstörten Dörfer und Städte zurückzukehren, wurden deren BewohnerInnen nicht nur in den Ruinen ihrer Häuser, sondern auch auf Weiden und Feldern mit dieser tödlichen Hinterlassenschaft aus den beiden Golfkriegen und den Vernichtungsfeldzügen gegen die kurdische Bevölkerung konfrontiert.
Vollkommen offen blieb die Frage der irakischen Binnenflüchtlinge. Zehntausende, die aus der Provinz Kirkuk und in geringerer Zahl aus der Provinz Mosul stammten, waren während des Aufstandes vor den irakischen Truppen in weiter nördlich gelegene Landesteile bzw. in den Iran und die Türkei geflüchtet. Die meisten von ihnen konnten nicht in ihre angestammten Wohngebiete zurückkehren, da diese Gebiete größtenteils, insbesondere die Erdölstädte Kirkuk und Khanaquin, unter Kontrolle der irakischen Armee blieben. Die Anzahl dieser Binnenflüchtlinge wurde 1991/92 vom UNHCR auf 400-500.000 Menschen geschätzt. Die irakische Regierung nutzt seitdem die Gelegenheit, ihre Arabisierungspolitik in den Erdölzentren fortzusetzen. Vermehrt wurden arabische Familien angesiedelt. Auch setzte sie die Repression gegen die Zivilbevölkerung unverändert fort, ohne dass dies eine offizielle Reaktion von UN oder Alliierten provozierte.
Die von der Genfer Flüchtlingskonvention geforderten sicheren Verhältnisse, in die die Flüchtlinge zurückzuführen seien, waren zu keinem Zeitpunkt gegeben. Vielmehr wurden die Flüchtlinge zur Rückkehr unter teils falschen Versprechungen der Alliierten genötigt.
Letztlich wurde mit der so genannten UN-Schutzzone, als ein Ergebnis des unter vollständig anderen Intentionen geführten Golfkrieges, ein Konstrukt geschaffen, dessen Bezeichnung irreführend war, da es keine verbindlichen militärischen oder politischen Schutzgarantien der »internationalen Gemeinschaft« für deren BewohnerInnen gab. Die Alliierten, aber auch die UN, wurden ihrer besonderen Verantwortung gegenüber der schiitischen und kurdischen Bevölkerung nicht gerecht. Lediglich die anfängliche Präsenz einer großen Anzahl von Hilfsorganisationen stellte insofern einen gewissen fragilen Schutz dar, als sie eine internationale Öffentlichkeit repräsentierten. Am ehesten war die Situation noch vergleichbar mit einem überdimensionierten Flüchtlingslager, das ökonomisch und politisch vollständig von externen Akteuren abhängig war.
Das UN-Embargo gegen den Irak und seine Folgen
Durch die UN-Wirtschaftssanktionen wurde der Irak seiner offiziellen Außenwirtschaftsbeziehungen nahezu vollständig beraubt. Sowohl Erdölproduktion und -export als auch Bruttoinlandsprodukt sanken Anfang der neunziger Jahre dramatisch.
Obwohl Lebensmittel und Medikamente ausdrücklich vom Embargo ausgenommen waren, kam es im gesamten Irak zu einer bedrohlichen Verknappung von Grundnahrungsmitteln wie Milch, Milchprodukten, Reis, Mehl und Speiseöl. Dies führte zu einer Mangelernährung großer Teile der Bevölkerung. Durch die Verknappung von Saatgut und Medikamenten für die Veterinärmedizin wurde die landwirtschaftliche Eigenproduktion anhaltend geschädigt. Der Mangel an medizinischen Bedarfsgütern, aber auch an Ersatzteilen für Wasseraufbereitungsanlagen, führte zu einer prekären Lage in der medizinischen Versorgung der Zivilbevölkerung.
Die Folgen des Embargos waren für die irakische Bevölkerung verheerend. Eine Kommission unter Leitung der FAO konstatierte für den gesamten Irak im Sommer 1995 eine Situation wie unmittelbar vor einer Hungersnot. Es wurde berechnet, dass 29 % der Kinder unter 5 Jahren im Zentral- und Südirak unterernährt waren, in den drei Provinzen unter kurdischer Verwaltung waren es 20%. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF stellte im August 1999 fest: „Die Kindersterblichkeit im Irak hat sich seit dem Golfkrieg 1991 verdoppelt (…) Danach ist die Sterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren von 56 Todesfällen pro 1.000 Geburten (1984-1989) auf 131 Todesfälle pro 1000 Geburten (1994-1999) gestiegen. Die Sterblichkeit bei Kleinkindern im ersten Lebensjahr erhöhte sich von 47 auf 108 pro 1.000 Geburten.“5 Kein anderes Land der Welt hatte in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts einen vergleichbaren Anstieg der Kindersterblichkeit zu verzeichnen. Der Caritas-Verband schätzte im Dezember 1998, dass das Embargo seit 1991 für den Tod von 500.000 bis 800.000 Kindern verantwortlich sei.6
Befürworter der Sanktionspolitik bezweifeln trotzdem eine Kausalität zwischen den Zwangsmaßnahmen der UN und der prekären Lage der irakischen Bevölkerung. Ihr Elend wird ausschließlich als Kriegsfolge und Ergebnis der verfehlten Politik Saddam Husseins dargestellt, während den »berechtigten Sanktionen« nur eine untergeordnete Rolle zukäme. Dies erscheint in keiner Weise einsichtig, da der Irak bereits vor der Kuwaitkrise neben anderen Verbrauchsgütern im großen Umfang von Lebensmittelimporten und der Einfuhr medizinischer Güter abhängig war. Ein so umfassendes Wirtschaftsembargo musste eine entsprechend strukturierte Ökonomie verheerend treffen.
Das irakische Regime seinerseits weigerte sich dennoch aus Gründen der Staatsräson bis 1996, Öl unter der Kontrolle des Sanktionsausschusses zu verkaufen. Dies war dem Irak im begrenzten Umfang in UN-Sicherheitsratsresolutionen 1991 und nochmals in der Resolution 986 vom April 1995 zugestanden worden, um von dem Gewinn Reparationsleistungen an Kuwait zu zahlen sowie Lebensmittel und Medikamente zu importieren. Auch anderen humanitären Hilfsprogrammen stand das irakische Regime durchaus ablehnend gegenüber. Nachdem bereits in früheren Jahren ähnliche Androhungen erfolgt waren, verkündete der irakische Ministerrat im Juni 1998, dass ausländische humanitäre Hilfe nicht mehr erwünscht sei. Dies erfolgte, obwohl die Lage der Bevölkerung noch nach wie vor prekär war.
Das auf eine absolute Herrschaft im Innern aufbauende Baath-Regime lässt sich vom Leid der eigenen Bevölkerung solange nicht beeindrucken, wie die eigene Herrschaft nicht gefährdet erscheint.
In gewisser Hinsicht stabilisierten die Sanktionen sogar das irakische Regime. Sie ermöglichten ihm, das Embargo als ausschließliche Ursache der ökonomischen Misere darzustellen und die Verantwortung dem Ausland anzulasten. Die Sanktionen führten somit zu „einem Versailles-Effekt, zu einem Gefühl kollektiver und deshalb ungerechter Bestrafung“, den das Regime für sich nutzen konnte.7
Die verheerenden Folgen der beiden Golfkriege, aber auch die Zerstörung landwirtschaftlicher Gebiete, konnten in den Augen der irakischen Öffentlichkeit relativiert werden. Nach dem zweiten Golfkrieg war die bereits zuvor begonnene Privatisierung der irakischen Wirtschaft forciert worden. Davon profitierte eine kleine Schicht. Die sozialen Kosten dieser Transformation, die der Masse der Bevölkerung auferlegt wurden, konnten unter Embargobedingungen verschleiert werden.
Auch außenpolitisch verschafften die Sanktionen dem Regime Spielräume. Das Leid der Zivilbevölkerung konnte als Propagandamittel insbesondere in der arabischen Welt genutzt werden.
Die irakische Regierung ihrerseits scheute nicht davor zurück, selbst Gebiete im Norden und Süden des eigenen Landes mit einem Wirtschaftsembargo zu belegen. So blieb die irakische Bevölkerung weiterhin Spielball der Kontrahenten. Die Waffe des von der irakischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung eingesetzten internen Embargos war unter den Bedingungen der UN-Sanktionen besonders verheerend.
Dramatische Auswirkungen hatte das Verbot der irakischen Regierung Erdöl in die unter kurdischer Kontrolle stehenden Provinzen zu exportieren. Brennstoff musste im Rahmen der Hilfsprogramme in großem Umfang importiert werden. Mit einem Bruchteil des dafür verwendeten Geldes hätten kleinere Raffinerien zur Verarbeitung der eigenen Erdölvorkommen aufgebaut werden können. Diese hätten den gesamten Bedarf der autonomen Region decken können. Eine Einfuhr entsprechender Anlagen war aber als Folge des UN-Embargos nicht möglich.
So kam es, dass in einem der erdölreichsten Länder der Welt wegen des Brennstoffmangels Abholzungen im großen Ausmaß durchgeführt werden mussten. Nicht selten waren die Wälder bzw. die Zugänge zu den Wäldern vermint, was zu zahlreichen Opfern bei der Holzgewinnung führte. Vielfach wurden noch erhaltene Obstplantagen gerodet und damit die Existenzgrundlage zahlreicher Familien vernichtet.
Die Kurdistan-Front, ein Bündnis der wichtigsten irakisch-kurdischen Parteien, bemühte sich Verwaltungstrukturen in den befreiten Gebieten aufzubauen. 1992 organisierte sie Parlamentswahlen. Aus ihnen gingen die beiden großen Parteien KDP und PUK mit derselben Anzahl von Parlamentssitzen hervor. Zusätzlich waren die assyrischen Christen aufgrund einer Minderheitenregelung vertreten. Die Wahlen wurden von zahlreichen internationalen BeobachterInnen insbesondere im Vergleich mit dem regionalen Umfeld als relativ fair angesehen. Dennoch blieb der Regierung der »Autonomen Region Kurdistan-Irak« jegliche internationale Anerkennung versagt.
Von den Anrainerstaaten offen bekämpft, zogen westliche Regierungen die Führungen der großen Parteien als Gesprächspartner vor. Eine völkerrechtlich verbindliche Klärung des Status der kurdischen Regionalregierung durch die westlichen Staaten hätte zweifellos zu ihrer Stabilisierung beigetragen. Sie hätte die autonome Region politisch und moralisch gestärkt. Aber genau dies war nicht intendiert. Die Möglichkeiten des außenpolitischen Handelns oder diplomatischer Initiativen blieben eng begrenzt. Auch konnte die Regionalregierung gegenüber dem für Irakisch-Kurdistan so wichtigen Sanktionsausschuss der UN nicht als Verhandlungspartner auftreten. Eine Vertretung natürlicher oder juristischer Personen im Ausland war ihr nicht möglich, was ihre Vertragsfähigkeit erheblich einengte. Dies führte zu einer entscheidenden Schwächung der Regierung und ihrer Handlungsunfähigkeit in vielen überlebenswichtigen Fragen. Die internationale Abwertung der Regierung hatte neben der innenpolitischen Schwächung auch zur Folge, dass sie von Anbeginn als Trägerin der Implementierung von politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen weder bei den Geberländern bzw. -institutionen noch bei den vor Ort tätigen Hilfsorganisationen geschätzt war.
Nothilfe in Kurdistan-Irak unter Bedingungen des zweifachen Embargos
Als unmittelbare Folge des Embargos waren die Hilfsprogramme zunächst ausschließlich darauf ausgerichtet, die Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen wie Lebensmitteln, Medikamenten und Kleidern zu versorgen. Die Einführung von Rohstoffen, Ersatzteilen und anderen Produktionsgütern unterlag der Genehmigung des Sanktionsausschusses und wurde in der Regel nicht genehmigt. Hilfsprogramme zum Wiederaufbau der Infrastruktur oder zur Förderung der landwirtschaftlichen bzw. industriellen Produktion waren unter den Bedingungen der Nothilfe praktisch nicht durchführbar. Diese Politik der Hilfsprogramme in einer mit Sanktionen belegten Region erinnerte an die Hilfe für einen Mann, dem man erst die Beine bricht, um ihm dann Krücken zu geben.
Gerade jene UN-Programme, die noch am ehesten Elemente einer Strukturhilfe beinhalteten, waren Anfang der neunziger Jahre chronisch unterfinanziert. Auch im Bereich der bilateralen Hilfe blieb man einer Konzeption der Soforthilfe verhaftet. Die durch die Bundesregierung geleistete Hilfe wurde über Jahre weit gehend durch das Auswärtige Amt organisiert. Diesem obliegt in seiner Ressortzuständigkeit eigentlich nur die humanitäre Soforthilfe. Auf Projektebene der Hilfsorganisationen bedeutete dies, dass die Projekte kurzfristig geplant, rasch umgesetzt und schnell abgerechnet werden mussten. Für die viel beschworene Nachhaltigkeit war dabei wenig Platz. Unter dem Verweis, dass bei fehlender Zusammenarbeit mit der Zentralregierung in Bagdad langfristige Entwicklungshilfe nicht geleistet werden könne, hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) zunächst ein stärkeres Engagement abgelehnt.
Ein ähnliches Bild zeigte sich auch auf der Ebene der EU. In den Programmen von ECHO (dem für humanitäre Hilfe der EU zuständigen Amt) dominieren die Verteilung von Lebensmitteln, Medikamenten und Brennstoffen sowie eine medizinische Basisversorgung. Zwar wurden Gelder zum Wiederaufbau zerstörter Dörfer zur Verfügung gestellt, Infrastrukturmaßnahmen wurden indes nur im bescheidenen Umfang gefördert.
Bereits 1991/92 forderten vor Ort tätige Hilfsorganisationen die Auflegung langfristiger Entwicklungsprogramme. Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen spontan in ihre zerstörten Dörfer zurückgingen, schien es absurd, Millionen für Lebensmittelverteilungen statt für Saatgut auszugeben. Erst 1995/96 begann ein vorsichtiges Umdenken bei Gebern wie der EU oder dem BMZ, die jetzt auch Haushaltsmittel aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellten.
Die ausschließliche Ausrichtung auf Soforthilfe verstärkte zwangsläufig die Importorientierung und damit die Abhängigkeit von außen, statt das Augenmerk auf die Produktivkraftentwicklung der Region zu lenken. Auch waren in diesem Konzept keine Mittel zum Unterhalt bzw. zur Rekonstruktion der öffentlichen Verwaltung vorgesehen.
Diese Orientierung auf die Nothilfe traf eine Region, deren ländliche Infrastruktur durch die Vertreibungs- und Vernichtungsaktionen der achtziger Jahre weit gehend zerstört war. Die langfristigen sozioökonomischen Folgen der Zerstörung der ländlichen Infrastruktur in Südkurdistan sind nicht ausreichend untersucht. Der Rückgang der Schaf- und Ziegenfleischproduktion des Iraks um ca. 50 bzw. 30 % in den Jahren 1979/81-1989 war neben dem ersten Golfkrieg vermutlich durch die Vertreibungspolitik bedingt. Die Getreideproduktion des gesamten Iraks ging in diesem Jahrzehnt um 25 % zurück, dies obwohl der Ertrag pro Hektar um 26 % gesteigert werden konnte. Auch die Milchproduktion stagnierte.8 Die Region litt zudem noch immer unter den Folgen des irakisch-iranischen Krieges wie z. B. den Minenfeldern, die oft den Zugang zu wichtigen landwirtschaftlich genutzten Gebieten versperrten. Auch waren die Schäden, die durch die Kampfhandlungen während und nach dem Golfkrieg entstanden, nicht abzusehen.Nach Angaben der UN hatte die Anzahl der Binnenflüchtlinge bis 1999 auf 650.000 zugenommen. Das Baath-Regime setzte über die Jahre seine Vertreibungspolitik aus den Erdölgebieten fort und schob kurdische und turkmenische Familien in den Norden ab. Allein im Januar 1998 wurden 1.468 kurdische Familien aus Kirkuk zwangsausgewiesen. Etwa 70% der BewohnerInnen der Region waren nach Angaben der Regionalregierung auf Hilfe von außen angewiesen, um überleben zu können.
Ebenso hinterließ das zweifache Embargo im Dienstleistungsbereich tiefe Spuren. Eine Telekommunikation war weder in der Region selbst noch mit dem Ausland möglich. Gleichermaßen lag das Bankwesen vollständig danieder. Überweisungen aus dem Ausland konnten nicht getätigt werden. Legal konnten Geldmittel nach Kurdistan-Irak nur eingeführt werden, wenn man den überhöhten Umtauschkurs der irakischen Regierung akzeptierte, ansonsten mussten die Gelder, auch die Hilfsgelder, nach Kurdistan-Irak eingeschmuggelt werden.
Erschwerend kam hinzu, dass der Gütertransport durch die Türkei, dem einzigen offiziellen Zugang, zeitweilig unterbrochen und sehr unzuverlässig war. Die Regierung in Ankara schloss und öffnete den Grenzübergang Harbur/Ibrahim Khalil nach eigenem Gutdünken und hatte somit ein außerordentlich effektives Druckmittel gegen die südkurdische Regionalregierung in der Hand. Die Bedeutung dieses Grenzüberganges wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass dort zeitweilig bis zu 3.000 LKW‘s am Tag abgefertigt wurden. In zahlreichen Fällen haben die türkischen Behörden die Importe von Hilfsgütern durch Hilfsorganisationen behindert.
Obwohl das Hilfskonzept der UN an manchen Stellen durchlöchert wurde, blieb die Reduktion der Hilfspolitik auf eine Nothilfe, die nicht einmal den Anspruch erhob, eine über das unmittelbar Lebensnotwendige hinausgehende Perspektive zu vermitteln, kennzeichnend für die nächsten Jahre. Die Embargopolitik führte dazu, dass über Jahre die humanitären Hilfsmaßnahmen den wesentlichen Wirtschaftsfaktor der Region darstellten. Die Abhängigkeit von den Hilfslieferungen verhinderte nicht nur eine eigenständige ökonomische Entwicklung, sondern untergrub auch das Vertrauen in die eigene Kraft, Selbstinitiative wurde blockiert. Die Hilfsprogramme verstärkten somit ungewollt eine passive Haltung, wie sie der irakische Versorgungsstaat in der Vorkriegszeit implizierte. Weit verbreitet war eine Haltung, die auf eine Problemlösung von außen drängte. Die anscheinend unveränderbaren, äußeren makropolitischen Verhältnisse verstärkten wiederum die Passivität.
Die Hilfspolitik verstärkte die ökonomischen Unterschiede innerhalb der kurdischen Region. Die Provinz Dohuk war fast identisch mit dem durch die Operation »Provide Comfort« geschaffenen und über einige Monate mit Bodentruppen geschützten »safe haven«. Nachdem die alliierten Militärs in großem Umfang Hilfsgüter in den »sicheren Hafen« transportiert hatten, begannen viele Hilfsorganisationen unter deren Schutz in diesem Gebiet mit ihren Aktivitäten. Die gesamten materiellen und logistischen Ressourcen konzentrierten sich im Rahmen der Operation »Provide Comfort« denn auch in diesem Gebiet. Die dadurch geschaffenen Strukturen wirkten über Jahre nach. Für einige Hilfsorganisationen blieb Zakho weiterhin die Basis für ihre Aktionen. Die staatliche US-amerikanische Hilfsagentur OFDA beispielsweise entschloss sich erst 1993/94 dazu, den »safe haven« zu verlassen und auch in anderen Gebieten aktiv zu werden. Die Stadt Sulaimaniya und ein großer Teil der gleichnamigen Provinz sowie der nördliche befreite Teil der Provinz Kirkuk (»New Kirkuk«), die außerhalb der Flugverbotszone lagen, waren im besonderen Maße Bedrohungen durch das irakische Militär ausgesetzt.
Begünstigt durch diese Verwerfungen verschärfte sich der Kampf der beiden großen kurdischen Parteien um die Ressourcen. Umstritten waren insbesondere die Zolleinnahmen aus dem Grenzübergang zur Türkei. Dieser lag im Kernland der KDP, dem Badinan, und wurde von ihr kontrolliert, während die PUK ihr Haupteinflussgebiet im Südosten Irakisch-Kurdistans, dem Soran, hatte. 1994 mündeten diese Auseinandersetzung in einen offenen Bürgerkrieg. In dessen Verlauf eroberte im August 1996 die KDP zusammen mit der irakischen Armee die zuvor von der PUK kontrollierte Hauptstadt Arbil.
»Oil for food« oder »only food for oil«
Die ökonomische Situation im gesamten Irak änderte sich, als 1996 nach mehrjährigen Verhandlungen die UN-Wirtschaftssanktionen teilweise gelockert wurden.
Die irakische Regierung ihrerseits stimmte nach langwierigen Verhandlungen einem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten unter der Aufsicht des UN-Sanktionskomitees zu. Mehrere Jahre hatte sie sich geweigert, die Bedingungen des UN-Sicherheitsrates zu akzeptieren. Damit hatte die irakische Regierung ihrerseits humanitäre Hilfsprogramme für die eigene Bevölkerung blockiert. Sie befürchtete, dass eine solche Zusage die vollständige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen verzögern würde und war erst bereit einem Abkommen zuzustimmen, als die Aussichten auf eine rasche Aufhebung schwanden. Der UN-Sicherheitsrat versah den Ölverkauf zusätzlich mit Bedingungen – insbesondere Reparationszahlungen an Kuwait –, die dem irakischen Regime unter Verweis auf die Verletzung seiner Souveränitätsrechte eine Ablehnung zunächst leicht machten.
Mit der Resolution 986 genehmigte der Weltsicherheitsrat am 14. April 1995 dem Irak den Kauf von Lebensmitteln, medizinischen Bedarfsgütern und dringend benötigten zivilen Gütern. Sie gestattete dem Irak, ab November 1996 innerhalb von 180 Tagen Erdöl im Gegenwert von 2 Milliarden US-$ zu verkaufen, was einer Fördermenge von 500.000 Barrel pro Tag entsprach. Im Mai 1996 wurde das Memorandum of Understanding (MOU) zwischen den UN und der irakischen Regierung unterzeichnet. Es legte u.a. die Verkaufsmodalitäten für das irakische Erdöl, das Genehmigungsverfahren für den Import der humanitären Güter sowie die Distributionspläne fest.
Die Einnahmen aus dem Erdölverkauf werden nach den Bestimmungen der Resolution 986 wie folgt aufgeteilt: 53% für Lebensmittel, medizinische Güter sowie humanitäre Lieferungen in den Zentral- und Südirak, 13 % für Lebensmittel, medizinische und humanitäre Lieferungen in die drei kurdischen Provinzen Arbil, Dohuk und Sulaimaniya, 30 % in den UN Compensation Fund (vorwiegend um kuwaitische Ansprüche zu befriedigen ), 2,2% für Verwaltungskosten der UN, 0,8% für Verwaltungskosten der UNSCOM und 1 % für die Führung des Treuhandkontos.
In der Umsetzung des Programmes ergaben sich zahlreiche Schwierigkeiten. Der desolate Zustand der irakischen Ölindustrie mit seinen oftmals veralteten und reparaturbedürftigen Ölförderanlagen erlaubte es auf Dauer nicht, die Mengen Öl zu exportieren, die erforderlich gewesen wären, um die angestrebten Einnahmen für den Kauf humanitärer Güter zu erzielen. Auch das komplexe Genehmigungsverfahren der Handelsverträge und dessen schwerfällige Handhabung durch den Sanktionsausschuss führten zu ausgeprägten zeitlichen Verzögerungen.
In den von der irakischen Regierung kontrollierten Gebieten konnte allenfalls eine Stabilisierung der humanitären Lage erzielt werden. So wurde die Kalorienzahl pro Kopf der Bevölkerung deutlich erhöht. Die Anzahl der Unterernährten nahm nicht weiter zu. Ein Ende der humanitären Katastrophe ist dennoch nicht in Sicht.
Das MOU bestimmte in einem eigenen Anhang das Vorgehen in den drei kurdischen Provinzen Dohuk, Arbil und Sulaimaniya. Nachdem die Integrität und Souveränität des irakischen Staates betont wurden, legten die Beteiligten darin fest, dass das Programm auf der Grundlage der Weltsicherheitsratsresolution 986 in diesen kurdischen Provinzen von den UN in enger Absprache mit der irakischen Zentralregierung durchgeführt werden sollte. Dieser Sonderstatus beschränkte sich auf die drei Provinzen, denen die Zentralregierung 1970 einseitig Autonomierechte zugestanden hatte.
Im dem MOU wurde vereinbart, auf annähernd gleiche Lebensbedingungen im gesamten Irak zu achten. Selbstredend war in der Vereinbarung eine Partizipation kurdischer Stellen in der Entwicklung und Durchführung des Programmes nicht vorgesehen. Die UN verpflichteten sich zur regelmäßigen, zumindest wöchentlichen, Berichterstattung an die irakische Regierung. Die irakische Regierung wies desöfteren darauf hin, dass sie keinerlei Absprachen der kurdischen Behörden mit den UN akzeptieren würde, denen sie nicht zugestimmt hätten. Eine besondere Bedeutung legte das irakische Regime dabei auf jegliche Infrastrukturmaßnahmen. Elementare Belange der Infrastruktur von Irakisch-Kurdistan werden somit weiterhin in Bagdad entschieden.
Die kurdischen Behörden wurden in dem Prozess der Programmerstellung und Umsetzung lediglich informell konsultiert. Die beiden Regierungen in der autonomen Region, die sich als Folge des internen Krieges konstituiert hatten, bildeten eine gemeinsame Kommission, die den UN-Organisationen Vorschläge unterbreitet. Eine Diskussion über die abgelehnten Vorschläge erfolgte seitens der UN nicht. Es wurden zwar zwischen den UN-Organisationen und den kurdischen Behörden Absprachen auf der operativen Ebene getroffen, dennoch vermied die UN ihrerseits alles, was die kurdischen Verwaltungen offiziell aufwerten könnte.
Während das Programm im Zentral- und Südirak durch staatliche irakische Stellen unter Aufsicht der UN umgesetzt wurde, wurde es in Kurdistan-Irak von dem United Nations Inter-Agency-Humanitarian Program durchgeführt. Dadurch wurden die UN-Organisationen zu dem zentralen ökonomischen Faktor in der Region.
Entsprechend dem Bevölkerungsanteil werden die bereitgestellten Mittel nach einem Schlüssel von 57:43 zwischen den von der KDP- bzw. PUK-verwalteten Regionen aufgeteilt. Dabei werden die divergierenden Entwicklungen in den kurdischen Provinzen, die eine Ursache des internen Krieges darstellten, nicht berücksichtigt.
Insbesondere das Los der Großstadtbevölkerung konnte durch diese Programme erheblich erleichtert werden. War der Alltag vieler Familien in den Jahren seit 1991 weit gehend durch den Kampf um Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter bestimmt gewesen, so wurden jetzt ausreichend Grundnahrungsmittel zur Verfügung gestellt. Die Lebensmittelpreise auf den Märkten fielen und der finanzielle Spielraum vieler Familien vergrößerte sich erheblich. Die Versorgung mit Medikamenten und die apparative Ausstattung der Gesundheitseinrichtungen verbesserte sich spürbar.
Auch die katastrophale Lage vieler innerirakischer Flüchtlingsfamilien wurde durch den im Rahmen des »oil for food«-Programms ermöglichten Wohnungsbau verbessert. Ein großer Teil der unter dem Titel »Wiederaufbau« verbuchten Gelder musste für die Unterbringung von Binnenflüchtlingen bzw. Rückkehrenden aus dem Iran genutzt werden. Diese lebten bis dahin unter katastrophalen Bedingungen in Notquartieren.
Neben diesen Binnenflüchtlingen wurden vom WFP Lebensmittelprogramme für andere besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen wie schwangere Frauen, stillende Mütter, unterernährte Kinder, Langzeitarbeitslose, Behinderte und Rückkehrende aus dem Iran aufgelegt. Die soziale Absicherung durch die Lebensmittelverteilung scheint auch die Rückkehr bisher Zögernder aus den Umsiedlungslagern in die ehemals zerstörten Gebiete begünstigt zu haben.
Einige Sozialindikatoren verbesserten sich Ende der neunziger Jahre in der kurdischen Region erheblich. 1994-1999 konnte die Kindersterblichkeit unter das Niveau von 1989 gesenkt werden. Sie war damit niedriger als im übrigen Irak. Auch verbesserte sich der Ernährungszustand der Kinder wesentlich. Damit schien die humanitäre Lage Ende der neunziger Jahre in Irakisch-Kurdistan weniger prekär zu sein als im Mittel- oder Südirak. Umstritten ist, welcher Stellenwert den »oil for food«-Programmen, die erst zum Jahresende 1996 einsetzten, bei dieser Entwicklung zukommt.
Da das Programm alle sechs Monate vom UN-Sicherheitsrat verlängert und die Bedingungen mit der irakischen Regierung neu ausgehandelt werden müssen, werden die Planungen durch diese Zeitintervalle limitiert. Entsprechend können auch Gehaltszusagen für im Gesundheitswesen Beschäftigte, LehrerInnen und Angestellte in anderen öffentlichen Einrichtungen, sofern sie überhaupt von den Programmen profitierten, nur zeitlich beschränkt erfolgen. Selbst Aus- und Fortbildungsprogramme sind diesen Phasen von 986 unterworfen.
Hatten sich die Hilfsorganisationen bis 1996 zumindest in Ansätzen über Mindeststandards für den Wiederaufbau zu verständigen, so zwingt die Gestaltung der Programme jetzt zu einem raschen Hochziehen von Gebäuden und Asphaltieren von Straßen. Integrierte Programme mit Starthilfen für landwirtschaftliche Produktion und Weiterverarbeitung oder unterstützende Bildungsmaßnahmen sind unter diesen Bedingungen nur bedingt möglich. Mit diesem Programm sind keine Entwicklungsstrategien verbunden, es dient lediglich dazu, den drängendsten Mangelerscheinungen abzuhelfen.
Weitere Mittel wurden für Wiederaufbaumaßnahmen bereitgestellt, auch konnten vermehrt Infrastrukturvorhaben wie Straßen- und Brückenbau angegangen werden. Diese Baumaßnahmen waren nicht eingebunden in ein mittel- oder längerfristiges Verkehrskonzept, sondern richteten sich nach dem aktuellen Bedarf des laufenden Programms. An eine umfassende Raumplanung war nicht zu denken. Zwar konnten dringend benötigte Ersatzteile für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen besorgt werden. Eine Strukturplanung, die es ermöglicht hätte, das Wasser- und Abwassersystem, das Stromnetz und das Gesundheitswesen wieder umfassend herzustellen, war unter dem Diktat von Sechsmonatsplänen ebenfalls nicht möglich. Die weiterhin geltenden Restriktionen des UN-Wirtschaftsembargos verhinderten zudem eine Instandsetzung der unter Ersatzteilmangel leidenden Industrieanlagen. Ein ständiger Streitpunkt zwischen der kurdischen Seite und den UN-Organisationen stellt zudem die mangelnde Qualität der im Rahmen der Programme gelieferten Produkte dar.
Die Personalpolitik der UN-Organisationen trägt zur Erosion der kurdischen Verwaltungen bei. Die UN-Organisationen bezahlen an lokale MitarbeiterInnen Gehälter, die ein Vielfaches der von den kurdischen Behörden gezahlten betragen. Die am besten qualifizierten Kräfte wandern daher kontinuierlich zu den UN-Organisationen ab, was ein Ausbluten der kurdischen Behörden zur Folge hat. Dabei kommt es nicht selten zu einer Deprofessionalisierung, da auch weniger qualifizierte Arbeiten in UN-Organisationen weit besser bezahlt werden als hochqualifizierte in kurdischen Institutionen. Vorschläge der kurdischen Seite, ein Rotationssystem einzuführen, konnten sich bisher nicht durchsetzen.
Besonders problematisch erwiesen sich die Lebensmittelverteilungen im Rahmen des »oil for food«-Programms für die einheimische Landwirtschaft. Da die Lebensmittel nicht in Kurdistan-Irak selbst aufgekauft werden durften und statt dessen importiert wurden, geriet die lokale Agrarproduktion als Folge des Verfalls der Marktpreise zunehmend unter Druck. Während im Sommer 2000 nach kurdischen Angaben eine Tonne Weizen für 400 US-$ importiert wurde, wurde sie auf dem lokalen Markt für 50 US-$ angeboten. Die Produktion von Weizen und Reis ging entsprechend zurück. Die Existenzgrundlage der kurdischen ErzeugerInnen wurde erneut gefährdet.
Die im Rahmen der Resolution 986 bereitgestellten Gelder helfen, die Infrastruktur in Irakisch-Kurdistan notdürftig zu reparieren. Für Modernisierungen reichen sie nicht aus. Natürlich kann mit diesen Programmen keine beständige ökonomische Entwicklung in Gang gesetzt werden. Somit reproduziert das »oil for food«-Programm die bestehenden Abhängigkeiten auf einem höheren Niveau. Dieser Status ist zudem noch sehr störanfällig und von zahlreichen externen Akteuren, die von kurdischer Seite kaum beeinflusst werden können, abhängig. Die Bevölkerung wird mit dem Nötigsten versorgt, in Passivität gezwungen, politische Ansprüche werden verwehrt. Irakisch-Kurdistan bleibt weiterhin ein Provisorium ohne Aussicht auf eine langfristige Perspektive. An dieser Einschätzung ändern auch die gegenüber dem Mittel- und Südirak besseren Lebensbedingungen nichts.
Durch die beschränkte Wiederaufnahme des Handels erhöhte sich nochmals die Bedeutung des an der türkischen Grenze gelegenen Überganges Ibrahim Khalil/Habur. Habur wurde einer der vier offiziellen, für den Import zugelassenen Grenzübergänge. Auch wurde die Pipeline Kirkuk-Yumutalik, die Öl zum türkischen Verladehafen Ceyhan beförderte, wieder eröffnet. Die Zolleinnahmen kamen ausschließlich der KDP-geführten Regierung zugute. Entsprechend vergrößerte sich die Kluft zwischen dem relativ reichen Norden und dem verarmten Süden. Dies verschärfte erneut die Spannungen zwischen den beiden großen Parteien. Ein Vorschlag der PUK, die Zolleinnahmen dem Budget des Gesamtprogrammes zuzuschreiben und nach dessen Schlüssel zwischen den beiden Regierungen zu verteilen, konnte sich bisher nicht durchsetzen.
Auswirkungen des Embargos und der humanitären Intervention
Bevor wir uns einer Bewertung der humanitären Intervention und ihre Folgen widmen, soll an dieser Stelle abschließend auf die Auswirkungen des UN-Wirtschaftsembargos gegen den Irak eingegangen werden.
Das Sanktionsregime, das ursprünglich errichtet worden war um den Irak zu einem Abzug aus Kuwait zu bewegen, wurde nach dem Golfkrieg zur Erzwingung der in der UN-Resolution 687 genannten Abrüstungsmaßnahmen fortgeführt. Es stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit dieser das Leben von Millionen von Menschen bedrohenden Maßnahme, wenn bereits bei Kriegsausbruch erklärt wurde, sie hätten nicht gereicht um den Krieg zu verhindern. Es wird ein grundlegendes Dilemma dieser Sanktionen deutlich – ihr Ziel wurde nicht eindeutig definiert. Es wurden von anglo-amerikanischer Seite immer neue Bedingungen zu ihrer Erfüllung aufgestellt und Interpretationen der entsprechenden UN-Sicherheitsratsresolutionen nachgereicht.
Die durch die Sanktionen hervorgerufene humanitäre Katastrophe ist mit den Auswirkungen eines Krieges vergleichbar. Elementare Rechte der Bevölkerung auf Leben, Nahrung, Wasser, Unterkunft, Kleidung und Bildung wurden dadurch verletzt. In der Tat übertraf ihre Wirkung die unmittelbaren Folgen des zweiten Golfkrieges bei weitem. Sie trafen besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen wie Kinder, schwangere Frauen und alte Menschen. Eine ganze Generation ist bereits ihrer Entwicklungsmöglichkeiten beraubt. Diese Art der Sanktionspolitik kann kaum als humane Alternative zu einem Krieg gelten. Die UN sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie diese Politik mit den Normen der UN-Charta, die es nach ihrem eigenen Bekunden auch in dieser Situation einzuhalten gilt, vereinbar ist. Die Grenzen des Vertretbaren wurden dann überschritten, als die Sanktionen dazu betrugen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung unter das Existenzminimum fiel. Nach zehn Jahren zeigt sich, dass die Hauptleidtragende der Sanktionen die Zivilbevölkerung war, während das Baath-Regime seine unmittelbar nach Kriegsende erheblich geschwächte Position wieder festigen konnte. Dabei ist es natürlich keineswegs verwunderlich, dass das Regime versucht, die verknappten Ressourcen vorrangig für den eigenen Machterhalt zu nutzen und erst in zweiter Linie humanitäre Erwägungen anstellt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass mit der Aufrechterhaltung der Sanktionen eine zunehmende Schwächung des Regimes eintritt, vielmehr scheint dieses gelernt zu haben, sich mit den neuen ökonomischen Gegebenheiten zu arrangieren.
Die langfristigen ökonomischen und sozialen Folgen, die für den Irak aus dem Krieg und den über einem Jahrzehnt währenden Sanktionen resultieren, lassen sich nicht übersehen. Jede zukünftige Regierung wird konfrontiert sein mit den hoch gesteckten Erwartungen der Bevölkerung, die das Embargo ertragen musste. Neben diesem ökonomischen Sprengsatz wird jede Regierung in der Zukunft mit den sozialen Folgen des Embargos zu kämpfen haben. Die Langzeitwirkung der Auflösung sozialer Strukturen und staatlicher Institutionen wie des Bildungswesens sind noch nicht absehbar. Es ist nicht ersichtlich, wie daraus stabile politische Verhältnisse erwachsen sollen. Der Irak wird auf absehbare Zeit ein Herd der Instabilität bleiben.
Als Alternative zur bisherigen Sanktionspolitik wurden so genannte smarte oder intelligente Sanktionen, die sich gezielt gegen die herrschenden Eliten richten und die Zivilbevölkerung schonen sollen, vorgeschlagen. Diese könnten zum Beispiel Reiseverbote für Regierungspersonal, Stornierung von Ausbildungsprogrammen, Einfrieren der Auslandskonten sowie ein Verbot von Auslandsinvestitionen beinhalten. Abgesehen davon, dass diese Maßnahmen z.T. in den UN-Sanktionen gegenüber dem Irak vorgesehen sind, werden solche nur eine begrenzte Wirkung entfalten können und es erscheint zweifelhaft, ob sie ein Regime wie das irakische wirklich beeindrucken können. Dennoch ist es andererseits erstaunlich, dass die Möglichkeiten gezielt gegen das Regime gerichteter Maßnahmen bis heute noch nicht vollständig genutzt wurde. So wurden z.B. im Unterschied zu Bosnien und Ruanda keine Anklagen vor einem internationalen Gerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben. Ein solcher Prozess wäre schon mit den Giftgaseinsätzen im iranisch-irakischen Krieg und den Anfal-Operationen zu begründen.
Das humanitäre Desaster gebietet eine Abkoppelung der Wirtschaftssanktionen von der Abrüstung. Dabei ist die Frage noch offen, wie solch ein aggressives Regime gegen seinen Willen abgerüstet werden kann.
Sicherlich wird auch zu prüfen sein, wie Staaten und Firmen, die sich aktiv an der Aufrüstung solcher Regime beteiligten, in die Verantwortung genommen werden können. Es scheint in Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland wenig Interesse zu bestehen, die Firmen, die dem Irak illegal Rüstungsgüter verschafften, konsequent strafrechtlich zu verfolgen Auch wurden keine Schritte unternommen, die eine intensivere Kontrolle des Exports von Anlagen, die sowohl militärische als auch zivile Güter produzieren können, ermöglichen würde. Obendrein erfolgten bislang trotz der irakischen Erfahrungen keine restriktiveren Rüstungsexportkontrollen.
Wie sind nun der Verlauf und die Folgen der humanitären Intervention zu beurteilen? Dabei erscheint die Bestimmung des zeitlichen Rahmens, der zu betrachten ist, bereits problematisch. Der Beginn kann zwanglos mit dem Anlaufen der Operation »Provide Comfort« festgesetzt werden. Schwieriger erscheint es, das Ende festzulegen. Einige Autoren verweisen darauf, dass der Irak durch seine Unterschrift unter dem MOU im April 1991 quasi die Ziele der Intervention akzeptiert habe und folglich ab diesen Zeitpunkt „nicht mehr von einer Intervention, einem Handeln gegen den Willen des Irak, gesprochen werden“ kann.9 Das hieße, die humanitäre Intervention, die ohne aktives Zutun des Weltsicherheitsrates durchgeführt wurde, wäre nach wenigen Tagen in einem Projekt der humanitären Hilfe unter dem Schirm der Vereinten Nationen aufgegangen. Dem ist entgegenzuhalten, dass zu diesem Zeitpunkt die Alliierten noch in einem beträchtlichen Umfang Bodentruppen im Nordirak stationiert hatten, die vollkommen unabhängig von und häufig entgegengesetzt zu den Vorstellungen der irakischen Regierung handelten und erst einige Monate nach dem Abschluss des MOU abzogen. Darüber hinaus werden von anglo-amerikanischer Seite die Flugverbotszonen, mit der Begründung des notwendigen Schutzes der Zivilbevölkerung, bis zum heutigen Tage aufrechterhalten. Die irakische Regierung ihrerseits hat zu keinem Zeitpunkt die Einschränkung ihrer Souveränitätsrechte im Norden des Landes akzeptiert.
Die Folgen der humanitären Intervention
Bei der Einschätzung der Intervention erweist sich als zweckmäßig, zwischen den unmittelbaren Folgen der Operation »Provide Comfort« und langfristigen Folgen zu unterscheiden.
Die als Folge der Niederschlagung der Aufstände entstandene humanitäre Situation erwies sich als untragbar. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Alliierten Mitverantwortung dafür tragen, dass es zu einer solchen humanitären Katastrophe gekommen ist. Ein Eingreifen von außen erschien den Alliierten geboten, zumal sie unter erheblichem Druck der eigenen Bevölkerung standen. Der mit der Operation »Provide Comfort« eingeschlagene Weg stellte eine Option dar, es war aber nicht die einzig denkbare. Den katastrophalen Zuständen in den Bergen hätte zunächst auch Abhilfe geleistet werden können, indem die türkische Regierung den Flüchtlingen gestattet hätte, die Berge zu verlassen und in den Ebenen Schutz zu suchen.
In ihrer unmittelbaren Ausführung war die Intervention insofern effizient, als sie die rasche Rückkehr eines großen Teils der Flüchtlinge aus der Türkei ermöglichte und ihnen aktuell neben Schutz vor erneuter irakischer Repression auch materielle Versorgung und medizinische Hilfe zukommen ließ. Während sich die humanitäre Situation der Flüchtlinge verbesserte, blieb ihr Status weiterhin ungesichert.
Die Anlage und Durchführung der Operation »Provide Comfort« zeigt, dass nicht die humanitären Erwägungen im Vordergrund standen. Die Menschenrechtsverletzungen des irakischen Regimes an der eigenen Bevölkerung wurden vom Weltsicherheitsrat und den Alliierten erst zur Kenntnis genommen, als es zu einer grenzüberschreitenden Massenflucht in die Nachbarstaaten gekommen war. Von Anbeginn sollte nur einem Teil der Betroffenen direkte Unterstützung gewährt werden. Die Intervention orientierte sich ausschließlich an den Erfordernissen der Türkei, während die Flüchtlingsströme in den Iran schlicht ignoriert wurden, obwohl der Iran die Hauptlast der Flüchtlingsbewegungen zu tragen hatte. Das erklärte Ziel – Schutz der kurdischen Bevölkerung – war mit den Motiven der Interventionskräfte nicht deckungsgleich. Politische Erwägungen dominierten die humanitären Erfordernisse.
Wenden wir uns nun den Langzeitwirkungen der humanitären Intervention zu. Gängig ist sowohl in der Tagespresse als auch in der wissenschaftlichen Literatur die Vorstellung, dass es seit den Tagen von »Provide Comfort« im Nordirak eine Schutzzone für die kurdische Bevölkerung gäbe. Manche Autoren sprechen sogar von einem UN-Protektorat. Die Begrifflichkeit »Protektorat« ist für den Nordirak vollkommen unzutreffend. Die UN erhielt nie ein förmliches Mandat zur Vertretung der Region. Auch faktisch übernahm die UN weder die Außenvertretung der Region noch eine militärische Schutzfunktion. Die UN-Guards erfüllten keineswegs Schutzfunktionen für die Zivilbevölkerung, wie gelegentlich behauptet wird. Obendrein übernahm die UN keinerlei direkte Verantwortung für die Verwaltung und Ökonomie der kurdischen Region, wenn sie auch mittels der durch ihre Unterorganisationen durchgeführten Hilfsprogramme einen erheblichen Einfluss gewann. Eine Protektoratslösung – wie immer sie auch zu beurteilen wäre – hätte der Region einen offiziellen völkerrechtlich verbindlichen Status verliehen, aber genau dies ist nicht erfolgt. Die kurdische Seite hat hilflose Versuche unternommen, die UN über das Einklagen eines Protektoratstatus zur Übernahme einer größeren Verantwortung für Irakisch-Kurdistan zu übernehmen. An den undefinierten Status ändert auch die treuhänderische Verwaltung der Gelder nichts, die der autonomen Region aus den »oil for food«-Verkäufen zugedacht sind. Allenfalls könnte man von einem Teilmandat der UN für humanitäre Fragen sprechen. Dies blockiert allerdings längerfristig die Lösung der anstehenden politischen Frage.
Vollkommen unklar bleibt, wie die angebliche Schutzzone definiert sein soll. Wer hat ihre Grenzen festgelegt? Vor welchen Gefahren genau soll diese Zone schützen? Ist die Schutzzone gleichzusetzen mit der Flugverbotszone? Diese umfasst aber nur etwas mehr als die Hälfte des unter kurdischer Kontrolle stehenden Gebietes. Soll die Schutzzone dann explizit für den anderen Teil nicht bestehen? Oder ist mit der Schutzzone der »safe haven« gemeint, der während der Operation »Provide Comfort« in der Provinz Dohuk angelegt wurde? Dieser »sichere Hafen« war spätestens mit dem Abzug der alliierten Bodentruppen aus Irakisch-Kurdistan im Sommer 1991 hinfällig.
So imaginär wie die Schutzzone ist auch der von ihr ausgehende Schutz für die Bevölkerung. Während eines der zentralen Anliegen der Resolution 688 die ungehinderte Durchführung von Hilfsprogrammen darstellte, blieben gerade deren Behinderungen durch das irakische Regime folgenlos.
Zu keinem Zeitpunkt erfolgte eine Reaktion auf die vielfältigen, offenen und verdeckten Übergriffe der irakischen Armee. Am deutlichsten wurde dies beim Einmarsch der irakischen Armee in Arbil im Herbst 1996. Spätestens nach dem Hissen der irakischen Flagge auf dem kurdischen Parlament wurde das Gerede von einer Schutzzone für die kurdische Bevölkerung ad absurdum geführt. Selbstredend kamen die Alliierten auch ihren Schutzversprechungen gegenüber den Hilfsagenturen nur beschränkt nach. Demgegenüber reagierten Großbritannien und die USA sehr sensibel auf von der irakischen Armee provozierte, scheinbare oder tatsächliche Verletzungen des Luftraumes nördlich des 36. Breitengrades.
Die Schutzlosigkeit der Region offenbarte sich auch in den häufig wiederkehrenden türkischen und iranischen Übergriffen in der Region, die die Zivilbevölkerung vielfältig tangierten. Dabei handelte es sich zumindest seitens der Türkei nicht nur um kurzzeitige militärische Maßnahmen zur Aufstandsbekämpfung mit vorübergehend auch in Irakisch-Kurdistan operierenden militärische Einheiten, sondern um groß angelegte militärische Operationen mit bis zu 50.000 Soldaten, deren Dauer über mehrere Monate projektiert war. Sie wurden in keiner Weise von den Schutzmächten der Flugverbotszone oder den UN geahndet. Im Gegenteil war die Vernichtung der PKK doch offizielles Ziel der anglo-amerikanischen Politik, weshalb das Vorgehen des türkischen Militärs geduldet wurde.
Nachdem die Flüchtlinge die Türkei verlassen hatten, spielten auf der internationalen Bühne die Menschenrechte im Irak keine Rolle mehr. Zwar erstellte der Sonderberichterstatter der UN, Max van de Stoel, alarmierende Berichte, insbesondere auch aus dem Süden Iraks. Ein von ihm vorgeschlagenes Monitoring der menschenrechtlichen Situation im Irak – ähnlich den Waffeninspekteuren – wurde aber nie realisiert. Ansonsten wird, wie in den Jahren vor dem Golfkrieg, die menschenrechtliche Situation im Irak von der internationalen Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Wen interessiert schon die unverändert fortgesetzte Vertreibung der turkmenischen und kurdischen Bevölkerung aus den Erdölfördergebieten. Die Diskussion über die Verletzung der Menschenrechte im Irak zu vernachlässigen, entspricht durchaus dem Kalkül, diese Debatte nicht allzu intensiv zu führen, da sie auch Verbündete der USA wie die Türkei, Saudi-Arabien oder Kuwait tangieren könnte.
Graduell hat sich die Situation für die in der autonomen Region lebenden Menschen trotz aller schweren Rückschläge im Vergleich zum übrigen Irak gebessert, da sie zumindest vorübergehend dem unmittelbaren Zugriff des Baath-Regimes entzogen wurden. Dennoch haben die 1991 abgegebenen Schutzversprechen der Alliierten zu keinem Zeitpunkt ein definiertes Mindestmaß an Sicherheit garantiert. Vielmehr war der labile Schutz den ständig wechselnden politischen Gegebenheiten unterworfen.
Man kann also getrost davon ausgehen, dass humanitäre Erwägungen mit wachsendem zeitlichen Abstand von der Flüchtlingskatastrophe 1991 nur noch eine untergeordnete Rolle für die Motivation der US-Politik spielten. Das Schutzversprechen, das sich in Form der Flugverbotszone manifestierte, diente nur noch zur Begründung der eigenen Politik. Sie diente dazu, das Zentrum Iraks zu kontrollieren, während das Randgebiet Kurdistan eigentlich uninteressant wurde, solange es nicht mit der Politik des für die USA wichtigen Bündnispartners Türkei interferierte. Die Instrumentalisierung kurdischer Schutzinteressen steht in einer Tradition US-amerikanischer Politik, die Anfang der siebziger Jahre vorübergehend den kurdischen Widerstand benutzte, um das Regime im eigenen geopolitischen Interesse zu destabilisieren, und ihn dann baldmöglichst fallenließ. „Das kaum etablierte Novum »humanitäres Interventionsrecht« läuft so Gefahr, zur Legitimation eines unilateralen Interventionismus zu verkommen, der in der Folge der Resolution 688 und unter Berufung auf moralische Werte der Sanktionierung durch den Sicherheitsrat nicht mehr bedarf.“10 Es ist fast müßig zu ergänzen, dass sich die USA gegenüber der UN bzw. der Internationalen Gemeinschaft keineswegs verpflichtet fühlten, in irgendeiner Form Rechenschaft abzulegen.
Nach dieser Betrachtung der äußeren Akteure der »humanitären Intervention« wenden wir uns nun den internen Entwicklungen in Kurdistan-Irak zu. Van Gent urteilte rückblickend: „Im Nordirak sind nicht nur die Kurden gescheitert – gescheitert ist dort auch die Vision eines aus humanitären Gründen errichteten Protektorats, wie es unmittelbar nach der Auflösung der alten Weltordnung den westlichen Regierungen vorschwebte. Um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, hatte die Allianz die Schutzzone für die kurdischen Flüchtlinge errichtet. Die internationale Gemeinschaft versagte aber, weil sie gleich danach nicht mehr wusste, was sie mit ihrem eigenen Werk weiter anfangen sollte. Als es darum gegangen wäre, im Nordirak eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen, hat die Welt die Kurden völlig ihrem Schicksal überlassen.“11
Abgesehen davon, dass die humanitäre Katastrophe bereits vor der Errichtung der »Schutzzone« eingetreten war, ist diese Sichtweise noch aus einem anderen Grund problematisch. Sie unterstellt eine humanitäre »Vision«, die die Erfordernisse geschundener Volksgruppen, in diesem Fall der kurdischen, in der Vordergrund aller Überlegungen stellt. Davon kann allerdings 1991 im Irak keine Rede sein. Umgekehrt: Die humanitäre Intervention erfolgte, um das Flüchtlingsproblem der Türkei zu lösen. Zu keinem Zeitpunkt beabsichtigten die Interventen sich ernsthaft mit den Ursachen des kurdisch-irakischen Konfliktes zu beschäftigen. Mit der Beschneidung der irakischen Souveränität wurde eben gerade nicht der Versuch unternommen, die Folgen der willkürlichen kolonialen Grenzziehung für die kurdische Bevölkerung bei der Errichtung des irakischen Staat abzumildern. Entsprechend wurde nicht einmal ansatzweise nach Lösungen für die kulturellen, sozioökonomischen und ethnischen Verwerfungen gesucht.
Selbst in weniger grundsätzlichen Fragen flüchtete man sich stattdessen in einen politische Entscheidungen verdrängenden Humanitarismus. Bozarslan fasste die Entwicklung treffend zusammen: „Die Hilfsoperation hat aber zugleich ein System geschaffen, dem die Humanität als Ersatz für Politik diente und politische Entscheidungen – aber auch wirtschaftliche – auf unbestimmte Zeit vertagt wurden. Die neue Ordnung, die im irakischen Kurdistan geschaffen wurde, bestand in der Verwaltung der Tagesgeschäfte.“12 Nur waren angesichts der Hinterlassenschaften von zwei Jahrzehnten Baath-Diktatur die Probleme in Irakisch-Kurdistan so drängend, dass dieser politische Absentismus verheerend wirkte. Der Westen schien dagegen wenig geneigt zu sein, der humanitären Intervention ein Projekt der politischen Selbstbestimmung folgen zu lassen. Der gewählten Regionalregierung wurde eine internationale Anerkennung – in welcher Form auch immer – verweigert und sie somit delegitimiert. Nicht einmal international verbürgte Garantien für eine zukünftige Autonomie Irakisch-Kurdistans in dem irakischen Staatswesen standen auf der Tagesordnung. Diese Frage sollte offen gelassen werden, diesbezügliche Anstrengungen von kurdischer Seite waren vergebens. Selbst nach dem Desaster des internen Krieges war man seitens der USA lediglich darauf bedacht, einen Waffenstillstand zwischen den Parteien zu vermitteln. Die Erfordernis eines umfassenden Konzeptes der Konfliktlösung, das sich auf die relevanten gesellschaftlichen Kräfte in Irakisch-Kurdistan stützte und Gewalt abbauende sowie präventive Momente beinhaltete und letztlich den Aufbau demokratischer Strukturen ermöglichen sollte, wurde nicht gesehen.
Über Jahre hinaus war Irakisch-Kurdistan abhängig von Hilfsprogrammen, die zwar das Überleben sicherten, eine Entfaltung der in der Region vorhandenen ökonomischen Potenziale allerdings nicht zuließen. Langfristige Aufbauprojekte sind in Nothilfeprogramme nicht zu verwirklichen. Unter diesen Bedingungen der anhaltenden politischen und ökonomischen Instabilität wurden vorwiegend solche Geschäfte getätigt, die kurzfristig Gewinn versprachen. Die negative wirtschaftliche Dynamik verstärkte sich noch dadurch, dass der Produktionsanreiz insbesondere in der Landwirtschaft durch Hyperinflation und/oder Importe zunichte gemacht wurde. Die kurdischen Akteure fanden weder Instrumente um wesentlichen Einfluss auf die monetäre Krise zu nehmen, noch konnten sie den Import den Bedürfnissen der regionalen Ökonomie anpassen.
Die Hilfspolitik trug ungewollt zur Reproduktion überkommener gesellschaftlicher Verhältnisse bei. Davon profitierten neben einer schmalen Schicht von Parteifunktionären korrumpierbare Mittelschichten und Aghas.
Unter den Gegebenheiten der Hilfsprogramme konnte keines der drängenden politischen, sozialen oder ökonomischen Kernprobleme durch die Intervention angegangen, geschweige denn gelöst werden. Die politische Handlungsunfähigkeit wurde begleitet von ökonomischer Destablisierung und sozialer Fragmentierung. Regional verstärkten sich die Gegensätze zwischen Badinan und Soran.
Durch das (doppelte) Embargo wurden diese Prozesse noch in verhängnisvoller Weise verschärft. Die herrschenden politischen Gruppen sahen sich gezwungen, die Organisation der Devisenbeschaffung und benötigter industrieller Produkte an die Parallelwirtschaft zu delegieren. Der schwache, in zahlreichen Bereichen nicht existente Staat überlies die Regulierungsfunktionen der informellen Wirtschaft. In diese sind neben Stammesverbänden, ehemaligen mustashar-Führern und Unternehmern insbesondere auch die Parteiführungen eingebunden. Die Parteien versuchten um ihre Macht abzusichern, Teile der Ökonomie zu kontrollieren oder sich mit Segmenten auch der Parallelwirtschaft zu verbünden. Besonders deutlich wird dies in den städtischen Regionen. Die Kontrolle der Großstädte führte zu einem erheblichen politischen und ökonomischen Machtzuwachs für die kurdischen Parteien, die ihren Handlungsspielraum spürbar vergrößern konnten. Nicht zuletzt waren die Großstädte ein wichtiges Rekrutierungsfeld für die Parteimilizen. Um ihr Funktionieren zu sichern, mussten sich die Parteien der Parallelökonomie bedienen.
Das Entstehen der Parallelwirtschaft, die nicht mehr kontrollier- und steuerbar ist, wurde dadurch begünstigt, dass die kurdische Verwaltung den vormals starken irakischen Staat, der Teile der Erdölrente dirigistisch verteilte, nicht ersetzen konnte. Die fehlende Möglichkeit der kurdischen Regierung zur Wirtschaftsregulation begünstigt zudem, dass auch Ressourcen aus den Hilfsprogrammen in der informellen Ökonomie verschwanden. Das Wirtschaftsembargo tat ein Übriges, um undurchsichtige Parallelökonomien und kriminelle Strukturen zu fördern.
Es verwundert wenig, dass alte, nur mühsam kaschierte Widersprüche zwischen den beiden großen kurdischen Parteien bei dem Kampf um die Ressourcen verschärft auftraten und schließlich in den Bürgerkrieg mündeten. Entsprechend sind auch alle Faktoren, die zu dem Bürgerkrieg führten, virulent und werden augenblicklich durch »oil for food«-Programme übertüncht. Dies festzustellen bedeutet auch darauf zu verweisen, dass die Folgen der Operation »Provide Comfort« nicht allein für die Lage in Irakisch-Kurdistan verantwortlich sind. Eine der wesentlichen Determinanten für das Scheitern der Regionalregierung und der sich einstellenden Agonie in Irakisch-Kurdistan war die innere Verfasstheit der kurdischen Politik. Diese erwies sich als unfähig, arbeitsfähige Strukturen einer »civil society« aufzubauen.
Zur Politik der Hilfsorganisationen
Die Hilfspolitik trug wenig dazu bei, diese Defizite zu überwinden. Im Gegenteil schwächte sie in der Tendenz die demokratisch legitimierten Institutionen, indem diese bei der Implementierung der Hilfsprojekte umgangen wurden. Eine gesellschaftliche Kontrolle der Aktivitäten von Hilfsorganisationen fand nicht statt. Diese in Irakisch-Kurdistan verfolgte Politik der Privatisierung der Hilfe scheint ein internationales Phänomen sowohl der Katastrophenhilfe als auch der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit nach Ende des Kalten Krieges zu sein.
Die über ein Jahrzehnt währende Abhängigkeit von externer Hilfe verhinderte neben dem Wirtschaftsembargo die Mobilisierung gesellschaftlicher Ressourcen zur Überwindung der anstehenden Probleme. Stattdessen wurden oftmals externe, von Hilfsagenturen oder UN-Organisationen entwickelte Lösungswege den Betroffenen übergestülpt. Möglichkeiten des Empowerments, also Möglichkeiten zum eigenständigen Handeln, wurden dadurch genommen.
Diese Mängel der Hilfspolitik scheinen nicht zufällig zu sein, sondern Ausdruck zweier unterschiedlicher Akzentverschiebungen, von denen in den letzten 15 Jahren insbesondere die NGOs betroffen sind. Zum einen zeichnet sich eine Entwicklung ab, die wegführt von der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit hin zur Stärkung der Not- und Katastrophenhilfe und zum anderen von der humanitären Hilfe zur humanitären Intervention. Im Hinblick auf die humanitäre Intervention ergeben sich dabei für NGOs seit der Operation »Provide Comfort« interessante Perspektiven. Die US-Army konnte eindrucksvoll logistische, kommunikations- und transporttechnische Leistungen darstellen, die die Möglichkeiten von UN und Hilfsorganisationen bei weitem übertrafen. Daran wird die grundsätzliche Problematik deutlich, dass die Entscheidung über humanitäre Interventionen in vielen Fällen Großmächten vorbehalten sein wird, da nur sie über die entsprechende militärische Ausrüstung verfügen. Allerdings erwies sich »Provide Comfort« auch als teuerste humanitäre Operation der US-Armee seit dem zweiten Weltkrieg. Dies führte den Militärs vor Augen, dass sie sich besser auf ihre »Kernkompetenz« militärischer Sicherheit konzentrieren und dabei die humanitäre Hilfe den Hilfsorganisationen überlassen sollten. NGOs müssen sich fragen lassen, inwieweit sie sich in entsprechende militärische Planungen einbinden lassen. Dabei wird es für die NGOs wenig Gestaltungsmöglichkeiten geben.
Die, der zunehmenden Dominanz der Nothilfe geschuldete, Politik des schnell umgesetzten Geldes und der kurzfristigen Projekte – und dafür ist Irakisch-Kurdistan ein markantes Beispiel – verstellt den Blick auf soziale Verhältnisse und Konflikte.
Zu hinterfragen bleibt der zunehmende Feuerwehrcharakter der NGO-Arbeit. Dem ist ein Konzept entgegenzusetzen, das wieder verstärkt auf Beseitigung von Armut und sozialer Ungerechtigkeit als Ursache von Gewalt fokussiert.
Es drängt sich weiterhin die Frage auf, ob die drei geschilderten Trends Militarisierung der humanitären Arena, Privatisierung der Hilfe und Verschiebung der Ressourcen zugunsten der Katastrophenhilfe zufällig stattfinden oder ob in Zeiten des Neoliberalismus die Notwendigkeit vermehrter Interventionen besteht, da die Länder am unteren Ende der Pyramide nirgendwo hingehen können, um sich Überschüsse anzueignen oder um die mit dem Marktwachstum einhergehenden Dysfunktionen zu exportieren.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, die humanitäre Intervention, die einen schwer wiegenden Eingriff in die Souveränität des Iraks bedeutete, konnte einer akuten Notsituation, an deren Aufkommen die Interventen selbst beteiligt waren, abhelfen. Das Instrument der humanitären Intervention wurde aus reinen tagespolitischen Opportunitätsgründen eingesetzt. Wie der weitere Verlauf zeigte, diente sie nicht dazu, den universellen Anspruch der Menschenrechte in Irakisch-Kurdistan durchzusetzen. Im Rückblick nach 10 Jahren erweist sie sich als vollkommen untauglich, die sozialen Ursachen des Konfliktes zu lösen, und generierte geradezu als Politikersatz. Sie war nicht in der Lage, lokale und regionale Kräfte zu stärken, um die anstehenden Konfliktfelder zu bearbeiten. Zehn Jahre nach Operation »Provide Comfort« ist für die Bevölkerung Irakisch-Kurdistans keine Zukunftsperspektive erkennbar.
Es stellt sich die Frage, welche neuen Formen die internationale Gemeinschaft finden kann, um auf die Verletzung fundamentaler Menschen- und Minderheitenrechte oder eine entsprechende Androhung zu reagieren. Anzustreben wäre primär ein System von präventiven, gewaltlosen Maßnahmen, das möglichst mit der Zustimmung aller Beteiligten wirkt. Ähnlich wie im Bereich der humanitären Hilfe die Stellung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes international kodifiziert ist, wären entsprechende präventiv wirkende neutrale Institutionen völkerrechtlich abzusichern. Falls es im Einzelfall nicht möglich sein sollte, grobe Völkerrechtsverletzungen zu verhindern, wären als ultima ratio militärische Interventionen in die internen Angelegenheiten eines Staates zu rechtfertigen, wenn sie klar umrissenen Regeln und Maßstäben unterworfen wären. Diese Regeln müssten universell sein, sie dürften sich nicht entlang von Machtverhältnissen konstituieren und müssten international von einem neutralen Gremium legitimiert sein. Momentan ist auf der internationalen Bühne keine Kraft zu erkennen, die dies durchsetzen könnte. In der Anlage und Durchführung verweist die Operation »Provide Comfort« in eine entgegengesetzte Richtung.
Anmerkungen
1) Mit »zweiten Golfkrieg bezeichnen wir – wie allgemein üblich – den Krieg, der vom 17.01.1991 bis zum 28.02.1991 zwischen einer militärischen Allianz unter Führung der USA und dem Irak ausgetragen wurde. Der »erste Golfkrieg« ist der iranisch-irakische Krieg von September 1980 bis zum 20.08.1988.
2) Die Anführungszeichen in der Überschrift zu »humanitäre Intervention« sollen die Problematik dieses allseits verwendeten Begriffs verdeutlichen. Im Text selbst wird der Begriff aber ohne Anführungszeichen verwandt.
3) Bley, Helmut: Was ist alt, was neu am Interventionsproblem? in: Peripherie Nr. 55/56, 1994, S. 12
4) Interview mit BBC Radio 4 am 19.08.1991, zit. nach Ramsbotham, Oliver und Woodhouse Tom: Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, Cambridge 1996, S.78
5) UNICEF Pressemitteilung Köln 12.08.1999 S.1
6) FR 23.12.1998
7) Ibrahim, Ferhard: Der Irak vor der regionalen Reintegration? Hoffnungen auf das Ende der Sanktionen, in: Betz, Joachim/Brüne, Stefan/Deutsches Übersee Institut (Hg.): Jahrbuch 3. Welt 1999, München 1998, S. 141
8) Vgl. Statistisches Bundesamt: Länderbericht Golfstaaten 1991, Wiesbaden1991, S. 47 ff., landwirtschaftliche Produktionsziffern 1975- 1985; vgl. Metz, Helen Chapin(Ed..): Iraq: A Country Study, Library of Congress, Washington D.C. 1990
9) Pape, Matthias: Humanitäre Intervention – Zur Bedeutung der Menschenrechte in den Vereinten Nationen, Baden-Baden 1997, S. 177
10) Ruf, Werner: Die neue Welt-UN-Ordnung – Vom Umgang des Sicherheitsrates mit der Souveränität der »Dritten Welt«, Münster 1994, S. 119
11) van Gent, Werner: Der Geruch des Grauens, Zürich 2000, S. 178.
12) Bozarslan, Hamit: Von der Humanität zum Bürgerkrieg; in: der überblick 3/97, S. 42
Wer wir sind
»Haukari e.V.« wurde Anfang der neunziger Jahre mit dem Ziel gegründet, unabhängig von tagespolitischer Aktualität eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zur Situation in Irakisch-Kurdistan zu leisten, die Bemühungen von KurdInnen, nach jahrzehntelanger Diktatur demokratische Strukturen aufzubauen, solidarisch zu begleiten und gleichzeitig vor Ort soziale Initiativen und Projekte zu unterstützen.
In Kurdistan-Irak selbst unterstützt »Haukari e.V.« soziale Projekte, insbesondere im Bereich präventiver Gesundheitsförderung und Frauenförderung. So wurde 1996 das Frauenzentrum KHANZAD in Sulaimaniya eröffnet, das seitdem kontinuierlich unterstützt wird.
In der Öffentlichkeitsarbeit setzt »Haukari e.V.« sich für eine politische Lösung in Kurdistan-Irak ein. Weitere Schwerpunkte sind die Thematisierung der Anfal-Kampagnen der irakischen Regierung gegen die kurdische Bevölkerung 1988 und die heutige Situation der Überlebenden.
Zum Thema Flucht und Fluchthintergründe von KurdInnen hat »Haukari e.V.« Ende 1997 eine Fotoausstellung erstellt, die in mehreren Städten in der BRD gezeigt wurde und auch weiterhin ausgeliehen werden kann.
Kontakt: Haukari e.V., Falkstrasse 34, 60487 Frankfurt, Tel. 069 – 7076 0278, Email: HaukariFfm@aol.com Internet: www.Haukari.de
Dr. Bernhard Winter und Susanne Bötte, HAUKARI e.V., Frankfurt/M.
Der vorliegende Artikel ist eine gekürzte Fassung der Veröffentlichung: Kurdistan-Irak: Untergehen im sicheren Hafen – Studie über eine »humanitäre Intervention«, die im Herbst 2001 im VAS Verlag, Frankfurt erscheint.