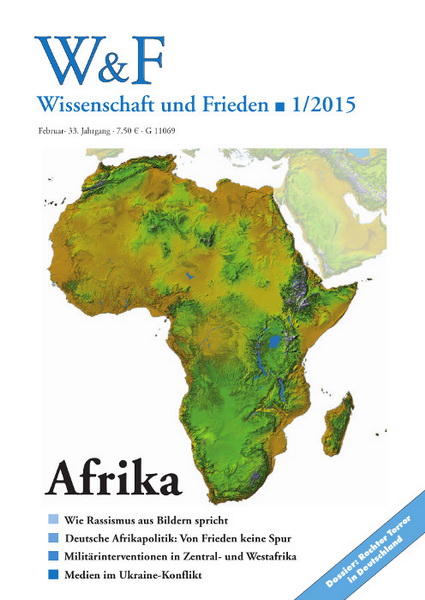Rechter Terror in Deutschland
von Ulrich Chaussy, Elke Grittmann, Ayla Güler Saied, Heike Kleffner, Tanja Thomas und Fabian Virchow
Beilage zu Wissenschaft und Frieden 1-2015
Herausgegeben von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden in Zusammenarbeit mit Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus der FH Düsseldorf (FORENA)
zum Anfang Rechter Terror in Deutschland
von Fabian Virchow
Im Januar 2015 wurde vor dem Münchner Oberlandesgericht erstmals der Nagelbomben-Anschlag verhandelt, den der rechtsextreme, terroristische »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) im Jahr 2004 auf die Keupstraße in Köln verübt hatte. In den Aussagen der Anwohner und Anwohnerinnen, die im Prozess als Zeugen und Nebenklägerinnen auftreten, spiegelt sich auch heute noch – mehr als zehn Jahre danach – die traumatische Erfahrung wider, die dieser Terrorakt verursacht hat. Ebenfalls sehr nachdrücklich wird vor Gericht von den diskriminierenden Ermittlungsmethoden der Polizei berichtet, die zur sozialen Isolation der Betroffenen beigetragen haben.
Das Gerichtsverfahren wird aufgrund der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft und der Regularien solcher Prozesse nur einen begrenzten Beitrag zur Aufklärung des NSU-Komplexes leisten; dennoch ist es wichtig, dass von den Nebenklagevertretungen immer wieder nach der Entstehung des gewalttätigen neonazistischen Milieus gefragt wird, das den NSU durch Unterstützungsleistungen (Bereitstellung von Papieren, Geld, Unterkunft … ) getragen und damit seine Morde und Anschläge erst ermöglicht hat. Wie in den Berichten der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Thüringen und Sachsen auch, kommt dabei immer wieder zur Sprache, dass V-Leute der Nachrichtendienste in wohl jeder bedeutenderen neonazistischen Struktur der 1990er Jahre in den Spitzenpositionen vertreten waren. Damit waren sie auch über die Konzepte rechten Terrors im Bilde, die in der Szene intensiv diskutiert wurden.
Hier spätestens findet die vor etwa drei Jahren von Kanzlerin Angela Merkel im Rahmen der Gedenkfeier für NSU-Opfer in Berlin versprochene restlose Aufklärung ihre Grenzen. Ob als »Erinnerungslücke«, in Form geschredderter Akten oder als fehlende Aussagegenehmigung – eine tief greifende Aufklärung über den Stellenwert staatlichen Handelns findet nicht statt. Zwar haben insbesondere die Nachrichtendienste einen Legitimationsverlust hinnehmen müssen, zu einer grundlegenden Revision dieser Strukturen ist es in der Folge jedoch nicht gekommen.
Dabei zeigt ein Blick zurück – zu denken ist beispielhaft an das Attentat auf das Münchner Oktoberfest oder den Doppelmord in Erlangen 1980, aber auch an den Brandanschlag in Lübeck 1996 –, dass die These von den »Einzeltätern« oder die Verdächtigung der Opfer selbst in der polizeilichen Ermittlungsarbeit durchaus Tradition hat. Dass dies zuweilen öffentlich und wirksam thematisiert werden konnte, ist insbesondere den Aktivitäten antifaschistischer und antirassistischer Gruppen sowie engagierten Jurist*innen und Journalist*innen zu verdanken.
Zahlreiche neonazistische Gewalttaten, wie etwa die Sprengstoffanschläge gegen den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, (zu Lebzeiten sowie auf sein Grab) oder gegen die Ausstellung »Verbrechen der Wehrmacht« in Saarbrücken im Jahr 1999, sind bis heute nicht aufgeklärt. Dass die extreme Rechte (zum Teil legal) Zugang zu Sprengstoff und Waffen hat, ist immer wieder durch Razzien deutlich geworden. Bei über einhundert Neonazis kann der Haftbefehl nicht vollstreckt werden, weil die Personen abgetaucht sind.
Die neonazistische Szene ist von dem Strafprozess und den Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen nicht sonderlich beeindruckt; entsprechend gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche positive Bezugnahmen auf den NSU und Solidaritätsaktionen mit einzelnen Angeklagten. Im Januar 2015 konnte die Polizei in Köln gerade noch einen gewaltsamen Angriff von Neonazis auf eine Gedenkveranstaltung für die NSU-Opfer verhindern.
Einwanderung, Asyl, Sinti und Roma sowie eine vorgebliche »Islamisierung« waren in Deutschland in den vergangenen zwei bis drei Jahren die Themen, mit denen die extreme Rechte am meisten Unterstützung und Zuspruch mobilisieren konnte – sei es bei Wahlen oder bei Demonstrationen, wie im sächsischen Schneeberg oder in Berlin. Zugleich nahm aus diesem Spektrum die Zahl der gewalttätigen Angriffe auf Menschen zu, denen aufgrund äußerlicher Merkmale zugeschrieben wurde, Migrant, Flüchtling oder Muslim bzw. Muslima zu sein.
Im Unterschied zu den späten 1980er und frühen 1990er Jahren reicht – wenn auch häufig noch widerwillig und widersprüchlich bzw. vor allem ökonomischem Kalkül folgend – die Erkenntnis, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist und auch bleiben wird, inzwischen bis in relevante Teile der CDU. Zugleich nimmt die Zahl der Länder, die vom Bundesinnenministerium als »sicheres Herkunftsland« deklariert werden, ständig zu, und die Instrumente zur Abschreckung und Kontrolle insbesondere außereuropäischer Flüchtlinge werden fortlaufend verfeinert und erweitert. So bleiben diese Menschen eine Gruppe der »Anderen«, die staatlicherseits als nicht willkommen und nicht akzeptiert markiert werden.
Wie die Ende 2014 insbesondere in Sachsen an Dynamik gewinnenden Aktivitäten der »PEGIDA« (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) verdeutlichen, sind Teilen der Bevölkerung selbst minimale Zugeständnisse und Schritte in Richtung auf eine religiös vielfältige und interkulturelle Gesellschaft schon zu viel. Die extreme Rechte sieht in diesen Aktionen eine große Chance zur Verankerung.
Der Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus der Fachhochschule Düsseldorf (FORENA) existiert seit 1987. Die Auseinandersetzung mit der organisierten extremen Rechten, mit Rassismus und Antisemitismus ist Teil des Lehrangebots im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften. Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich z.B. mit der »Alternative für Deutschland« (AfD) sowie der Wirkung von Verboten extrem rechter Vereinigungen. Im Zweijahresabstand vergibt FORENA Preise an thematisch einschlägig arbeitende junge Wissenschaftler*innen. Zudem entsteht am zukünftigen Standort der FH ein Erinnerungs- und Lernort, da auf dem Gelände in den frühen 1940er Jahren der Sammelpunkt der jüdischen Bevölkerung zur Deportation war. FORENA gibt bei Springer/VS eine Buchreihe zur extremen Rechten heraus und informiert regelmäßig im FORENA-FORUM über seine Arbeit.
Mehr Informationen unter forena.de
zum Anfang Gesellschaftlicher und staatlicher Umgang mit NSU und rechter Gewalt
von Heike Kleffner
Die gemeinsame Bewertung der Arbeit der Ermittlungsbehörden im NSU-Komplex, die der Bundestagsuntersuchungsausschuss nach knapp eineinhalb Jahren Beweisaufnahme und Expertenanhörungen im August 2013 traf, fiel harsch aus: „Die Gefahr des gewaltbereiten Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus wurde vom polizeilichen Staatsschutz völlig falsch eingeschätzt. Die polizeiliche Analyse rechtsextremistischer Gewalt war fehlerhaft, das Lagebild dadurch unzutreffend.“ 1 Darüber hinaus waren sich die Abgeordneten von CDU bis LINKS-Fraktion einig: Bei den über ein Jahrzehnt lang auf »Organisierte Kriminalität« türkisch/kurdischen Hintergrunds fokussierten erfolglosen Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern der so genannten »Ceska-Mordserie« an neun Kleinunternehmern türkisch, kurdischer und griechischer Herkunft und den drei inzwischen dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugerechneten Bombenanschlägen mit mehr als zwei Dutzend Verletzten hätte „ein unbefangener Blick auf die Gesamtheit aller Opfer es jedenfalls nahegelegt, intensiv in Richtung eines möglichen rechtsterroristischen oder rassistischen Tathintergrunds zu ermitteln. Sehr kritisch betrachtet der Ausschuss die Widerstände, denen die Ansätze zu einer solchen Erweiterung des Blickfelds und Neuausrichtung der Schwerpunkte im Kreis der Ermittler begegneten.“ Denn: „Die wenigen Merkmale, die tatsächlich alle Opfer gemeinsam haben – Berufsgruppe, Lebensalter, Geschlecht, ausländische Herkunft – konnten sie mit keiner bekannten kriminellen Organisation in Konflikt bringen. Nur eine rassistische Tatmotivation traf tatsächlich auf alle Opfer zu.“ 2
Vor dem Hintergrund, dass zwischen 1990 und 2014 nach Recherchen von Tagesspiegel und ZEIT Online mindestens 164 Menschen durch rassistisch oder politisch rechts motivierte Gewalt zu Tode gekommen sind3 und dass bei den rund 18.000 politisch rechts motivierten Gewalttaten, die die Behörden in diesem Zeitraum registrierten, mehrere tausend Menschen angegriffen, verletzt und zum Teil dauerhaft geschädigt wurden,4 ist ein genauer Blick auf die unterschiedlichen Phasen und Strategien notwendig, mit der staatliche Strafverfolgungsbehörden seit 1990 auf politisch rechts und rassistisch motivierte Gewalt reagiert haben. Denn ein Ende dieses „unerträglichen Zustands, dass wir täglich zwei bis drei rechte Gewalttaten in Deutschland haben“ (ex-BKA-Präsident Jörg Ziercke vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag) ist nicht erkennbar. Im Gegenteil: Im Jahr 2014 hat sich alleine die Anzahl von Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.5 Zur Jahreswende 2014/2015 verübten mutmaßlich neonazistische Täter in Dortmund und Berlin gezielt Anschläge auf die Autos und Büros von JournalistInnen und Abgeordneten der SPD und der LINKEN, die als »politische Gegner« angegriffen wurden.6 Kurzum: Das Selbstbewusstsein und die Militanz der Neonazibewegung sind ungebrochen und sie werden sowohl durch den Zuspruch für die »Pegida«-Bewegung als auch durch die mediale und politische Diskussion über den Umgang mit dieser extrem rechten und rassistischen Bewegung verstärkt.
Notwendig ist daher eine kritische Bestandsaufnahme, ob mit der Selbstenttarnung des NSU und der parlamentarischen und justiziellen Aufarbeitung des NSU-Komplexes sowie den insgesamt 47 gemeinsamen Empfehlungen, die der Bundestagsuntersuchungsausschuss für Reformen im Bereich Polizei, Justiz und Geheimdienste ausgesprochen hat, die fatale Mischung aus Ignoranz, Inkompetenz und Verharmlosung, mit denen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste im wiedervereinigten Deutschland auf militante neonazistische Strukturen reagierten und die die rassistische Mord- und Anschlagsserie des NSU erst ermöglichten, ein Ende gefunden hat und die Reformversprechen von Innenpolitikern und Polizeiführung eine veränderte Praxis zur Folge haben. Oder kürzer gefasst: Führt das Staatsversagen im NSU-Komplex, die „schwere Niederlage der Sicherheitsbehörden“ (Heinz Fromm), zu einer dringend notwendigen Zäsur im gesellschaftlichen und staatlichen Umgang mit politisch rechts motivierter Gewalt und neonazistischer Organisierung? Oder setzen sich bei den Geheimdiensten und in Polizei und Justiz diejenigen durch, die den Nationalsozialistischen Untergrund für eine Art Betriebsunfall oder GAU halten, der sich – weil er in der Rechtsterrorismus-Analyse von polizeilichem Staatsschutz und Bundesamt für Verfassungsschutz ohnehin nicht vorgesehen war – nicht wiederholen könne.
Unwirksam: Staatliche und gesellschaftliche Reaktionen auf neonazistische Gewalt
Insgesamt lassen sich für das vereinigte Deutschland und den Zeitraum seit 1990 vier Phasen der Entwicklung der extremen Rechten festmachen.
- Erste Phase: Expansion und öffentlich inszenierte und geduldete Gewalt (von 1990 bis Mitte der 1990er Jahre) mit rassistischen Pogromen in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und Hunderten von Brandanschlägen.
- Zweite Phase: Modernisierung der extrem rechten Organisationen – wesentlich angestoßen und getragen vom »Bloods&Honour«-Netzwerk und dessen bewaffnetem Arm »Combat 18« –und des Aufbaus rechtsterroristischer Strukturen wie des NSU oder der »Nationalrevolutionäre Zellen« (bis zur Jahrtausendwende 2000) mit Dutzenden von Sprengstoffanschlägen, wie beispielsweise auf die Ausstellung »Verbrechen der Wehrmacht« in Saarbrücken 1999.7
- Dritte Phase: Konsolidierung sowohl der legalen Organisationen – inklusive einer Expansion parlamentarischer Präsenz durch einige Hundert Abgeordnete von DVU und NPD in Kommunalparlamenten und zeitweise einem halben Dutzend Landtagen – als auch der militanten und rechtsterroristischen Strukturen, beispielsweise des NSU, der von September 2000 bis Juni 2007 in einem halben Dutzend Bundesländern mindestens zehn Menschen ermordete und mehr als zwei Dutzend schwer verletzte, aber auch beispielsweise in Brandenburg, wo die »Freikorps«-Bewegung nach einem halben Dutzend Brandanschlägen gegen migrantisches Kleingewerbe als terroristische Vereinigung nach §129a StGB verurteilt wurde.8
- Vierte Phase: Seit circa 2010 ein zweiter Modernisierungsschub der extremen Rechten, der verbunden ist einerseits mit einem Zerfall und Einflussverlust sowohl der NPD als auch der Generation erfahrener Neonazikader der »ersten Generation« wie Christian Worch, Thomas »Steiner« Wulff und Thorsten Heise. Stattdessen gewinnen seit einigen Jahren die militanten Netzwerke der »Freien Kameradschaften« und Bündnisse zwischen extrem rechten Hooligans, Rockern und Neonazis zunehmend an Bedeutung – verbunden mit einer neuerlichen Welle von Gewalt und Aktionismus, deren Einfluss und Aufbauarbeit nun in der Pegida- und Pro-Bewegung sowie den HoGeSa-Aktivitäten sichtbar wurden.
Die katastrophale staatliche und gesellschaftliche Reaktion auf die erste Phase der Expansion und der öffentlich inszenierten rassistischen Gewalt ist im Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag mit der Überschrift »Der Eindruck staatlicher Gleichgültigkeit verstärkt Radikalisierung«9 beschrieben. Der Untersuchungsausschuss kommt zu dem Schluss: „Die Bilder von Rostock-Lichtenhagen gingen nicht nur um die Welt, sondern vermittelten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich zu extrem rechten Jugendszenen hingezogen fühlten und sich in so genannten »Kameradschaften« organisierten, klare Botschaften: Auch bei schwersten Straftaten würde die Polizei nur zögerlich auf Seiten der Angegriffen einschreiten, eine effektive Strafverfolgung wäre kaum zu befürchten.“ 10
Die Kultur der Straflosigkeit11 und Schuldzuweisungen an die Opfer wurde flankiert von halbherzigen Organisations- und Vereinsverboten durch das Bundesinnenministerium und die Innenministerien der Länder, deren Unwirksamkeit nicht zuletzt darin deutlich wird, dass u.a. im Jahr 2000 das Neonazi-Netzwerk »Bloods&Honour« verboten wurde, dessen Aktivistinnen und Aktivisten aber nachweislich zu den zentralen UnterstützerInnen des mutmaßlichen NSU-Kerntrios Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe gehörten. Darüber hinaus rechtfertigten Kommunalpolitiker und Strafverfolgungsbehörden eine Politik der Verharmlosung angesichts organisierter neonazistischer Gewalt ab Mitte/Ende der 1990er Jahre – in diese Phase fällt auch die Entstehung von »No-go-Areas« – mit dem Verweis auf die Partei- und Organisationsverbote. Organisierte Neonazis waren und blieben für Geheimdienste und Polizei bestenfalls radikale »Einzeltäter«, mehrheitlich aber »die unpolitischen Jungs von nebenan« mit einer »Affinität« zu Waffen.
An dieser Sichtweise änderte sich auch durch den »Aufstand der Anständigen« infolge des neonazistischen Mordes an dem mosambikanischen Familienvater Alberto Adriano an Pfingsten 2000 in Dessau und des bis heute nicht aufgeklärten Anschlags auf zehn vorwiegend jüdische Zuwanderer aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion in Düsseldorf nichts. Unter der rot-grünen Bundesregierung kam es lediglich zu einem Paradigmenwechsel der »soft measures«: An die Stelle der akzeptierenden, täterzentrierten Sozialarbeit der 1990er Jahre rückten seitdem wechselnde Bundesprogramme mit Förderungen u.a. für Opferberatungsstellen, zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Rechts und Mobile Beratungsteams.
Auch in der Praxis der Strafverfolger gab es zur Jahrtausendwende durchaus wichtige Veränderungen – etwa durch die Reform der Kriterien für politisch rechts motivierte Straf- und Gewalttaten (PMK-Rechts) seitens der Innenministerkonferenz im Jahr 2001 –, die sich von einer Staatsschutz-Fokussierung lösten und stärker die Opferauswahl berücksichtigten. Dies war durchaus ein Paradigmenwechsel, auch wenn das neue Bewertungsverfahren in der polizeilichen Praxis der Länder sehr unterschiedlich angewandt wird.12 Das Grundsatzurteil des 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofs zur Bewertung von Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte als (versuchte) Tötungsdelikte aus dem Jahr 199413 oder Änderungen des Verwaltungsrechts als Reaktion auf neonazistische Aufmärsche zur Verherrlichung des Nationalsozialismus in den 2000er Jahren gehören im Bereich der Justiz ebenfalls zu wichtigen Veränderungen.
Doch mit den Al-Kaida-Anschlägen vom 11. September 2001 endete die kurze Phase der verstärkten Aufmerksamkeit für rechte Gewalt- und Terrortaten und ihre Einstufung als Bedrohung für gesellschaftliche Minderheiten – und damit für eine demokratische Gesellschaft. Insbesondere die Geheimdienste, aber auch Polizeibehörden, zogen explizit Ressourcen aus der Rechtsextremismusbekämpfung ab, Politik und Medien setzten andere Prioritäten, und im gesellschaftlichen Diskurs der 2000er Jahre machten die rassistischen Thesen von Thilo Sarrazin einen Diskurs der Ausgrenzung und Abwertung salonfähig.
Rechtsterrorismus und institutioneller Rassismus
In die dritte Phase, die Konsolidierung der legalen und bewaffneten Strukturen der bundesdeutschen Neonazibewegung ab der Jahrtausendwende, fällt auch die Mord- und Anschlagsserie des Nationalsozialistischen Untergrunds. Alle damit befassten Polizeieinheiten und Geheimdienste reagierten darauf einhellig: mit einer zum Teil über ein Jahrzehnt währenden Kriminalisierung und Stigmatisierung der Angehörigen der Ermordeten sowie der Verletzten der Bombenanschläge: Von Anfang an ließen sich die Ermittler von der Hypothese einer unbekannten kriminellen Organisation leiten, die ihrer Vorstellung zufolge aus einem migrantischen Milieu heraus agierte. Wahlweise – und je nach Biographie, Beruf oder Aufenthaltsstatus der neun ermordeten Männer – sollte es sich dabei um eine »Blumenmafia«, »Dönermafia« oder »Menschenschmugglerbande«, die PKK oder die »Türkische Hisbollah« handeln. Die Ehefrauen, Eltern und andere Angehörige der Mordopfer wurden über Monate und Jahre der Täterschaft verdächtigt, ihre Telefonanschlüsse abgehört, ihre Kraftfahrzeuge verwanzt. Die Tatsache, dass die Verdächtigten keine brauchbaren Hinweise auf mögliche Täter lieferten, wurde dann mit der Existenz eines milieutypischen »Schweigekartells« begründet.
Der institutionelle Rassismus, der sich durch die Tausende von Seiten Ermittlungsakten der so genannten »Besonderen Aufbauorganisation [BAO] Bosporus« zieht und der die bürgerlichen Existenzen der Angehörigen der Mordopfer und der Verletzten der Bombenanschläge zerstörte,14 sowie das konsequente Verschweigen und die Verharmlosung rechtsterroristischer Aktivitäten sind gleichermaßen für das komplette Scheitern der Ermittlungsbehörden im NSU-Komplex verantwortlich.
Dabei hatte insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) über zwei Jahrzehnte hinweg bei der Analyse rechtsterroristischer Organisationsansätze und Aktivitäten die Öffentlichkeit getäuscht und alles dafür getan, sowohl Warnungen aus dem Polizeiapparat – beispielsweise des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Bedeutung des Strategiepapiers »The Way forward – Der Weg zum Erfolg«, das innerhalb des internationalen »Bloods&Honour«-Netzwerks und in der deutschen Neonaziszene verbreitet wurde und Ende der 1990er Jahre den Aufbau bewaffneter klandestiner Terrorzellen propagierte – als auch von JournalistInnen sowie antifaschistischen Initiativen in den Wind zu schlagen. Getreu dem Motto: Rechtsterrorismus kann es in Deutschland nicht geben, weil das BfV alles im Griff hat.
Ein besonders eklatantes Beispiel für diese Mischung aus Hybris, Versagen und Verharmlosung sind die Antworten, die der damalige Vizepräsident des BfV und heutige Geheimdienstkoordinator Klaus Dieter Fritsche anlässlich der Verhinderung der Anschlagspläne auf die Synagoge in München durch Mitglieder der »Kameradschaft Süd« auf Nachfragen aus dem Bundesinnenministerium zur möglichen Existenz einer »Braunen RAF« im September 2003 zu Protokoll gab: „Bei einem Vergleich mit der RAF muss zumindest das wesentliche Merkmal dieser terroristischen Bestrebungen berücksichtigt werden. Die RAF führte ihren bewaffneten Kampf aus der Illegalität heraus. Das heißt, die Gruppe lebte unter falscher Identität, ausgestattet mit falschen Personaldokumenten und Fahrzeugdubletten in konspirativen Wohnungen. Dies erforderte ein hohes Know-how und ein Sympathisantenumfeld, das bereit war, den bewaffneten Kampf aus der Illegalität zu unterstützen. Zur Finanzierung dieses Kampfes wurden Raubüberfälle begangen. Absichten, einen Kampf aus der Illegalität heraus mit den damit verbundenen Umständen zu führen, sind in der rechten Szene nicht erkennbar. Es gibt derzeit auch keine Anhaltspunkte, dass eine solche Gruppe ein Umfeld finden würde, das ihr einen solchen Kampf ermöglicht. […] In der Presse wird angeführt, dass es im Rechtsextremismus sehr wohl ein potentielles Unterstützerfeld gebe. Hierzu wird auf drei Bombenbauer aus Thüringen verwiesen, die seit mehreren Jahren »abgetaucht« seien und dabei sicherlich die Unterstützung Dritter erhalten hätten. Dem ist entgegenzuhalten, dass diese Personen auf der Flucht sind und – soweit erkennbar – seither keine Gewalttaten begangen haben. Deren Unterstützung ist daher nicht zu vergleichen mit der für einen bewaffneten Kampf aus der Illegalität.“ 15
Zu diesem Zeitpunkt hatte der NSU schon mindestens drei Menschen ermordet sowie mehrere Banken überfallen, und nach zahlreichen Razzien mit Waffen- und Sprengstofffunden im gesamten Bundesgebiet waren Polizei und Geheimdienste über den steigenden Grad der Bewaffnung der Neonaziszene gut informiert. So konnten unter den Augen von Geheimdiensten und Polizei regionale und überregionale rechte Terrorstrukturen entstehen, die gesellschaftliche Minderheiten und die demokratische Verfasstheit des Staates zu ihren Hauptfeinden erklärten und entsprechend ihres Weltbildes »Taten statt Worte« folgen ließen. Doch in den Verfassungsschutzberichten der Jahre 2000 bis 2011 finden sich dort die immer gleichen Dementis zur Existenz rechtsterroristischer Strukturen. Und wenn es denn einmal zu strafrechtlichen Ermittlungen kam, wurden die gut organisierten Neonazistrukturen allenfalls mit dem Vorwurf der Bildung einer »kriminellen Vereinigung« nach §129 StGB verfolgt – wie etwa im Fall der »Skinheads Sächsische Schweiz« oder des »Sturm 34«.
Zäsur oder »Weiter so«?
Auf die 47 Handlungs- und Reformempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, die mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Bundestages im November 2013 bestätigt wurden, haben sowohl die Bundesministerien als auch die Länder reagiert, wobei mehrere Landtage – beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Berlin – die zumeist leicht veränderten Empfehlungen als eigene Beschlüsse fassten.
Einundzwanzig der gemeinsamen Empfehlungen betreffen die Polizei: An erster Stelle hat der Ausschuss empfohlen, zukünftig „in allen Fällen von Gewaltkriminalität, die wegen der Person des Opfers einen rassistisch oder anderweitig politisch motivierten Hintergrund haben könnten“, eingehend zu prüfen „und diese Prüfung an geeigneter Stelle nachvollziehbar“ zu dokumentieren, „wenn sich nicht aus Zeugenaussagen, Tatortspuren und ersten Ermittlungen ein hinreichend konkreter Tatverdacht in eine andere Richtung ergibt.“ Diese Dokumentationspflicht solle in Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren (RiStBV) verankert werden.16 Darüber hinaus werden u.a. die Schaffung einer neuen Fehlerkultur, eine Überprüfung aller ungeklärten Gewalttaten auf Bezüge zu Rechtsterrorismus und NSU, eine grundlegende Überarbeitung des »PMK-Rechts«-Definitionssystems sowie eine Förderung der »interkulturellen Kompetenz« der PolizeibeamtInnen und eine Anpassung der Polizei an die gesellschaftliche Vielfalt durch eine Erhöhung des Anteils von PolizistInnen migrantischer Herkunft gefordert. Für den Bereich der Justiz werden u.a. eine veränderte Zuständigkeit des Generalbundesanwalts sowie Aus- und Fortbildungen für Richter, Staatsanwälte und Justizangestellte zu aktuellen Entwicklungen im Rechtsextremismus angemahnt.17 Für die Geheimdienste haben sich die Abgeordneten wenig überraschend auf ein knappes Dutzend gemeinsamer Empfehlungen einigen können, wobei die Forderungen nach mehr Kontrolle und Veränderungen im V-Leute-System sicherlich am wichtigsten sind. „Der Quellenschutz ist nicht absolut“, heißt es knapp und eindeutig. Denn: „Der Schutz von Leib und Leben der Quelle sowie anderer Personen, die Arbeitsfähigkeit der Verfassungsschutzbehörden und die berechtigten Belange von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr müssen in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden.“ 18
Mit dem »Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags« vom 30. Oktober 201419 hat das Bundesjustizministerium als erstes Ressort auf Bundesebene auf die Empfehlungen reagiert. Geht es nach Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), soll zukünftig insbesondere §46 Abs. 2 Satz 2 StGB erweitert werden, um „rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende“ Ziele eines Täters im Fall von Körperverletzungsdelikten bei der Strafverfolgung besonders zu berücksichtigen. Dieser Vorschlag stieß allerdings sowohl bei den spezialisierten Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt als auch bei einer Expertenanhörung im Rechtsausschuss Ende Dezember 2014 mehrheitlich auf Ablehnung. Stattdessen betonten Experten, wie der NSU-Nebenklagevertreter Sebastian Scharmer, nochmals die Notwendigkeit einer Dokumentationspflicht zur Ermittlung möglicher rassistischer Hintergründe einer Gewalttat. Doch die ist bislang nicht in Sicht.
Im Bereich der Polizeiempfehlungen fällt die Bilanz kaum besser aus: Zwar haben das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter seit Sommer 2012 aus rund 3.300 ungeklärten vollendeten und versuchten Tötungsdelikten 745 Fälle – darunter die 164 von Tagesspiegel und ZEIT online recherchierten politisch rechts motivierten Tötungsdelikte – genauer untersucht. Doch bislang ist aufgrund dieser Untersuchung lediglich der Mord an einem 16-jährigen alternativen Jugendlichen in Sachsen im Jahr 2003 nachträglich als „politisch rechts motiviert“ anerkannt worden.20 Ansonsten „habe sich die Anzahl der politisch rechts motivierten Tötungsdelikte aufgrund der so genannten Altfallanalyse nicht erhöht“, erklärte Innenstaatssekretär Frings im Bundestag am 5. November 2014. Es bleibt abzuwarten, ob die BKA-Arbeitsgruppe zur Reform der »PMK-Rechts«-Kriterien, die auch VertreterInnen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zur Diskussion eingeladen hat, zumindest dazu beitragen wird, dass das nach wie vor erhebliche behördliche Wahrnehmungsdefizit in Bezug auf rassistische und politisch rechts motivierte Alltagsgewalt in absehbarer Zeit verringert werden kann.21
Die allermeisten Polizei-Empfehlungen des Bundestags-Untersuchungsausschusses müssten allerdings de facto in den Ländern umgesetzt werden, da Polizeiangelegenheiten Ländersache sind. Beispielhaft ist hier sicherlich das Land Berlin, dessen LKA im September 2014 einen knapp 44-seitigen »Zwischenbericht zur Umsetzung der parlamentarischen Empfehlungen zum ‚NSU-Komplex‘ in der Polizei Berlin« vorlegte und darin u.a. eine Umstrukturierung des Polizeilichen Staatsschutzes sowie eine »Gesamtstrategie zur Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität rechts« verspricht. Doch wie immer steckt der Teufel im Detail: Bei der Führung polizeilicher V-Leute – im NSU-Komplex hat das LKA Berlin mit Thomas Starke einen zentralen Unterstützer des NSU-Kerntrios über Jahre als V-Mann geführt – soll nun die Höchstdauer auf zehn Jahre beschränkt und eine behördeninterne Kontrolle der V-Mann-Führer, die vorher gar nicht existierte, aufgebaut werden. Eine parlamentarische Kontrolle des V-Leute-Systems der Polizei ist allerdings immer noch nicht vorgesehen. Auch unabhängige Polizeibeschwerdestellen wird es in Zukunft nicht geben.
Wenn man davon ausgeht, dass institutioneller Rassismus ein Hauptfaktor für das Staatsversagen im NSU-Komplex war, dann lässt sich klar sagen: Hier hat sich zunächst einmal gar nichts bewegt. Dabei hat eine bemerkenswerte Studie der Polizeifachhochschule Sachsen-Anhalt zum »Polizeilichen Umgang mit migrantischen Opferzeugen« im vergangenen Jahr festgestellt: „Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass mangelnde Sensibilität im polizeilichen Umgang mit migrantischen Opferzeugen in vielen Fällen des polizeilichen Einsatzgeschehens bei politisch motivierter Kriminalität nicht von der Hand zu weisen ist.“ 22 Eine bundesweite Untersuchung zu rassistischen Einstellungsmustern unter Polizeibeamten wäre da der nächste logische Schritt – auch, um die festgefahrene Diskussion auf eine Faktenbasis zu stellen. Im polizeilichen und justiziellen Umgang mit alltäglicher rassistischer Gewalt sind ebenfalls wenig Fortschritte erkennbar, wie nicht zuletzt bei rassistischen Angriffen in Bernburg oder Pirna deutlich wurde, bei denen die Bedeutung von Rassismus als Tatmotiv von Seiten der Strafverfolgungsbehörden konsequent klein geredet wurde.
Das gebrochene Aufklärungsversprechen und die Geheimdienste
Untrennbar mit dem NSU-Komplex verbunden ist das Versprechen „größtmöglicher Aufklärung“, das Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der zentralen Trauerfeier für die NSU-Mordopfer im Februar 2012 in Berlin gab. Dieses Versprechen droht an der Blockade und dem systematischen Aktenvernichten der deutschen Geheimdienste zu scheitern. Dabei wird das Ausmaß an Hybris, Vertuschung und Versagen der Geheimdienste täglich größer – und damit auch die Zahl der offenen Fragen, die nicht im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München geklärt werden können.
Anlass zur Sorge bietet ferner, dass es dem Bundesinnenministerium und dem BfV auch nach dem 4. November 2011, dem Bekanntwerden des NSU und seines Netzwerkes, immer noch nicht gelingt, die Existenz rechtsterroristischer Strukturen in Deutschland einzugestehen. Beispielhaft für die hartnäckige Realitätsverleugnung im Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch in den Landesämtern, soll hier die Aussage des Zeugen Egerton vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zitiert werden, der von 1994 bis zum Jahr 2000 im Bundesamt mit der gewaltbereiten Naziskinszene befasst war. Egerton antwortete auf die Frage, wie es zu der fundamentalen Fehleinschätzung des BfV in Bezug auf Rechtsterrorismus gekommen sei: „Die Frage war: Gibt es eine braune RAF? Und der Ausgangspunkt war: Hat das BfV Strukturen erkannt, die RAF-ähnlich sind, also zum Beispiel Kommandoebene mit Unterstützerumfeld, möglicherweise auch militant, was also auch Anschläge begeht? Und diese Strukturierung hat das BfV nicht erkannt. Es hat sie auch in Form des Trios nicht gegeben. Das war ja auch keine Kaderorganisation mit Unterstützerumfeld.“ 23
Diese Aussage – nach den angekündigten »Reformen« im BfV – macht in erschreckender Weise deutlich, wie groß dort die Beharrungskräfte sind und lässt das Schlimmste für die zukünftige Analysefähigkeit des BfV vermuten. Auch die Tatsache, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz als Reaktion auf dessen Verantwortung für das Staatsversagen im NSU-Komplex lediglich gegen drei Beamte Disziplinarverfahren eingeleitet wurden, während gleichzeitig 57 Mitarbeiter aus dem Bereich Rechtsextremismus befördert wurden, spricht für sich.24 Hinzu kommt, dass das BfV mit einer Erhöhung von finanziellen Ressourcen und einer Ausweitung seiner »Zentralstellenfunktion« – inklusive der Führung einer zentralen V-Leute-Datei – zu den eigentlichen Profiteuren des NSU-Komplexes gehört. Das Bundesinnenministerium wird dazu passend demnächst einen Gesetzesentwurf vorlegen, wonach V-Leuten unter bestimmten Umständen Straffreiheit zugesichert werden und der Einsatz verdeckter Ermittler durch das BfV ermöglicht werden soll.25
Nach den tödlichen islamistischen Anschlägen auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift »Charlie Hebdo« und einen jüdischen Supermarkt in Paris am 9. Januar 2015 ist davon auszugehen, dass die Ausweitung der Kompetenzen des BfV noch weitgehender ausfallen wird, als schon geplant. Ohnehin besteht die Gefahr, dass nun ähnlich wie nach dem 11. September 2001 die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit neonazistischem Terror und Rassismus schon bald wieder zurückgestellt wird, während rassistische und neonazistische Gewalttäter sich zugleich durch Pegida legitimiert fühlen und der Nationalsozialistische Untergrund und seine Mord- und Anschlagsserie als singuläres Phänomen verharmlost und historisiert werden, ohne dass es zu einer endgültigen Aufklärung kommt.
Anmerkungen
1) Beschlussempfehlung und Bericht des 2. Untersuschungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes. Bundestag-Drucksache 17/14600 vom 22.8.2013, S.861 ff.
2) Ebenda, S.843f.
3) ZEIT Online: Interaktive Karte Todesopfer rechter Gewalt 1990 bis 2010.
4) Heike Kleffner (2009): Kleine Geschichte des Umgangs mit Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland nach 1989. In: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 7. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S.262-282.
5) Mut gegen rechte Gewalt – Das Portal gegen Neonazis: Rechte Hetze gegen Flüchtlinge – Eine Chronik der Gewalt 2014. 31.12.2014; www.mut-gegen-rechte-gewalt.de.
6) Brandanschlag auf Auto – Linken-Politiker will sich „nicht einschüchtern lassen“. Der Tagesspiegel, 6.1.2015.
7) Heike Kleffner (2009), op.cit.
8) Ronald Heinemann: Urteil im Neonazi-Prozess: Im Familienauto zum Brandanschlag. SPIEGEL Online, 7.3.2005.
9) Bundestag-Drucksache 17/14600, op.cit, S.831.
10) Ebenda.
11) Vgl. dazu auch Erardo Cristoforo Rautenberg (2007): Die Verfolgung rechtsextremistischer Straftaten im Land Brandenburg und deren mögliche Ursachen. In: Julius H. Schoeps, Gideon Botsch, Christoph Kopke (Hrsg.): Rechtsextremismus in Brandenburg, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, S.221-229. Rolf Gössner (1996): Zwischen Verharmlosung und Überreaktion: Zum polizeilichen und justitiellen Umgang mit rechter Gewalt und Neonazismus. In: Jens Mecklenburg (Hrsg.): Handbuch Rechtsextremismus. Berlin: Elefanten Press, S.837f.
12) Heike Kleffner und Holzberger (2004): War da was? Reform der polizeilichen Erfassung rechter Straftaten. CILIP Nr. 77, S.56-64.
13) Gössner, op.cit., S.837f.
14) Barbara John (Hrsg.) (2014): Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen. Was der NSU-Terror für die Opfer und Angehörigen bedeutet. Freiburg: Herder.
15) Bundestag-Drucksache 17/14600, op.cit., S.231.
16) Ebenda, S.831f.
17) Ebenda, S.863f.
18) Ebenda, S.865.
19) Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Bundestag-Drucksache 18/3007 vom 30.10.2014.
20) Heike Kleffner (2015): Todesopfer rechter Gewalt: Offizielle Anerkennung verweigert. CILIP Nr. 107 (i.E.).
21) Vgl. Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt in den östlichen Bundesländern und Berlin: 737 Fälle politisch rechts motivierter Gewalt in Ostdeutschland und Berlin – Beratungsstellen veröffentlichen gemeinsame Statistik für 2013 – Anstieg der Gewalttaten insbesondere der rassistischen ist Besorgnis erregend. 10.4.2014; www.mobile-opferberatung.de.
22) Polizei Sachsen-Anhalt (2014): Polizeilicher Umgang mit migrantischen Opferzeugen (Forschungsbericht). Aschersleben, S.11.
23) Bundestags-Drucksache 17/14600, op.cit., S.233.
24) Astrid Geisler: Zur Strafe befördert. taz.de, 28.11.2014.
25) Christian Rath im Interview mit SPD-Innenexperte Burkhard Lischka: Zum Beispiel: Hitlergruß. Geheimdienstermittler sollen legal werden. taz. 27.11.2014.
Abkürzungen
DVU – Deutsche Volksunion.
HoGeSa – Hooligans gegen Salafisten
NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Pegida – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
StGB – Strafgesetzbuch
Heike Kleffner arbeitet als Journalistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
zum Anfang Das Unwort erklärt die Untat
Die »Döner-Mordserie« und der Umgang mit Gewalt an Migrantinnen und Migranten in den Medien
von Fabian Virchow, Tanja Thomas und Elke Grittmann
Von September 2000 bis April 2006 wurden in Deutschland neun Menschen Opfer einer Mordserie, die in der Berichterstattung häufig als »Döner-Morde« bezeichnet wurde. Für die Tathintergründe und -motive wurden seitens der Strafverfolgungsbehörden bar jeder Faktenlage immer wieder neue Mutmaßungen oder Thesen formuliert, die auch Eingang in die mediale Berichterstattung fanden. Der Täter konnte die Polizei trotz aufwändiger Ermittlungsarbeit in all diesen Jahren nicht habhaft werden. Erst infolge eines Bankraubes in Eisenach am 4. November 2011, kurz danach in einer in Brand gesetzten Wohnung gefundener Unterlagen sowie der Verbreitung von Bekennervideos wurde bekannt, dass für die Mordserie eine neonazistische Gruppe verantwortlich war, die aus rassistischen Motiven tötete und sich selbst »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) nannte.
Das Bekanntwerden des NSU führte nach dem 4. November 2011 dazu, dass sich viele Medien in der Bundesrepublik Deutschland intensiv, umfangreich und häufig auch investigativ mit den vom NSU begangenen Morden und weiteren Straftaten, den Hintergründen sowie mit strukturellen und personellen Defiziten bei den Inlandsnachrichtendiensten und den Versäumnissen der Ermittlungsbehörden befassten. Das Entsetzen über die Vorgänge war in der medialen Berichterstattung nicht zuletzt deshalb besonders groß, da über ein Jahrzehnt in eine völlig falsche Richtung ermittelt worden war und die Ermordeten und ihre Angehörigen selbst öffentlich verdächtigt wurden, in kriminelle Aktivitäten verstrickt zu sein, die Ursache für die Morde seien.
An der Verbreitung und Etablierung dieser Deutung, die sich im Begriff der »Döner-Morde« verdichtet hat, haben nicht nur die ermittelnden Behörden, sondern auch Medien maßgeblichen Anteil. Der erstmals Ende August 2005 in der Nürnberger Zeitung verwendete Begriff wurde bis zur Aufdeckung der tatsächlichen Hintergründe der Morde an neun Menschen zum Synonym für eine beispiellose Mordserie. So konstatierte der stellvertretende Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl (2012), zwei Monate nach Bekanntwerden des NSU, schon das Wort „Döner-Morde“ spiegele „Geringschätzung und Abgrenzung“ wider.
Der Begriff markiert zum einen eine diskriminierende Bezeichnungspraxis seitens vieler Medien, war diese Etikettierung doch nicht nur sachlich unzutreffend, sondern auch stereotypisierend. Zugleich steht der Ausdruck als Symbol für eine Berichterstattung, die die politische Dimension der Morde überwiegend verkannt oder ignoriert hat. Die Ermordeten wurden nach rassistischen Kriterien ausgesucht. Sie wurden ermordet, weil sie rassistisch eingestellten Tätern mit ihrer dauerhaften Aufenthalt signalisierenden Tätigkeit als selbständige Unternehmer und als Familienväter als Bedrohung einer imaginierten »Rasse-Reinheit« erschienen.
Berichterstattung folgt Ermittlungstätigkeit
Die hier vorgestellte Untersuchung der Berichterstattung über die neun Morde war von der Fragestellung geleitet, wie die Printmedien über die Morde, über mögliche Täter und Tatmotive berichteten und wie die Opfer dargestellt wurden. Durch einen Vergleich mit der türkischsprachigen Presse sollten außerdem Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Berichterstattung der deutsch- bzw. türkischsprachigen Printmedien erkannt werden. Schließlich sollte die journalistische Auseinandersetzung mit der Berichterstattung nach Bekanntwerden der Täterschaft berücksichtigt und nach Gründen für die vorgefundene Berichterstattung gesucht werden.
Im Rahmen einer wissenssoziologischen Diskursanalyse, die sich bei der Untersuchung von Diskursen insbesondere dafür interessiert, wie das in der Berichterstattung behandelte Ereignis problematisiert wird, welche Ursache-Wirkung-Zusammenhänge genannt werden, welche Personen oder Instanzen als zuständig und verantwortlich benannt werden oder welche Handlungsmöglichkeiten formuliert werden, wurden aus dem Zeitraum 9.9.2000 (Ermordung von Enver Simsek in Nürnberg) bis Anfang November 2011 insgesamt rund 300 Beiträge und 290 Bilder aus der deutsch- und türkischsprachigen Presse in Deutschland untersucht. Zudem wurden Interviews mit Journalist*innen geführt, die über die Morde berichtet hatten.
Die Berichterstattung war weitgehend durch Fremdheit und Ausgrenzung gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen geprägt. Der Begriff des »Döner-Mordes« ist dabei lediglich eine besondere Zuspitzung. Aus vermuteten Verbindungen zur »Organisierten Kriminalität« wurden Tatsachenbehauptungen gemacht. Die Berichterstattung über die Mordserie machte in mehreren Fällen – häufig im Anschluss an polizeiliche Ermittlungsarbeit und deren mediale Vermittlung – sowohl das persönliche Umfeld als auch das imaginierte Kollektiv »der Türken« zu Komplizen der Täter. Dies kommt exemplarisch in einer vom SPIEGEL gebrauchten Formulierung („Die schwer durchdringbare Parallelwelt der Türken schützt die Killer.“) zum Ausdruck, die allerdings in eine Vielzahl von Thematisierungsweisen eingelassen ist, die vor dem Hintergrund der Mordserie einen engen Zusammenhang von Kriminalität und Migration herstellten.
Das Reden von einer „Mauer des Schweigens“ und „den noch nicht in unserer Gesellschaft angekommenen Türken“ markierte in seiner Verallgemeinerung zahlenmäßig bedeutsame Teile der in Deutschland lebenden Bevölkerung als nicht dazugehörig und ordnete diesen zudem spezifische Verhaltensweisen zu. Mit dem in der Berichterstattung auftauchenden Begriff der „Parallelwelt“ wurde an den Diskurs von der »Parallelgesellschaft«1 angeschlossen und ein „Dramatisierungspotential“ 2 aufgerufen. Denn in vielen Medien ist der Terminus meist mit „verstörenden Ereignissen wie Ehrenmord oder andern Gewaltverbrechen“ und mit dem Scheitern einer »multikulturellen Gesellschaft«3 verknüpft. Auf diese Weise wurden die Angehörigen der Opfer nicht primär als Betroffene vorgestellt, sondern als Teil der »Anderen« stigmatisiert.
Den Opfern und ihren Angehörigen wurde nur vereinzelt und vorwiegend in der Regionalberichterstattung eine Empathie entgegengebracht, wie sie bei der Berichterstattung über Opfer von Gewaltverbrechen in anderen Kontexten durchaus verbreitet ist. Dabei wurden sie zum Beispiel als der Stadtgesellschaft zugehörig bezeichnet, aus deren Mitte Trauer und Beileid bekundet wurden. Anteilnahme und Trauer des persönlichen Umfelds wurden nicht nur im Text, sondern auch durch Bildmaterial unterstrichen. Diese Berichterstattung bildet ein Gegengewicht zu den oben genannten Darstellungsweisen. Die zum Teil feststellbare Parallelität der beiden Formen der Berichterstattung verweist allerdings auf die Gefahr, das Individuum als Ausnahme eines ansonsten mit negativen Merkmalen versehenen Kollektives vorzustellen.
Die Berichterstattung über die Mordfälle lag in vielen Redaktionen bei Polizeireporter*innen. Die polizeilichen Quellen genossen Autorität und Glaubwürdigkeit, ihre Deutungsmuster und Mutmaßungen wurden nicht oder nicht konsequent hinterfragt. So folgte die Berichterstattung den Mutmaßungen über Schutzgelderpressung, Drogenkriminalität, Auftragskiller oder Geldwäsche und trug zu einem Bild bei, in dem die Verantwortung für die Morde dem Bereich der »Organisierten Kriminalität« zugewiesen wurden, die wiederum als »ausländisch« markiert wurde.
In der kurzen Phase, in der die Möglichkeit rassistischer Tatmotive aufgrund einer polizeilichen Fallanalyse ernsthafter in den Blick genommen wurde, reichte die journalistische Bearbeitung von Ablehnung („unplausibel“) bis zur Entpolitisierung („Einzeltäter mit negativen Erfahrungen, aber keine organisierte Täterstruktur“). Bezüge zu anderen Fällen von Gewalt gegen Migrant*innen und damit zu möglichen rassistischen Tathintergründen wurden nur in Ausnahmefällen hergestellt. Die Polizei spielte zudem in ihrer Medienstrategie die These eines rassistischen Tatmotivs bewusst herunter.
Die enge Anbindung der Berichterstattung an die polizeiliche Erkenntnis- bzw. Vermutungslage führte zu einer einseitigen Gewichtung und Sichtbarkeit der Quellen.
Journalistische Verantwortung
Die untersuchten Diskurse machen nur einen kleinen Anteil der Diskurse aus, die in den vergangenen Jahren zu Themen wie Integration, Migration und Kriminalität geführt wurden. Journalist*innen entscheiden mit darüber, welche Art von Gesetzesverletzungen und Kriminalität zum Gegenstand der Berichterstattung wird. Über Morde wird mit der höchsten Wahrscheinlichkeit berichtet. Kriminalitätsberichterstattung macht schwere Straftaten weit überproportional zu ihrem tatsächlichen Vorkommen zum Thema in den Printmedien. Rechnet man der Kriminalitätsberichterstattung drei zentrale soziale Funktionen zu – Grenzziehung (Verdeutlichung normativer Grenzen), Status-quo-Erhaltung (Legitimation des geltenden Normen- und Kontrollapparats) sowie Ausblendung (Fokus auf Personen statt auf Strukturen; Dethematisierung bestimmter Probleme)4 –, so lässt sich mit Blick auf die Berichterstattung zu der Mordserie davon sprechen, dass verschiedene Grenzziehungen, Legitimationen und De-/Thematisierungen stattgefunden haben.
Dass die Morde an Menschen schwere Verbrechen und normativ zu verurteilen sind, zieht sich durch die gesamte Berichterstattung. Zugleich fand in Form der häufig über Mutmaßungen hinsichtlich der Tathintergründe hergestellten Verknüpfung der Opfer oder ihres persönlichen Umfeldes zu Kreisen der »Organisierten Kriminalität« eine Grenzziehung statt, die die Betroffenen jenseits der Grenze des normativ Akzeptablen verortet. Die Legitimation des Kontrollapparates wurde durch die herausgehobene Sprecherposition der Strafverfolgungsbehörden und die textliche und visuelle Präsentation unterstrichen. Zu den signifikanten Dethematisierungen gehörte die Möglichkeit einer rechtsterroristischen Täter*innenschaft, die in Teilen auf eine entsprechende Medienstrategie der Polizei zurückzuführen ist. Entsprechende Thematisierungen seitens der Angehörigen von Ermordeten wurden von journalistischer Seite nicht aufgegriffen.
In der Berichterstattung wurden Angehörige der Opfer nur selten als Sprechende und Handelnde sichtbar. Auch hier spiegelt sich eine verbreitete Form des Schreibens über migrantische Bevölkerung wider: Teilgruppen oder Individuen, die ihr zugerechnet werden, werden in den Medien oft als passive Opfer vorgestellt. Tauchen sie in aktiv handelnden Kontexten auf, dann geschieht dies regelmäßig in negativ bewerteten Rollen und Konstellationen (Kriminalität, Gewalt). Entsprechend blieben auch die Solidaritätsdemonstrationen in Kassel und Dortmund medial weitgehend unbeachtet, obwohl schon die dort formulierte kollektive und öffentliche Aufforderung von Angehörigen von Verbrechensopfern gegenüber den Strafverfolgungsbehörden eine seltene Ausnahme ist und damit insbesondere im Lichte der Schwere und Dauer der Mordserie auch berichtenswert hätte sein können.
Wenig Unterschiede bei den türkischen Medien
In den untersuchten türkischsprachigen Medien wurden die Morde häufig unter der Bezeichnung „Serien-Mord“ aufgegriffen. Vereinzelt wurde auch die Bezeichnung „Dönerverkäufer-Mord“ benutzt. Wenn auch der Begriff »Döner-Morde« vergleichsweise selten verwendet wurde und dabei in etwa zwei Dritteln der Fälle zudem durch Anführungszeichen oder durch ergänzende Formulierungen Distanz zur Wortverwendung deutlich gemacht wurde, so gab es doch keine explizite Hinterfragung des Begriffs. Der im Juni 2012 veröffentlichte Bericht der Menschenrechtskommission des türkischen Parlaments über die NSU-Morde kritisierte denn neben den deutschen auch die türkischen Medien für diesen Sprachgebrauch.5
In expliziter Anlehnung an deutschsprachige Berichterstattung tauchten in den türkischen Medien zahlreiche Mutmaßungen über Tatmotive und Täter auf. Zum Teil legten die Berichte zudem durch die Nennung konkreter Zahlen die Existenz von Insiderwissen nahe, gelegentlich wurden auch gänzlich neue Vermutungen über die Täter – die Hisbollah bzw. »türkische Nationalisten« – eingebracht.
Etwas nachdrücklicher fand sich in der türkischsprachigen Presse die These eines rassistischen Tatmotivs, die zudem durch entsprechende Äußerungen Ýsmail Yozgats, Halit Yozgats Vater, sowie unter Bezugnahme auf „Nürnberger Türken“ unterstrichen wurden. Letztgenannte wurden zudem mit der Ansicht zitiert, die Polizei würde ein entsprechendes Motiv nicht nennen, um ansteigende Fremdenfeindlichkeit zu verschleiern.
Ein zentraler Grund für die Art der Berichterstattung der türkischsprachigen Presse war die schwache personelle und materielle Ausstattung der türkischsprachigen Redaktionen in Europa, so dass auf Berichte der deutschsprachigen Medien – insbesondere des SPIEGEL – zurückgegriffen wurde.
Medien(selbst)kritik
Nach dem Auffliegen des NSU im November 2011 setzte im Journalismus, u.a. in Fachzeitschriften, in der publizistischen Medienkritik und vereinzelt auch in der Presse und deren Onlinemedien, eine kritische „reflexive Selbstthematisierung“ 6 der Rolle der Medien bzw. des Journalismus und des journalistischen Handelns in der vorangegangenen Berichterstattung über die Morde ein. Dabei wurde zum Teil kritisch auf die Verwendung von Begriffen eingegangen, es wurden aber auch die Vorurteile von Journalist*innen – insbesondere gegenüber türkischen Männern – thematisiert. Vereinzelt kamen in diesem Zusammenhang in Fernsehdokumentationen dann auch Angehörige von Ermordeten mit ihrer Sichtweise zu Wort.
Die Art der Berichterstattung über die Morde des NSU vor Bekanntwerden der Täterschaft verweist damit auf strukturelle Mechanismen und Defizite im Feld des Journalismus, die zu den zutage getretenen Mängeln der Berichterstattung beitrugen. Hierzu gehören insbesondere
- unkritische Orientierung an und Übernahme von polizeilichen Interpretationen sowie häufiger Verzicht auf die Erschließung weiterer Perspektiven,
- fehlende Ressourcen für eigenständige Recherchen,
- fortbestehende Distanz zu migrantischem Leben, die die Berücksichtigung der Perspektiven und Erfahrungen der Angehörigen der Opfer erschwerte,
- unzureichende Repräsentanz migrantischer Perspektiven in der Berichterstattung sowie
- ein »Schwarmverhalten«, das nicht selten zur Orientierung an einigen wenigen Leitmedien führt und in diesem Fall zur Verstärkung diskriminierender Berichterstattung beitrug.
Über zahlreiche der in der Untersuchung behandelten Dimensionen journalistischen Arbeitens wurde bereits diskutiert, andere wurden in der journalistischen Reflexion bisher nur am Rande erörtert. Es bleibt zu hoffen, dass die Studie auch als Unterstützung für ethisch fundiertes professionelles journalistisches Handeln genutzt werden kann.
Anmerkungen
1) Katharina Belwe (2006): Editorial zum Schwerpunkt »Parallelgesellschaften«. Aus Politik und Zeitgeschichte 1-2, S.2.
2) Werner Köster (2009) (Hrsg.): »Parallelgesellschaften« – Diskursanalysen zur Dramatisierung von Migration. Essen: Klartext, S.7.
3) Andrea Janßen und Ayça Polat (2006): Soziale Netzwerke türkischer Migrantinnen und Migranten. Aus Politik und Zeitgeschichte 1-2, S.11-17, hier S.11.
4) Bernd Obermöller und Mirko Gosch (1995): Kriminalitätsberichterstattung als kriminologisches Problem. Kritische Justiz, 28, S.45-59.
5) Inceleme Raporu (2012): 2000-2006 Yillarinda Almanya‘da Neo-Nazilerce Islenen Cinayetler Hakkinda Inceleme Raporu. S.45ff; tbmm.gov.tr.
6) Vgl. Maja Malik (2008): Selbstverliebte Fremdbeobachter. Zum Dilemma der journalistischen Selbstbezüglichkeit. In: Bernhard Pörksen, Wiebke Loosen, Armin Scholl (Hrsg.): Paradoxien des Journalismus. Theorie – Empirie – Praxis. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.429-446.
Fabian Virchow ist Professor für Theorien der Gesellschaft und Theorien politischen Handelns an der FH Düsseldorf. Tanja Thomas ist Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Elke Grittmann ist Gastprofessorin für Kommunikationswissenschaft im Vertiefungsgebiet Medienkultur und Kommunikation an der Leuphana Universität Lüneburg.
Die Untersuchung wurde von der Otto-Brenner-Stiftung finanziert und ist als OBS-Arbeitsheft 79 auf der Internetseite der Stiftung abrufbar; otto-brenner-stiftung.de.
zum Anfang Keupstraße
Räume zwischen Vergessen und Erinnern
von Ayla Güler Saied
„Wenn sie mir damals in der Türkei gesagt hätten, in Deutschland wird ein Flugzeug auf deinen Kopf stürzen, hätte ich das vielleicht geglaubt. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass Nazis eine Bombe vor meinen Laden zünden und ich dadurch verletzt werden könnte.“ (Hasan Yildirim, Friseur auf der Keupstraße)
Als am 9. Juni 2004 auf der Keupstraße eine vom »Nationalsozialistischen Untergrund« gezündete Nagelbombe explodierte, ahnte noch niemand, welche physischen und psychischen Folgen das für die auf der Straße ansässigen Bewohner und Geschäftsleute haben würde. Erst heute können die Folgen rekonstruiert und in ihrem sozialen, politischen und gesellschaftlichen Ausmaß analysiert werden. Ich werde in diesem Artikel zum einen »migrantische« Perspektiven1 auf den NSU-Komplex darstellen und zum anderen auf die bundesweit entstandenen zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüsse und Initiativen eingehen, die gemeinsam mit den Betroffenen des Anschlages Solidarität einfordern.
»Migrantische« Perspektiven auf die NSU-Morde
Das Wissen um Rassismus hat im kollektiven Gedächtnis von MigrantInnen einen festen Platz. Dabei ist ein Prozess zu beobachten, der nicht nur einen besonders ausgeprägten Rassismus innerhalb neonazistischer gewaltbereiter Gruppen im Blick hat, sondern den Alltagsrassismus mitdenkt. Nach den Erkenntnissen, die bisher über den NSU-Komplex bekannt geworden sind, herrscht in der migrantischen Community – mit all ihren Gemeinsamkeiten und Widersprüchen – die Einsicht vor: „Wir sind hier nicht mehr sicher. Der Staat liefert uns aus, indem er die Nazis strukturell und finanziell unterstützt.“
Die Erzählungen und Analysen folgen alle einer gemeinsamen Linie: Es wird die fehlende Anerkennung als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft kritisiert und eingefordert. Darüber hinaus herrscht die Einsicht, dass MigrantInnen nicht hinreichend geschützt, vielmehr selbst als Täter konstruiert werden. Diese jahrelange Opfer-Täter-Umkehr setzte bei den Betroffenen auf der Keupstraße als Opfer rassistischer Gewalt einen doppelten Traumatisierungsprozess in Gang.
Leyla ist 13 Jahre alt und Schülerin der 9. Klasse. Sie denkt, dass der NSU und seine Taten alle Menschen politisch interessieren sollten. Sie bringt im Interview zur Sprache, dass der NSU und seine Verbrechen wie auch der Prozess in München in der Schule bisher kein Thema gewesen seien. Dem Prozess misst sie folgende Bedeutung zu: „Ich glaube nicht, dass das die Angehörigen sonderlich interessiert, weil sie dadurch auch nicht ihre Familie zurückbekommen. Ich würde denken, dass der Prozess eher die Opfer interessiert, die weniger verletzt wurden.“ Sie ist der Meinung, dass der NSU mit dem Nagelbombenanschlag in der Keupstraße „[…] ein Warnsignal an die anderen [MigrantInnen] schicken wollte, dass es sozusagen ihr Land sei und dass noch schlimmere Sachen passieren könnten, wenn sozusagen noch mehr »Ausländer« nach Deutschland kommen“.
Im Interview kontextualisierte sie den Nagelbombenanschlag als deutlichen Ausdruck des herrschenden Rassismus: „Wenn die Behörden nicht nach Beweisen bei den Opfern gesucht hätten, dann hätten sie die Neonazis früher finden können, bevor so etwas Schlimmes passiert wäre. Ich denke nicht, dass sich da was ändern wird, weil das jetzt rausgekommen ist, wer die Bombe auf der Keupstraße gelegt hat. So was wird es immer in Deutschland und generell auf der Welt geben. Wie will man das stoppen?! Ich denke nicht, dass es jemals aufhören wird. Manche Menschen verstehen nicht, dass Menschen einfach Menschen sind. Rassismus wird immer ein Thema sein. Menschen sollten eine andere Sichtweise von Dingen haben. Ich persönlich sehe mich als Deutsche, was nicht heißt, dass andere mich auch so sehen. Ich selbst habe nicht Angst, weil ich denke, das könnte jedem passieren, auch Deutschen. Also, Rassismus ist so selbstverständlich, dass die Menschen nicht so abgeschreckt sind, wie sie es hätten sein müssen, nachdem aufgedeckt wurde, was der NSU gemacht hat.“
Die italienische Geschäftsinhaberin eines Friseurladens, der seit 1986 existiert und in der Nähe der Keupstraße liegt, antwortete auf die Frage, ob sie Angst habe, ebenfalls Opfer eines Anschlages zu werden: „Nein, wir fallen als Ausländer nicht auf. Wir sind für die Deutschen keine Ausländer mehr.“ Solidarität mit den Opfern auf der Keupstraße habe sie im Jahr 2004 und auch danach vermisst. Stattdessen sei der hegemoniale Diskurs reproduziert worden, d.h. die Mafia und Schutzgelderpressungen in migrantischen Milieus seien unhinterfragt als Grund für den Nagelbombenanschlag angenommen worden. Die Geschäftsfrau beklagte in diesem Kontext den Alltagsrassismus, der in Gesprächen zum Ausdruck komme, wenn pauschal von »Ausländern« und »fehlender Integration« die Rede sei. Und in einem Friseursalon, so sagt sie, werde viel geredet.
Die einseitige Berichterstattung über die Mord- und Anschlagsserie des NSU in den Jahren vor der Selbstenttarnung der Gruppe hat dazu beigetragen, dass sich erst relativ spät ein kollektives Wissen aus widersprüchlichen, noch nicht gebündelten Erfahrungen mit und Erinnerungen an das Nagelbombenattentat herausgebildet hat. Murat, ein 23-jähriger Lehramtsstudent, sagte: „Ich erinnere mich an den 11. September sehr gut, weil das auch in den Medien so präsent war. Obwohl ich 2004 schon älter war, ist der Nagelbombenanschlag bei mir nicht präsent, weil das medial so stark untergegangen ist.“
Initiative ergreifen
Nach der Selbstenttarnung des NSU bildeten sich bundesweit Initiativen mit den Betroffenen und Hinterbliebenen, um gegen das Schweigen und gegen die vielen offenen Fragen anzukämpfen und eine kritische Öffentlichkeit herzustellen.
Von März bis Mai 2013 fand auf der Keupstraße unter dem Titel »Von Mauerfall bis Nagelbombe« eine Film- und Veranstaltungsreihe statt. Ihr Hauptziel war es, die rassistisch motivierten Brandanschläge der 1990er Jahre mit der Mord-Anschlagsserie des NSU zusammen zu denken. Überlebende des Nagelbombenanschlags sowie der Brandanschläge legten gemeinsam ihre Sicht auf den Rassismus in Deutschland dar. Die Reproduktion des »Opfer«-Status wurde vermieden, indem die Betroffenen nicht nur Bezug auf den Anschlag selbst nahmen, sondern den herrschenden Alltagsrassismus und Integrationsdiskurs in Deutschland mit einbezogen. So wurden sie selbst als AkteurInnen wahrgenommen, was im öffentlichen und medialen Diskurs immer noch die Ausnahme darstellt.
Aus den Veranstaltungen dieser »Dostluk Sinemasi«-Reihe heraus entstand die Initiative »Keupstraße ist überall«. Als am Abend der letzten Veranstaltung Ibrahim Arslan, Überlebender des Anschlags von Mölln 1992, sowie Hasan Yildirim, Überlebender des Nagelbombenanschlags, nach ihren Erzählungen des Erlebten aufstanden und sich umarmten, war es ein sehr ergreifender Moment. Ibrahim Arslan sagte in diesem Zusammenhang: „Wir müssen unsere Geschichten immer wieder erzählen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.“ Er wollte die Betroffenen des Nagelbombenanschlags ermutigen, das Schweigen zu brechen. Hasan Yildirim sagte daraufhin: „Gott sei Dank ist auf der Keupstraße keiner gestorben. Was aber soll dieser Bruder sagen, der Schwester, Großmutter und Cousine verloren hat?“ Hasan Yildirim schloss seinen Redebeitrag folgendermaßen: „Wenn Beate Zschäpe jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt wird, muss ich dann nach 15 Jahren wieder Angst haben, Opfer eines Anschlags zu werden?!“
Er hinterfragte damit auch den Sinn der Film- und Veranstaltungsreihe und des NSU-Prozesses in München. Diese Frage war vermutlich die Initialzündung für die Initiative »Keupstraße ist überall«. Im Publikum wurde nach einem ersten Schweigen die Frage aufgenommen und gewendet: „Was können wir tun?“ Daraufhin fanden die wöchentlichen Treffen der Initiative »Keupstraße ist überall« statt, deren Hauptziel es ist, am Tag X – wenn der Anschlag in der Keupstraße im Gerichtverfahren in München verhandelt wird – die Betroffenen des Anschlags dorthin zu begleiten.2 Zur Unterstützung der Initiative fanden diverse Benefizveranstaltungen statt.
Thomas Laue, Dramaturg am Schauspiel Köln, öffnete für diverse Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen die Tore des Schauspiels und transportiere so die Anliegen der Keupstraße auch in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft. Die Betroffenen des Anschlags wurden gehört und gesehen, sie erfahren die Gerechtigkeit, die ihnen über Jahre hinweg vorenthalten wurde.
Einige Bündnisse entstanden aber bereits vor der Enttarnung des NSU. Die prägendsten Beispiele hierfür sind die Schweigemärsche in Kassel und Dortmund im Jahr 2006, die von den Familien Kubasik und Yozgat initiiert wurden. Diese Schweigemärsche fanden weder öffentlich noch medial angemessene Beachtung. Die Angehörigen der Opfer hatten bereits damals die Zusammenhänge zwischen den Morden erkannt und forderten eindringlich das Einschreiten der Sicherheitsbehörden, um ein zehntes Opfer zu vermeiden.
Mit den Folgen leben
Ein weiterer Faktor muss bei einer kritischen Analyse mitgedacht werden: Nicht alle Betroffenen gehen gleich mit den Geschehnissen um. Während einige ein großes Bedürfnis haben, ihre Geschichte nach außen zu tragen, ist es für andere retraumatisierend, darüber zu sprechen. Und über allem steht, insbesondere in der Keupstraße, immer wieder der Gedanke: „Schadet es nicht unserer Straße und dem Geschäft, wenn wir immer nur mit der Bombe in Verbindung gebracht werden?“ Ein Geschäftsmann auf der Keupstraße, der anonym bleiben wollte, sagte in diesem Kontext:
„Das Leben geht seitdem irgendwie weiter. Aber die Keupstraße sehnt sich nach der Zeit vor dem Anschlag zurück. Nach der Bombe ist auf geschäftlicher Ebene ein großer Schaden entstanden. Die Keupstraße ist durch die Bombe ein Angstraum geworden, nach dem Motto: Die Straße wird von Türken kontrolliert. Seit den letzten zwei, drei Jahren kommen Politiker hierher. Der Bundespräsident war hier. Es werden Anstrengungen unternommen, das Image der Straße aufzupolieren, das begrüße ich. Das trägt auch Früchte. Weil in den letzten sechs Monaten ist das hier wie ein Tourismuszentrum geworden. Das hängt in meinen Augen auch mit dem Straßenfest in Juni zusammen. Vor ein paar Tagen waren hier auf einmal Gruppen von 150 Deutschen. Vielleicht sind das auch die Leute, die nach der Bombe Angst hatten und jetzt durch das Straßenfest Mut gefasst haben und die Straße kennen lernen wollen. Ich sehe schon eine Anstrengung von Seiten der Regierung.“
Die Geschäftsleute der Keupstraße sorgen sich aber nach wie vor, dass die Geschäfte sich nicht erholen werden. Auch drei Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU ist die Situation paradox, und es ist für die Betroffenen schwierig, die Balance zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herzustellen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Die Auseinandersetzung mit dem Anschlag bedeutet jedes Mal aufs Neue eine Reproduktion der Straße als Angstraum. Viele möchten daher mit dem Anschlag abschließen. Als Geschäftsleute sind sie in erster Linie daran interessiert, finanziellen Gewinn zu erzielen. Dieses Spannungsverhältnis wird zumindest so lange bestehen bleiben, bis der Prozess in München abgeschlossen ist und die Keupstraße wieder zur Tagesordnung zurückkehren kann. Auf der anderen Seite bedeutet das Sprechen über die Geschehnisse, dass die Ungerechtigkeiten, die – zusätzlich zum Anschlag selbst – durch die Polizei und die Ermittlungsbehörden zustande kamen, nach außen transportiert werden und die Reputation der Betroffenen wiederhergestellt wird. Hasan Yildirim sagte diesbezüglich: „Als raus kam, dass der NSU für diesen Anschlag verantwortlich ist, war meine größte Freude, dass ich nicht mehr zu den stundenlang andauernden Verhören der Polizei musste, weil ich davon wirklich genug hatte und es nicht mehr ausgehalten habe.“
Die Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse in Bund und einigen Bundesländern lösten eine breite Diskussion um die Rolle des Verfassungsschutzes und der Sicherheitsbehörden aus. Der Bericht des Untersuchungsausschusses des Thüringer Landtages vermutet hinter den falschen Entscheidungen, die gefällt worden sind, „gezielte […] Sabotage“. Die Opfer des Nagelbombenanschlags wie die Angehörigen der Mordopfer gingen bereits relativ früh von einem rechtsextremen und rassistischen Hintergrund aus. Dass dies von den Ermittlungsbehörden, der Politik und den Medien nicht ernst genommen wurde, ebnete dem NSU den Weg, unentdeckt und über Jahre hinweg weiter morden und rauben zu können.
Arif, Inhaber eines Ladens auf der Keupstraße und Geschädigter des Anschlags, reflektiert den NSU-Komplex wie folgt: „Als 2011 die Selbstmorde stattfanden, haben wir gedacht, die Schuldigen sind gefunden. Wir hatten große Hoffnungen und waren positiv eingestellt. Aber jetzt sehe ich das besorgt. Ich habe immer noch Angst: Moscheen werden angezündet, Häuser angegriffen. Letztens hatte ich Flugblätter von der NPD im Briefkasten. Es wird immer mehr. Ich erlebe jeden Tag Alltagsrassismus. Es gibt in Deutschland Menschen, die mögen uns, und solche, die Ausländerfeinde sind. Wir können aufgrund der Menschen hier leben, die uns unterstützen.“
Arif ist nach wie vor davon überzeugt, dass es in dem Prozess in München zu keiner Aufklärung des gesamten NSU-Komplexes kommen wird: „Das Straßenfest und das Konzert waren für uns sehr gut. Ganz Deutschland hat davon erfahren. Ich habe aus Holland, Belgien, Türkei Anrufe bekommen. Meine deutschen Kunden sagen, wir haben dich im Fernsehen gesehen. An unserem finanziellen Einkommen hat sich aber nichts geändert. In München läuft der Prozess, ich rede jeden Tag mit meiner Frau oder meinen Kollegen auf der Keupstraße darüber. Aber meine Einstellung dazu hat sich nicht geändert: Ich bin überzeugt, dass es am Ende nichts bringen wird. Ich glaube nicht, dass unter der Merkel-Regierung irgendwas an die Oberfläche treten wird. Wir sind jetzt beim 140. Verhandlungstag. Ich würde mir wünschen, dass Beate Zschäpe zu mehreren Jahren Haft verurteilt wird und wir endlich unsere Ruhe haben.“
Birlikte – Zusammenstehen
Der zehnte Jahrestag des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße stand unter dem Motto »Birlikte – Zusammenstehen«. Neben zahlreichen anderen Veranstaltungen fand am 10. September 2014 auf der Keupstraße eine Großveranstaltung statt, an der nationale und internationale KünstlerInnen, Medienschaffende und PolitikerInnen mitwirkten und die ein großes und wirksames Zeichen für die Solidarität mit den Opfern des Anschlags sowie der Mordserie setzte.
Etliche Geschäftsleute auf der Keupstraße bewerteten die Veranstaltung als längst überfällig und waren von der Resonanz und dem Interesse von Zehntausenden Besuchern begeistert. Sie deuteten dies als Zeichen, dass die Keupstraße lebt und sie mit den Problemen, die während und nach dem Anschlag herrschten, nicht mehr alleine gelassen werden. Kutlu Yurtseven, Mitglied und Initiator der Initiative »Keupstraße ist überall«, beleuchtete diesen Zusammenhalt aus seiner Warte:
„Das Problematische an Initiativen ist meistens, dass über die Köpfe der Betroffenen hinweg agiert wird. In diesem Fall aber wird jede Idee mit den Betroffenen abgesprochen. Wir treffen uns mit den Betroffenen, hören ihnen zu, was sie brauchen. Alles auf Augenhöhe. Der Unterschied zu den damaligen Anschlägen in Mölln: Wenn man die Betroffenen als Objekt sieht und dann eine Zeit vergangen ist, dann ebbt das auch wieder ab. Bei dieser Initiative ist das anders. Weil die Betroffenen von Anfang an mitwirken. Es gibt ein ganz enges bundesweites Netzwerk, wo gemeinsame Aktionen geplant werden. Am 4.11. [2014] wird eine bundesweite Straßenumbennungs-Aktion stattfinden. Wir arbeiten unter anderem mit Initiativen aus München, mit der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak aus Berlin, mit der Initiative 4.6. aus Kassel. Wir haben regen Kontakt. Dadurch ist das Ganze kraftvoller. Wir haben einen gemeinsamen Plan. Zustande gekommen ist dieses Netzwerk am Birlikte-Festival, wo wir unterschiedliche Initiativen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen hatten. Im Vorfeld des Festivals haben wir uns vormittags ausgetauscht und daraus ist dieses Netzwerk entstanden, in dem wir unsere Aktionen planen und uns gegenseitig auf dem Laufenden halten. Im Schauspiel Köln sitzen die richtigen Personen an der richtigen Stelle. Wir hatten die Räume, die Technik, die Infrastruktur, um Podiumsdiskussionen zu machen, Filme zu zeigen und um unsere Treffen zu initiieren. Dadurch hatten wir das Privileg, uns auf das Wesentliche konzentrieren zu können, weil dadurch natürlich ganz viel Stress wegfällt, wenn man im Vorfeld nicht noch alles organisieren muss. Das Schauspielhaus hat bei Birlikte, auch in der Zeit danach, und auch das Cafe Sabahci, so viel geholfen.“
Resümee
Die entstandenen Initiativen sind angesichts der damit erzeugten Öffentlichkeit ein wichtiger Prozess innerhalb einer zivilgesellschaftlichen Formierung. Eine Gefahr liegt darin, dass die Opfer als StatistInnen instrumentalisiert werden könnten, wenn sie lediglich in ihrer Rolle als Opfer gesehen und repräsentiert werden. Aus diesem Grund muss die Differenzierung in (deutsche) »Experten« und »Betroffene« immer wieder kritisch reflektiert werden. Die Forderung der Menschen aus der Keupstraße ist in der Essenz nach wie vor die Folgende: „Wir gehören hierhin und wollen gleichberechtigt und in Frieden hier leben können.“ Die lückenlose Aufklärung der NSU-Mordserie und der Schutz vor weiteren Anschlägen sind in dieser Forderung inbegriffen.
Blickt man aus der Perspektive der Rassismusanalyse auf den Prozess der kollektiven Bearbeitung, wie sie in der »Initiative Keupstraße« stattfindet, so zeigt sich, dass dabei aktuell von unten nach oben über die Geschichte des Rassismus in Deutschland verhandelt wird und neues Wissen entsteht, dass direkt von Betroffenen stammt und gehört werden sollte. Es bleibt zu hoffen, dass die Bundesrepublik darauf reagiert.
Anmerkungen
1) Die »migrantischen« Perspektiven beruhen auf Leitfaden-Interviews, die ich im Oktober und November 2014 mit Geschäftsleuten und Kölner BürgerInnen mit Migrationshintergrund geführt habe, sowie auf teilnehmenden Beobachtungen auf diversen Veranstaltungen zum NSU-Komplex.
2) Dies war am 20. Januar 2015 der Fall; der Termin lag parallel zur Fertigstellung dieses W&F-Dossiers.
Ayla Güler Saied ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Universität zu Köln und der FH Bielefeld. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Rassismus, Migration, Gender und Cultural Studies sowie Jugendkulturen. Güler Saied ist seit Dezember 2013 Projektreferentin im Dachverband der Migrantinnenorganisationen.
zum Anfang Die vergessenen Morde an Shlomo Lewin und Frieda Poeschke
von Ulrich Chaussy
Shlomo Lewin und Frieda Poeschke wurden am frühen Abend des 19. Dezember 1980 ermordet, einem Freitag. Tatort war die gemeinsame Wohnung der Opfer in der Erlanger Ebradstraße 20; die Tatzeit konnte durch die Ermittlungen ziemlich exakt auf die Zeit zwischen 18:40 und 19:00 Uhr eingegrenzt werden. Schon um 19:08 Uhr wurden die beiden Toten von einer entfernten Verwandten entdeckt – und es gab eine Zeugenbekundung, die eine Person mit Sonnenbrille und dunklen, sehr lockigen Haaren, eventuell einer Perücke, etwa ab 18.30 vor dem Haus beobachtet hatte. Aus der Tatortsituation und dem schnellen Tatablauf ergab sich, dass der – oder möglicherweise die – Täter von vorneherein nur zu dem Zweck gekommen war, Lewin und Poeschke zu töten. Es gab keine Spuren eines Kampfes, einer Gefangennahme oder einer Fesselung der beiden Opfer vor ihrer Tötung. Erst wurde Shlomo Lewin, der offenbar die Tür geöffnet hatte, noch in der Diele mit vier Schüssen niedergestreckt. Dann bemerkte der Mörder offenbar Frieda Poeschke, die er sofort danach am Eingang zum Wohnzimmer mit ebenfalls vier Kugeln tötete. Es waren keine Wertsachen entwendet oder Dokumente durchwühlt worden, es handelte sich also nicht um die Tat eines Einbrechers oder Raubmörders.
Spärliche Anhaltspunkte und eine öffentliche Demontage
Am Tatort wurden acht Patronenhülsen des Kalibers 9 mm gefunden, aus den Projektilen konnte erschlossen werden, dass die Tatwaffe eine Maschinenpistole der Marke Beretta gewesen sein musste. Im Labor des BKA fanden Spezialisten heraus, dass der Lauf der Waffe vorübergehend verlötet gewesen sein dürfte. Das hätte die Ermittler vielleicht stutzig machen und gleich an die seit Mitte der 1970er Jahre im nur 14 Kilometer entfernten Ermreuth residierende neonazistische Wehrsportgruppe (WSG) Hoffmann denken lassen können. Immerhin war am 12. Juli 1977 auf eine der zahlreichen parlamentarischen Anfragen zur Gefährlichkeit der seit 1974 aktiven Wehrsportgruppe im Parlament geantwortet worden, „dass das Betreiben des »Wehrsports« selbst keine strafbare Handlung darstellt; gleiches gilt für die Ausbildung an verschweißten Waffen.“ Die Morde, bemerkten die Ermittler, hatten den Charakter einer Hinrichtung, wobei die Vielzahl der Schüsse darauf verwies, dass die Morde offenbar nicht von einem Profikiller begangen worden waren. Ein solcher hätte wahrscheinlich auch weder eine »Sonnenbrille, Schubert-Modell 27 54/16« noch ein Blechstück am Tatort zurückgelassen, das einem selbstgebauten Schalldämpfer für die Mordwaffe zugeordnet werden konnte.
Die Anhaltspunkte der Ermittler unmittelbar nach der Tat waren spärlich. Polizei und Staatsanwaltschaft waren daher gehalten, alle möglichen Täter- und Motivkreise in Erwägung zu ziehen. Das impliziert Einschätzungen der Persönlichkeiten der Ermordeten und ihrer Lebensverhältnisse, ihrer privaten, beruflichen und politischen Positionen und Beziehungen – eine Arbeit, die mit gutem Grund nicht auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit stattzufinden hat. Aber es kam anders.
Schon am Montag, keine drei Tage nach der Tag, setzte eine Berichterstattung ein, die sich weniger auf die Ermittlung und Überführung des oder der Mörder richtete, sondern ohne präzise genannte Quellen über das Opfer spekulierte. So formulierten die »Nürnberger/Erlanger Nachrichten« Titel- und Untertitelzeilen wie „Nach dem Tod des jüdischen Verlegers wird über Ungereimtheiten seiner schillernden Vergangenheit gerätselt“ oder „Viele Fragezeichen im Leben des Shlomo Lewin“ sowie „Er will persönlicher Adjutant Dajans gewesen sein, doch der kann sich nicht erinnern. Gerüchte wuchern: war er Mitarbeiter des Geheimdienstes.“
Vermutlich beruht das Dementi, das auch israelische Zeitungen wie »Haaretz« und »Jedioth Achronot« dazu brachte, den Ruf Lewins durch Bezeichnungen wie „Hochstapler“ oder „Intrigant“ zu beschädigen, auf einer Verwechslung des »Sechstagekrieges« 1967 und des »Unabhängigkeitskrieges« 1948. Zum Zeitpunkt des ersteren lebte Lewin bereits in Deutschland, 1948 war er als Mitglied der jüdischen Untergrundorganisation Haganah im Stab von General Moshe Dajan tätig. Nur knapp erwähnten die Presseberichte die Würdigung Lewins mit dem Bundesverdienstkreuz aufgrund seines Beitrages zur deutsch-jüdischen Verständigung und zum deutsch-israelischen Jugendaustausch, seine Tätigkeit als Vorsitzender in der Nürnberger Kultusgemeinde und seine Funktion als geschäftsführender Vorsitzender der Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit in Erlangen.
Der auf die Pietät gegenüber Verstorbenen gerichtete Grundsatz »De mortuis nil nisi bene« (von den Toten soll man nur gut sprechen) wurde im Dezember 1980 auf verstörende Art und Weise durchbrochen und auf den Kopf gestellt– mit einer nicht zu unterschätzenden subtilen Wirkung auf die Wahrnehmung dessen, was am 19.12.1980 in Erlangen geschah. Denn bei uns Zuschauern bewegt die Infragestellung der moralischen Integrität von Personen etwas, wenn diese zum Opfer von Gewalttaten werden: Wir werden zögerlich in der Solidarisierung mit den Opfern, wir lassen womöglich nach in der Schärfe der Verurteilung von Tat und Täter, in unserem Drängen nach vollständiger Aufklärung.
Freispruch vom Mordvorwurf für Karl-Heinz Hoffmann
Nach den spekulativen Berichten im Dezember 1980 wurde es fünf Monate äußerst still um die Mordermittlung, die nach Auskunft des Nürnberger Historiker Andreas Clemens zunächst vorwiegend im persönlichen und organisatorischen Umfeld Lewins stattfand. Diese Ermittlungsrichtung änderte sich Ende Mai 1981. Zu diesem Zeitpunkt wurde gemeldet, die am Tatort zurückgelassene Sonnenbrille habe Franziska Birkmann, der Lebensgefährtin des Wehrsportgruppenchefs Karl-Heinz Hoffmann, gehört. Bei den darauf folgenden Durchsuchungen wurde auch eine Perücke gefunden, wie sie der Täter laut einer Zeugenbeschreibung getragen haben könnte.
Mit der Verhaftung Hoffmanns am Frankfurter Flughafen im Juni 1981 endete auch der Aufenthalt der WSG im Libanon, wohin ein Teil der Gruppe nach dem Verbot durch Bundesinnenminister Baum im Januar 1980 gegangen war. Dort war die Situation unter den »Kameraden« eskaliert; ein WSG-Mitglied, Kay-Uwe Bergmann, wurde zu Tode gefoltert, ein anderer, Uwe Behrendt, beging Selbstmord.
Im Januar 1983 klagte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth Hoffmann an, Uwe Behrendt mit dem Mord an Shlomo Lewin beauftragt zu haben, um sich gegenüber der im Libanon gastgebenden palästinensischen Befreiungsorganisation PLO für die gewährte Unterstützung erkenntlich zu zeigen und zu beweisen, dass er und seine Männer nützliche Partner der PLO seien. In der Anklageschrift hieß es weiter: „Lewin wurde allein deshalb als Opfer ausgewählt, weil er als einer der Repräsentanten der jüdischen Mitbürger im Raum Nürnberg/Erlangen galt, der früher in führenden Positionen im Staat Israel tätig gewesen ist und sich öffentlich als entschiedener Gegner des Angeschuldigten Hoffmann exponiert hat.“
Bis es am 12. September 1984 mit großer Verzögerung zur Eröffnung des Prozesses gegen Karl-Heinz Hoffmann und Franziska Birkmann kam, geschah Entscheidendes, das den günstigen Verlauf des Verfahrens für den Angeklagten vorprägte.
Erstens: Hoffmann errang einen juristischen Etappensieg beim Bundesgerichtshof. Alle Vorgänge im Zusammenhang mit der WSG-Libanon durften nicht, wie von Generalbundesanwalt Rebmann ursprünglich beabsichtigt, unter dem Gesichtspunkt der »Bildung einer terroristischen Vereinigung« nach §129a Strafgesetzbuch ins Verfahren einfließen, da der Paragraf nur für das Bundesgebiet gelte.
Zweitens: Hoffmann bezog eine sichere Rückzugsposition mit einem Teilgeständnis, das den zentralen Vorwurf, den Mordauftrag an den Täter Uwe Behrendt erteilt zu haben, aushebelte.
Da durch polizeiliche Ermittlung gesichert war, dass Behrendt tatsächlich im Libanon ums Leben gekommen war und nicht mehr aussagen konnte, behauptete Hoffmann, dass Behrendt sich Waffe, Sonnenbrille und Perücke ohne Hoffmanns und Birkmanns Einverständnis und Kenntnis genommen habe. Behrendt sei aus eigenem Entschluss nach Erlangen gefahren und habe die Morde alleine begangen. Unmittelbar danach sei Behrendt noch am Abend des 19.12. nach Ermreuth zurückgekehrt und habe Hoffmann die Morde gestanden. Dieser habe daraufhin die Kleidung Behrendts verbrannt und ihm Geld gegeben, damit er sich umgehend in den Libanon absetzen konnte.
Diese Version klärt jedoch nicht das Motiv Behrendts, der erst zwei Monate vor dem Mord nach Ermreuth gezogen war, und die Auswahl der Opfer. Zu nennen ist hier zum einen die von Hoffmann wiedergegebene Äußerung Behrendts, derzufolge es sich um »Rache für München« gehandelt habe. Damit wird auf die auch von Hoffmann verbreitete Verschwörungstheorie angespielt, der tödliche Anschlag auf das Oktoberfest 1980 in München mit vielen Toten und mehr als 200 Verletzten sei das Werk von Juden gewesen und Hoffmann in die Schuhe geschoben worden. Zum anderen hatte sich Hoffmann in der von ihm verantworteten Zeitung »Kommando« der WSG im März 1979 mit der Synagoge in Ermreuth und mit Shlomo Lewin befasst. Und er wusste aus einer Reportage, die das italienische Magazin »OGGI« 1977 über Hoffmann gemacht hatte und von der er eine Übersetzung anfertigen ließ, dass Lewin ein scharfer Kritiker des Neonazismus und der WSG war.
Brisant aber werden diese Details erst, wenn man betrachtet, wann, wo und in welchen Situationen er von diesem Artikel Gebrauch machte. Beschlagnahmt wurde der Artikel bei der Durchsuchungsaktion in Hoffmanns Wohnsitz Ermreuth am Tag nach dem Oktoberfestattentat. Und er tauchte in Zeugenschilderungen ehemaliger WSG-Libanon-Mitstreiter Hoffmanns auf, und zwar bei Hoffmanns Gesprächen mit seinen arabisch-palästinensischen Gastgebern, mit denen er politisch zu kooperieren versuchte – mit denen er kooperieren musste, um seine Operationsbasis im Libanon sicherzustellen. Berichtet wurde, dass Hoffmann die OGGI-Reportage seinen palästinensischen Gesprächspartner gegenüber wie einen gut bebilderten Werbeprospekt genutzt zu haben scheint – als eindrucksvollen Beweis seiner Fähigkeiten als Milizenführer. Dass nun ausgerechnet bei diesen Verhandlungen, in der es um gegenseitige politische Tauschgeschäfte und Dienstleistungen ging, die OGGI-Reportage nicht nur die Leistungsfähigkeit der Hoffmann-Miliz WSG unter Beweis stellen sollte, sondern zugleich mit Shlomo Lewin einen gemeinsamen Feind Hoffmanns und seiner palästinensischen Partner wie auf dem Silbertablett präsentierte, verdient besondere Aufmerksamkeit. Denn über Shlomo Lewin wird in diesem Artikel berichtet, er habe als Angehöriger der Haganah im Unabhängigkeitskrieg an der Seite Moshe Dayans gekämpft – und somit gegen die Palästinenser. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso diese Zusammenhänge in der Nürnberger Gerichtsverhandlung keine prominente Beachtung fanden und nicht mit aller Konsequenz untersucht wurden.
Karl-Heinz Hoffmann wird am 30. Juni 1986 zu neuneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wegen Herstellen von Falschgeld, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, unerlaubtem Waffen- und Sprengstoffbesitzes. Vom ursprünglich zentralen Vorwurf, den Mord an Shlomo Lewin und Frieda Poeschke in Auftrag gegeben zu haben, wird er jedoch freigesprochen.
Die Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet ist, will nicht vergehen
Karl-Heinz Hoffmann nutzt bis heute das Vakuum, das die Nürnberger Gerichtsverhandlung der Jahre 1984 bis 1986 über den Erlanger Doppelmord und die Karlsruher Ermittlungen des Generalbundesanwalts Kurt Rebmann zum Oktoberfestattentat zwischen 1980 und 1982 gelassen haben. Geschickt präsentiert er seine Sicht der Dinge. Im Internet breitet er verschwörungstheoretische Spekulationen aus. In ihnen stilisiert sich der einstige »Chef«, wie er sich in seiner Truppe nennen ließ, die in den 1970er Jahren Drehscheibe und wichtiger nationaler und internationaler Treffpunkt gewaltbereiter Rechtsextremisten aus ganz Europa gewesen war, als Opfer. Finstere andere Mächte sollen Regie geführt haben und zunächst den Anschlag auf das Oktoberfest einzig zu dem Zweck inszeniert haben, die Tat ihm in die Schuhe zu schieben und ihn als Nazi zu diskreditieren.
Und wen beschuldigt Hoffmann – an alte, tief sitzende antisemitische Stereotype appellierend, mit haltlosen und infamen Spekulationen? Mal spricht er vage von den »Israeliten«, mal eher handfest vom israelischen Geheimdienst Mossad. Es gibt aus meiner Sicht nur ein Antidot, ein Gegengift gegen solcherart Propaganda: Aufklärung, eine kritische Korrektur der mangelhaften justiziellen Aufarbeitung von Gewaltverbrechen und Terroranschlägen mit rechtsextremistischem Hintergrund in den vergangenen Jahrzehnten – darunter das Oktoberfestattentat und der Doppelmord an Shlomo Lewin und Frieda Poeschke.
Ulrich Chaussy ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher zum Nationalsozialismus und zum Attentat auf das Münchner Oktoberfest. Es ist auch seinen hartnäckigen Recherchen zu verdanken, dass Generalbundesanwalt Harald Range am 11. Dezember 2014 die Wiederaufnahme der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat anordnete.
Der Text geht auf eine Rede zurück, die der Autor zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in Erlangen im März 2011 hielt.
zum Anfang „… nicht ernst genommen“
Opfer rechter Gewalt und die Polizei
von Matthias Quent und Daniel Geschke
Jahrelang wurden Angehörige der vom »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) Getöteten verdächtigt, an kriminellen Machenschaften beteiligt oder gar für die Tötung der eigenen Familienmitglieder verantwortlich zu sein. Trotz deutlicher Hinweise und Appelle an die Polizei, die Täter_innen1 seien im rechtsextremen Milieu zu suchen, erwiesen sich die Ermittlungsbehörden sprichwörtlich als auf dem rechten Auge blind. Das Versagen der Behörden, stellte Eva Högl, die Obfrau der SPD im Untersuchungsausschuss des Bundestages fest, beruhe zum großen Teil auf „routinierten, oftmals rassistisch geprägten Verdachts- und Vorurteilsstrukturen in der Polizei“ (Carstens 2013). Der Zentralrat der Muslime in Deutschland kritisierte „Vorurteilsstrukturen bei den Behörden gegenüber bestimmten Minderheiten und Gruppen, die dem strukturellen Rassismus in Deutschland Vorschub leisteten“ (ebd.). Vertreter_innen der Polizei reagierten empört auf die Vorwürfe.
Fest steht, dass die Angehörigen durch Polizeiermittlungen wegen zu Unrecht vermuteter krimineller bzw. mafiöser Verbindungen nach ihren tragischen Verlusten ein zweites Mal schwer geschädigt und in ihrem Vertrauen in den Rechtsstaat auf die Probe gestellt wurden. Diese nochmalige Opferwerdung wird in den Sozialwissenschaften als »sekundäre Viktimisierung« bezeichnet, „bei der der Betroffene durch eine unangemessene Reaktion seitens seines sozialen Nahraums und der Instanzen sozialer Kontrolle verletzt wird“ (Kiefl und Lamnek 1986). Gerade behördenvermittelte Erfahrungen sekundärer Viktimisierung können bei den Opfern zu einem massiven Vertrauensverlust in die Institutionen des demokratischen Rechtsstaates führen. Die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt wiesen in einer gemeinsamen Erklärung anlässlich des zweiten Jahrestages der Selbstenttarnung des NSU darauf hin, dass noch immer „viele Betroffene mit Polizeibeamten und Staatsanwaltschaften konfrontiert [sind], die rassistische Motive ignorieren oder verharmlosen oder den Betroffenen eine Mitverantwortung für die Angriffe zuschreiben“ (ezra et al. 2011). Von derartigen Schilderungen berichten die Beratenden der Opferberatungsprojekte in zahlreichen Fällen. Statistische Untersuchungen darüber, welche Wahrnehmungen und Erfahrungen Opfer rechter Gewalt bei ihren Kontakten mit der Polizei machen, existierten bisher nicht. Hier setzt diese Untersuchung an.2
Diskriminierung, Gewalt und die Wahrnehmungen der Opfer
Menschen tendieren dazu, Opfererfahrungen anderer auszublenden und sich mit dem Schicksal von Gewaltopfern nicht näher befassen wollen. Dies ist in der menschlichen Psyche verankert: Psycholog_innen weisen auf die Neigung hin, die Existenz von Opfern möglichst zu verdrängen oder bei ihnen eine Mitschuld zu vermuten, um nicht an die eigene Schwäche erinnert zu werden oder Schuldgefühle bei sich selbst zu erwecken (Bolick 2010). Abgewehrt wird zudem die Infragestellung gesellschaftlicher Machtverhältnisse, die sich im Umgang mit sozialen Minderheiten zeigen. Denn die Opfer rechter Gewalt unterliegen meist über die rechtsextremistische oder rassistisch motivierte Gewalttat hinaus „der Durchsetzung eines länger andauernden Machtverhältnisses, das auch nach dem Übergriff durch die Androhung weiterer Gewaltausübung aufrechterhalten wird. […] Opfer rechtsextremistischer Macht haben in der Regel unter einer lang währenden Unterordnung ihrer Person unter einen Täter bzw. eine Tätergruppe zu leiden.“ (Böttger et al. 2014)
Nicht nur rechte Gewalttäter_innen sind gruppenbezogen menschenfeindlich eingestellt. 2014 stimmten über 50% der deutschen Bevölkerung abwertenden Aussagen gegenüber Sinti und Roma zu; bis zu Dreiviertel der Bevölkerung werteten Asylbewerber_innen ab (Decker et al. 2014). Diesen in der Gesellschaft vorhandenen Ungleichwertigkeitsvorstellungen liegt die Ideologie zugrunde,„dass Ungleichwertigkeit von Gruppen die Gesellschaft bestimmt und dies auch gut so [ist]“ (Groß et al. 2012). Diese Hierarchisierung der sozialen Gruppen in der Gesellschaft dient Täter_innen schließlich „als Legitimation von […] massiver Anwendung von Gewalt“ (Heitmeyer 2003). Dass menschenfeindliche Denkweisen von Teilen der Gesellschaft geteilt werden, „begründet umgekehrt für die Betroffenen die Angst vor erneuter Viktimisierung. In der Regel trifft rechte Gewalt Menschen, die vielfältiger Diskriminierung unterworfen sind, und denen in der Gesellschaft subalterne, d.h. untergeordnete Positionen zugewiesen werden. Oft werden MigrantInnen mehrfach Opfer von Gewalt. Sehr oft haben sie schon zuvor eine Vielzahl von Abwertungen wie Beleidigungen und Herabwürdigungen erfahren.“ (Köbberling 2010)
Primäre und sekundäre Viktimisierung
Viktimisierung bezeichnet den Prozess des Zum-Opfer-Werdens. Dieser Prozess besteht aus „Interaktionen von Täter, Opfer und anderen [Nicht-] Akteuren und ist durch unterschiedliche Dispositionen und Tatfolgen gekennzeichnet“ (Bolick 2010, S.39). Dabei werden mehrere Formen unterschieden.
»Primäre Viktimisierung«umfasst die eigentliche Opferwerdung, also die Schädigung einer oder mehrerer Personen durch einen oder mehrere Täter_innen. Ausgelöst und beeinflusst wird diese Phase durch verschiedene Situationsmerkmale, Opfereigenschaften, Opferverhalten, die Art der Täter-Opfer-Beziehungen und Tätereigenschaften (Kiefl und Lamnek 1986, S.170).
»Sekundäre Viktimisierung« ist eine Verschärfung der primären und entsteht durch Fehlreaktionen des sozialen Nahraums von Betroffenen (Freund_innen, Bekannte, Familienangehörige) und/oder Instanzen der formellen Sozialkontrolle (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte) nach der primären Opferwerdung. Sie entsteht also nicht unmittelbar aus der Tat, „sondern [wird] durch Akteure produziert […], welche mit dem Opfer der Straftat irgendeinen Umgang haben (und zwar im Hinblick auf dessen primäre Viktimisierung)“ (Kölbel und Bork 2012). Die Polizei ist für Betroffene häufig der erste Kontakt nach einer Tat. Die Geschädigten erwarten, dass sie als Opfer ernst genommen werden, Gehör und Beachtung finden und konkrete Hilfe erfahren (Haupt et al. 2003). Ein Problem besteht dabei in den unterschiedlichen Betrachtungs- und Herangehensweisen von Polizei und Betroffenen. Für Letztere ist klar, dass sie das Opfer der Tat sind. Die Polizei hingegen muss zunächst versuchen, die Situation unabhängig zu beurteilen. Zu ihrem Auftrag gehört es, vor Ort Be- und Entlastendes zusammenzutragen.
Sekundäre Viktimisierung kann im Umgang mit der Polizei ebenso wie beim sozialen Umfeld aus Bagatellisierung, unsensiblem Verhalten und Mitschuldvorwürfen resultieren. Ein sensibles, verständnisvolles Vorgehen ist auch unter Beibehaltung von Distanz und Sachlichkeit möglich, ebenso das Ansprechen von Widersprüchlichkeiten, ohne eine Vorwurfshaltung einzunehmen (FröhlichWeber 2008). Viktimiolog_innen empfahlen daher bereits 1986, „gerade solche Vertreter der formellen sozialen Kontrolle mehr als bisher mit der Problematik der sekundären Viktimisierung vertraut zu machen, die erfahrungsgemäß im Rahmen ihrer Alltagsroutine weniger mit den Opfern schwerwiegender Straftaten zu tun haben“ (Kiefl und Lamnek 1986, S.252f.).
Ergebnisse einer empirischen Studie in Thüringen
Der im Zuge der NSU-Debatte bekannt gewordene, skandalöse Umgang der Ermittlungsbehörden mit den Angehörigen der Opfer warf mit neuer Brisanz die Frage danach auf, wie verbreitet die Schädigung von Gewaltopfern durch die Polizei ist. Die vorliegende Untersuchung wollte darauf Antworten geben. Dazu wurden zwischen Frühling und Sommer 2014 standardisierte Telefoninterviews mit Opfern rechter Gewalt aus Thüringen geführt. Erfragt wurden u.a. die Wahrnehmungen des polizeilichen Handels in und direkt nach der Tatsituation. Der Zugang zu den Interviewpartner_innen erfolgte über die Thüringer Opferberatungsstelle ezra.3 Die statistische Auswertung erfolgte auf der Basis von 44 vollständigen Interviews. Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse der Studie knapp zusammengefasst.:
- Ungefähr jede_r zweite Befragte fühlte sich hinsichtlich der Tatsituation durch die Polizei nicht ernst genommen und hatte nicht das Gefühl, die Polizei behandle sie_ihn als Betroffene_n der Gewalttat.
- Jede_r Vierte fühlte sich durch die Polizei nicht anständig behandelt.
- Jede_r Zweite sah sich mit Vorurteilen seitens der Polizeibeamt_innen konfrontiert.
- Jede_r Dritte war nicht der Ansicht, die Polizist_innen hätten vor Ort ihre Pflicht erfüllt, Be- und Entlastendes für eine Tatbeteiligung zu finden.
- Über die Hälfte der Befragten bezweifelte, dass die Polizeibeamt_innen in der Tatsituation wirklich an der Aufklärung der politischen Tathintergründe interessiert waren.
- Knapp ein Drittel der Befragten fühlte sich durch Vorwürfe der Polizist_innen erneut geschädigt.
- Ein Drittel der Befragten fühlte sich durch das Auftreten der Polizist_innen eingeschüchtert.
- Fast die Hälfte fühlte sich ungerecht behandelt.
- Zudem berichtete ungefähr ein Fünftel der Befragten, von der Polizei für die Eskalation verantwortlich gemacht worden zu sein.
- Insgesamt, so zeigen die Ergebnisse, fühlten sich zwischen 12% und 31% der Befragten durch verschiedene Aspekte des Verhaltens der Polizeibeamt_innen in der Tatsituation erneut viktimisiert, z.B. als Täter_in (statt als Opfer) oder als Mensch zweiter Klasse behandelt oder in seinen_ihren Menschenrechten verletzt.
Es wird deutlich, dass das polizeiliche Handeln in der Tatsituation ebenso wie im Nachtatbereich oft Anlass zur Kritik gab. Infolgedessen sank das Vertrauen in die Polizei. Die Befragungsergebnisse zeigen zudem, dass es sich bei den geschilderten Problemen nicht um Einzelfälle handelt.
Resümee
Mit der gesellschaftspolitischen, öffentlichen und juristischen Aufarbeitung der Faktoren, die über ein Jahrzehnt hinweg nicht zur Enttarnung der NSU geführt hatten, gewann die Debatte um rechte Gewalt und die Rolle der Ermittlungsbehörden an Fahrt. Parlamentarische Untersuchungsgremien im Bund und in mehreren Bundesländern legten ausführliche Dokumentationen, Problembeschreibungen und Empfehlungen für Reformen des Sicherheitsapparates vor – mit dem Ziel, die Effektivität der Verfassungsschutzämter und der Polizei zu verbessern und somit die Fähigkeit zur Kontrolle über Täter_innen zu erhöhen. Während in anderen westlichen Staaten unabhängige Kommissionen, Medien, Zivilgesellschaft und Wissenschaft die Debatte über die Ursachen von polizeilichem Rassismus führen, werden hierzulande die strukturellen und inneren Gründe polizeilichen Fehlverhaltens in erschreckendem Maße bagatellisiert, ignoriert oder als Einzelfälle abgetan. Die Perspektive der davon betroffenen Personen und Gruppen nimmt – trotz der aufrüttelnden Erfahrungsberichte und Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur NSU-Mordserie – weiterhin keine zentrale Rolle ein.
Die nun vorliegende Studie stellt zum ersten Mal empirisch dar, wie sich Betroffene rechter Gewalt fühlen und welche Erfahrungen sie mit der Polizei machen. Es offenbarte sich im Verlauf des Projektes weiterer Forschungsbedarf. Eines jedoch ist jetzt schon evident: Negative Erfahrungen mit der Polizei derer, die als Opfer rechter Gewalt Hilfe suchen, sind keine Einzelfälle.
Anmerkungen
1) Wir verwenden in diesem Beitrag i.d.R. den so genannten Gender_Gap, um alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten darzustellen. Intention ist es, durch den Zwischenraum auch diejenigen Menschen sprachlich einzuschließen, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren (wollen).
2) Ausführliche Ergebnisse finden sich in: Matthias Quent, Daniel Geschke, Eric Peinelt (2014): Die haben uns nicht ernst genommen. Eine Studie zu Erfahrungen von Betroffenen rechter Gewalt mit der Polizei. Jena: ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen.
3) ezra (ezra.de) ist die mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Beraten, begleitet und unterstützt werden von ezra Menschen, die aus Motiven gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit angegriffen werden – also deshalb, weil die Täter_innen sie einer von ihnen abgelehnten Personengruppe zuordnen.
Literatur
Kay Bolick (2010): Spezialisierte Opferberatung im Kontext rechter Gewalt. Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung, Diplomarbeit.
Andreas Böttger, Olaf Lobermeier, Katarzyna Plachta (2014): Opfer rechtsextremer Gewalt. Wiesbaden: Springer VS, S.42.
Peter Carstens (2013): NSU-Opfer kritisieren Untersuchungsausschuss. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.08.2013.
Oliver Decker, Elmar Brähler, Johannes Kiess (2014): Die stabilisierte Mitte – Rechtsextreme Einstellung in Deutschland 2014. Leipzig: Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig, S.50.
ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen; Kulturbüro Sachsen e.V.; LOBBI – Landesweite Opferberatung, Beistand und Information für Betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern u.a. (2011): Was jetzt zu tun ist. tageszeitung, 20.11.2011.
Beate FröhlichWeber (2008): Das polizeiliche Ermittlungsverfahren. In: Friesa Fastie (Hrsg.): Opferschutz im Strafverfahren. Opladen: Barbara Budrich, S.75.
Eva Groß, Andreas Zick, Daniela Krause (2012): Von der Ungleichwertigkeit zur Ungleichheit: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Aus Politik und Zeitgeschichte (APUZ) 16-17/2012.
Holger Haupt, Ulrich Weber, Ulrich, Sigrid Bürner (2003): Handbuch Opferschutz und Opferhilfe. 2. Aufl.: Nomos, S.60.
Wilhelm Heitmeyer (2003): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die theoretische Konzeption und empirische Ergebnisse aus 2002 sowie 2003. In: ders. (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.19.
Walter Kiefl, Siegfried Lamnek (1986): Soziologie des Opfers. Theorie, Methoden und Empirie der Viktimologie. München: Fink, S.239.
Gesa Köbberling (2010): Rechte Gewalt – Beratung im interkulturellen Kontext. In: Jutta Hartmann (Hrsg.): Perspektiven professioneller Opferhilfe. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Handlungsfelds. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft (VS Research), S.90.
Ralf Kölbel, Lena Bork (2012): Sekundäre Viktimisierung als Legitimationsformel. Berlin: Duncker & Humblot, S.39.
Matthias Quent ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit den Arbeitsschwerpunkten politische Soziologie und Rechtsextremismus. Dr. Daniel Geschke ist Kommunikations- und Sozialpsychologe und Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zu seinen Forschungsinteressen gehören die Beziehungen zwischen sozialen Gruppen, Intergruppenkommunikation, Migration, Vorurteile, Diskriminierung.