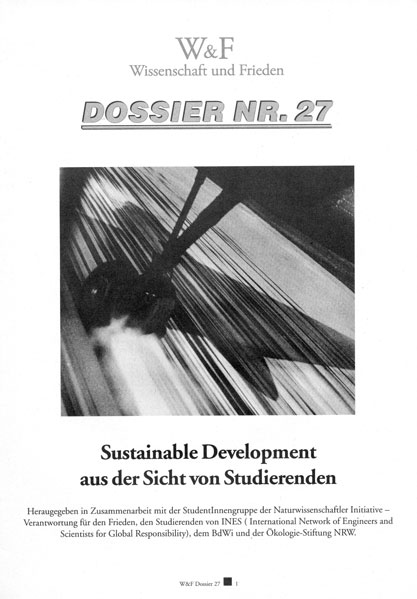Sustainable Development aus der Sicht von Studierenden
von Naturwissenschaftler Initiative, INES, BdWi, Ökologie-Stiftung NRW
In Zusammenarbeit mit der StudentInnengruppe der Naturwissenschaftler Initiative – Verantwortung für den Frieden, den Studierenden von INES ( International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility), dem Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlert (BdWi) und der Ökologie-Stiftung NRW.
Zu diesem Dossier
Ziel dieses Dossiers ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung (sustainable Development; UNCED 1992) und den daraus abzuleitenden Anforderungen an die Hochschulentwicklung.
Die Reform von Lehre, Forschung und der Institution Hochschule im Sinne der nachhaltigen Entwicklung ist schon deshalb besonders schwierig, weil der englische Begriff »sustainable development« mit mehr als 70 unterschiedliche Definitionen in der Literatur konkretisiert wird. Dabei gewinnt man gelegentlich den Eindruck, daß die Beliebtheit des Begriffes aus seiner Beliebigkeit entstammt. Im folgenden wollen wir eine Definition bieten, die den Rahmen relativ weit faßt und deutlich macht, daß Nachhaltigkeit ein mehrdimensionales Konzept beinhaltet. Der Internationale Rat für lokale Umweltinitiativen (ICLEI) hat in diesem Zusammenhang den Begriff »Zukunftsbeständigkeit« geprägt. Wie der englische Begriff beinhaltet Zukunftsbeständigkeit eine soziale, ökologische und ökonomische Komponente:
Zukunftsbeständigkeit der Gemeinschaft: Konsens über Grundwerte, gesunde Lebensbedingungen und Verteilungsgerechtigkeit zwischen den derzeit lebenden Menschen und zwischen Generationen.
Voraussetzung hierfür ist die Zukunftsbeständigkeit des Wirtschaftssystems. Stützung auf menschliche Arbeit und erneuerbare Ressourcen statt auf Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen; Ökonomie mit niedriger Entropie.
Voraussetzung hierfür ist die ökologische Zukunftsbeständigkeit. Erhaltung der Artenvielfalt, der menschlichen Gesundheit sowie der Sicherung von Luft-, Wasser- und Bodenqualitäten, die ausreichen, um das Leben und das Wohlergehen der Menschen sowie das Tier- und Pflanzenleben für die Zukunft zu sichern. (Stefan Kuhl et al 1996, S. 118ff.)
Die Definition macht deutlich, welche komplexen Ansprüche und Ziele das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (hier Zukunftsbeständigkeit) beinhaltet. Das Dossier stellt aus Sicht von Studierenden notwendige Reformen von Lehre und Forschung sowie der Institution Hochschule dar. Die Thematik Hochschulreform durch nachhaltige Entwicklung wird aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und konkrete Alternativen werden skizziert. Die Vorstellung bereits vorhandener innovativer Projekte an Hochschulen in diesem Bereich zeigt konkrete Praxisbeispiele mit Vorbildfunktion. Wir können keinen auch nur annähernd vollständigen Überblick über die Problematik »Hochschule und Nachhaltigkeit« bieten. Jedoch ist es unser Ziel, die vorhandenen Ansätze in die Hochschulreformdebatte stärker einzubringen und auch bereits im »Kleinen« umzusetzen.
Jörn Birkmann, Sandra Striewski
zum AnfangSich wandelnde Anforderungen an Studierende
von Sandra Striewski
Der Anspruch an die Studierenden zwischen Universität und Praxis hat sich in den letzten Jahren immer mehr scherenförmig auseinander entwickelt. So wird einerseits in der Praxis immer mehr soziale Kompetenz, Engagement und fächerübergreifendes Wissen erwartet, das Arbeiten in Gruppen und neue Formen des Teamworks sind gang und gäbe. Andererseits wird in der Universität immer mehr spezielles Fachwissen vermittelt und gefordert, der disziplinäre Leistungsanspruch wird größer, wie z.B. die neu entflammte Diskussion um die Studiengebühren beim Überschreiten der Regelstudienzeit oder das Bestreben, daß sich Universitäten ihre Studierenden selbst auswählen dürfen, zeigen.
Selbst in Projektarbeiten, die die Zusammenarbeit und den Teamgeist fördern sollen, tritt der Wettbewerb immer stärker hervor. Außerdem vermissen viele Studierende fachübergreifendes Wissen innerhalb ihres Studienganges, um einen »Weitblick« zu erhalten und interdisziplinär arbeiten zu können. Noch immer denken Studierende in ihren fachbezogenen Kategorien, die Kommunikationsbarrieren innerhalb unterschiedlicher Fachbereiche sind erheblich.
Ethische Fragestellungen werden häufig ausgeklammert. Der Umgang mit verantwortlichem Handeln bleibt den Studierenden selbst überlassen. Es liegt an ihnen, sich mit ethischen Aspekten oder den potentiellen Folgen ihres Tuns auseinanderzusetzen, so z.B. durch das Bestreben technische Vorgänge zu optimieren. Der Blick für den Gesamtkontext kann verloren gehen, d.h. es geht letztlich nur darum, einen Vorgang zu effektivieren, unabhängig davon, ob es sich um einen Wärmetauscher eines Kohlekraftwerkes oder Atomkraftwerkes handelt, ob die Materialeigenschaften eines Metalls für die Raumfahrt verbessert werden sollen oder ob ein leichterer Kunststoff für eine Nachfolgegeneration der Tamagotschis hergestellt werden soll.
Situation
Zwei Drittel aller Studierenden müssen neben dem Studium arbeiten gehen, um sich ihren Lebensunterhalt sichern zu können. Immer mehr Studierende versuchen trotzdem, ihr Studium schnell zu absolvieren, um der wachsenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden und eine drohende Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Dies ist sicherlich ein Grund, warum sich immer weniger Studierende in politischen Gremien und außeruniversitären Initiativen engagieren.
Perspektiven
In NRW ist durch die Eckdatenverordnung eine neue Gesetzgebung geschaffen worden, um u.a. die lange Studiendauer zu verkürzen und Studiengänge zu »entrümpeln«. In einigen Fachbereichen haben sich Studierende und Professoren zusammengesetzt und gemeinsam nach der neuen Gesetzgebung neue Prüfungsordnungen entworfen.
Die Prüfungsmodalitäten sind dadurch erheblich verbessert worden, so ist ein schnelles Studium möglich. Dies entspricht den Anforderungen des Marktes und es erlaubt trotz knapper werdender Mittel der Hochschulen, eine größere Zahl Studierende durch die Hochschulen zu schleusen.
Die Chance, mehr soziale Kompetenzen besonders in technische Studiengänge zu integrieren, hängt jetzt von den Studierenden ab, da nun ein frei wählbarer Bereich – zumindest in einigen technischen Studienrichtungen – eingeräumt worden ist. Innerhalb dieses Bereiches können die Studierenden alle an der Universität angebotenen Vorlesungen und Seminare nutzen. Inwieweit diese Möglichkeit genutzt wird und die Anerkennung fachfremder Seminare erfolgt, wird sich in naher Zukunft zeigen. Die Veränderungen in Hinblick auf Praxisbezug sind aber nicht weitreichend genug. Die Eckdatenreform hat auf der einen Seite Verbesserungen ermöglicht, die einen größeren frei wählbaren Bereich beinhalten, andererseits aber wiederum die Konkurrenzsituation unter den Studierenden bei gleichbleibender sozialer Belastung und kürzer Studienzeit verschärft. Durch unterschiedliche bundesweite Studienreformen kann sich die Wettbewerbssituation unter den Hochschulen verstärken.
Die Studierenden und die Lehrenden stehen in der Verantwortung, die Hochschulpolitik neu zu gestalten, dafür ist mehr Demokratie in den politischen Gremien unbedingt notwendig. Der notwendige Paradigmenwechsel hin zu mehr Interdisziplinarität und der Orientierung an nachhaltiger Entwicklung an den Hochschulen muß jetzt, fünf Jahre nach dem Erdgipfel (UNCED) in Rio de Janeiro und der Copernicus-Charta, erfolgen.
Sandra Striewski ist Studentin der Chemietechnik und Vorstandsmitglied der Naturwissenschaftler-Initiative
zum AnfangNoch nicht erkannt. Nachhaltigkeit: Anforderungen an Hochschulen
von Jörn Birkmann
Die Hochschulen haben in den letzten Jahren nur wenig Impulse zur Lösung der globalen Umwelt- und Entwicklungskrise gegeben. Die hochgradige Spezialisierung und die damit einhergehende Förderung des Fachspezialistentums verstellen den Blick auf ganzheitliche Zusammenhänge und eine umfassende Folgenabschätzung der eigenen Lern-, Lehr- und Forschungsinhalte. Auch die enorme Technikgläubigkeit, mit der Vorstellung Umwelt und Gesellschaft technisch managen zu können, hat einen nicht unwesentlichen Anteil an der heutigen globalen Umwelt- und Entwicklungskrise.
Demgegenüber hat der Diskurs über die „Grenzen des Wachstums“ (Meadows, 1972) und eine auf Nachhaltigkeit zielende Entwicklung bis heute nur einen geringen Stellenwert in den Lern-, Lehr- und Forschungsaktivitäten der Universitäten. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bleibt für viele deutsche Hochschulen nur ein theoretisch zu diskutierender Begriff, an dessen praktischer Umsetzung aber nur wenig Interesse besteht. Jedoch sollten sich gerade die Hochschulen der Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung stellen und wichtige Impulse zur Lösung der globalen Umwelt- und Entwicklungskrise geben (vgl. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 1996, S. 28-29).
Eine Reform der Hochschulen unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, auf der Basis der intra- und intergenerativen Verteilungsgerechtigkeit, muß das gesamte System Hochschule auf den Prüfstand stellen. Um die notwendige Weichenstellung in Richtung einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung zu erreichen muß das Konzept auf Lehre und Forschung, wie auch auf die institutionelle Verfassung und den Betrieb der Hochschule Anwendung finden. Analog zu den Anforderungen an die Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Städte und Gemeinden (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1992), sollten auch die Hochschulen in Zusammenarbeit aller Hochschulmitglieder und unter der Mitwirkung weiterer gesellschaftlicher Akteure eine eigene Agenda für das 21. Jahrhundert aufstellen, die Wege zu einer nachhaltigen Hochschule aufzeigt.
Die Lehre muß den Studierenden die Grundlagen für einen verantwortungsvollen Umgang mit den globalen Herausforderungen bieten, stellen doch sie als angehende ForscherInnen, LehrerInnen, IngenieurInnen etc. ein besonderes Potential als gesellschaftliche MultiplikatorInnen dar. Die Frage, ob wir die globale Umwelt- und Entwicklungskrise lösen können, hängt nicht unwesentlich davon ab, ob wir das Problem erkennen. Deshalb muß die Thematik der nachhaltigen Entwicklung ein stärkeres Gewicht in allen Studienfächern bekommen. Da sich die komplexen ökologischen Probleme nicht an den Fachbereichsgrenzen der Hochschulen orientieren, sondern sich gerade als komplexe Mensch-Umwelt-Interaktionen darstellen, müssen die Gräben zwischen den Wissenschaftsdisziplinen überwunden werden. Anstatt monodisziplinärem EinzelkämpferInnentum müssen neue Lehr- und Lernformen, die nicht nur fachliche Grundlagen, sondern auch die Fähigkeit zum Teamwork und damit soziale Kompetenz vermitteln, erprobt werden. Wenn Wissenschaft nicht selbst zum Risiko werden soll, müssen Studierende und WissenschaftlerInnen den eigenen disziplinären Zugriff auf die Wirklichkeit kritisch betrachten und stärker als bisher die Folgen für die Gesellschaft reflektieren (vgl. Huber et al., S. 14).
Die Forschung ist der zweite wesentliche Bereich, der einer Neuorientierung im Sinne einer auf Nachhaltigkeit zielenden Entwicklung bedarf. Die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des immer noch weitgehend unreflektierten Umgangs mit Forschungsergebnissen sind erheblich. Deshalb muß sich eine verantwortungsvolle Forschungsförderung dem Ziel der Bewahrung der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen verpflichten. Forschung muß sich vom Leitbild einer wachstums- und angebotsorientierten Technik lösen und ökologische Kreisläufe und Verfahrensweisen zum Schutz des Menschen und Umwelt in den Mittelpunkt stellen.
Damit die Entwicklung und Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung nicht eine vorübergehende Erscheinung bleibt, ist eine institutionelle Verankerung in den Hochschulen notwendig. Für die Entwicklung von Lösungen und die Verständigung, welche Maßstäbe, beispielsweise für die intra- und intergenerative Verteilungsgerechtigkeit, angelegt werden sollen, sind gleichberechtigte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten aller Gruppen und Mitglieder der Hochschule, sprich eine Demokratisierung der Hochschule, erforderlich. Die momentanen Hochschulverfassungen mit ihren Kategorien: ProfessorInnen, Mittelbau und Studierende, spiegeln eher eine mittelalterliche Drei-Stände-Gesellschaft wider, in der der zahlenmäßig am höchsten vertretene Anteil, die Studierenden, mit den geringsten Machtbefugnissen ausgestattet ist. Diese Strukturen mit der eingebauten „ProfessorInnen-Mehrheit“ widersprechen den geforderten Eigenschaften eines selbständigen und eigenverantwortlichen Handelns. Gerade die Studierenden sollten die zukunftsweisenden Entscheidungen mitgestalten können, schließlich sind sie diejenigen, die hinterher mit ihnen umgehen müssen (vgl. Birkmann et al., 1997).
Zu guter Letzt sollten auch die Studierendenwerke an den Hochschulen stärker dem Konzept einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen. Die Verpflegungsbetriebe bieten ein weites Handlungsfeld. Die Reduzierung von Verpackung und die Verwendung von Lebensmitteln aus ökologischem und regionalem Anbau sowie fair gehandelte Produkte ermöglichen eine direkt meßbare Entlastung der Umwelt und leisten einen Beitrag zu einem Mehr an globaler Gerechtigkeit.
Fazit
Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 verlangt einen zukunftsfähigen Umbau aller Bereiche der Hochschule, von der Lehre über die institutionellen Strukturen bis zum Betrieb. Die Schaffung einer nachhaltigen Hochschule bedarf also nicht nur Anstrengungen einzelner Personen, sondern aller für die Hochschule verantwortlichen Gruppen: PolitikerInnen in Bund und Ländern, WissenschaftlerInnen, Angestellte, Studierende und ihre jeweiligen Interessensvertretungen. In einem gemeinsamen Lern- und Gestaltungsprozess gilt es die Hochschule selber zu einem lern- und leistungsfähigen Organismus zu entwickeln. Gegen die strukturelle Verantwortungslosigkeit müssen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sich Hochschulen der Herausforderung einer auf Nachhaltigkeit zielenden Entwicklung stellen und dabei innovative Lösungskonzepte für die globale Umwelt- und Entwicklungskrise entwickeln können.
Literatur
Birkmann, Jörn; Bonhoff, Claudia; Daum, Wolfgang…(Hrsg.): Nachhaltigkeit und Hochschulentwicklung – Projekte auf dem Weg der Agenda 21, Projekt-Verl., 1997
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (Hrsg.): Umweltpolitik. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Agenda 21, Dokumente. Bonn
Büro für Technickfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (Hrsg.): Möglichkeiten einer Neuorientierung der Forschungspolitik. Bonn, 1996.
Hüber, L. et al. (Hrsg.): Über das Fachstudium hinaus, Weinheim, 1994
Meadows, Dennis; Meadows, Donella: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Hamburg, 1973.
Jörn Birkmann ist Student der Raumplanung und Mitinitiator des Projektes »Nachhaltige UniDo«
zum AnfangNachgefragt – Jörn Birkmann interviewt Martin Hellwig und Jörg Gleisenstein
Frage: Ist Dir das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ein Begriff? Wird das Konzept Nachhaltigkeit in der Lehre thematisiert?
Martin: Ja, seit einem Jahr. Im Lehrstoff ist das Thema allerdings überhaupt kein Thema. Erst durch die studentische Politik und durch Seminare habe ich mich damit auseinandergesetzt.
Jörg: Mir ist das Konzept durch das Studium bekannt. Die Abwägung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte spielt dort eine wichtige Rolle. Unabhängig vom Studium bin ich aber auch durch Umweltkatastropen, mit denen man quasi aufgewachsen ist, wie der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl oder dem Waldsterben, für Umweltprobleme sensibilisiert worden.
Frage: Nachhaltige Entwicklung verlangt also eine Gesamtschau öknomischer, ökologischer und sozialer Aspekte, sprich eine interdisziplinäre Sichtweise. Wird interdisziplinären Ansätzen in den Studiengängen Rechnung getragen?
Jörg: Sehr unterschiedlich. In den klassischen Studiengängen gibt es wenig Ansätze, sich interdisziplinär mit dem Konzept der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Demgegenüber steht die Neueinrichtung von Umweltstudiengängen, die oftmals interdisziplinäre Ansätze beinhalten. Des weiteren gibt es für Studierende die Möglichkeit, auch Vorlesungen von anderen Fakultäten zu besuchen. Auch das Studium-Generale bietet eigentlich eine Möglichkeit, sich interdisziplinär einem Thema zu nähern. In der Realität geht das Studium-Generale jedoch über einzelne Vorträge von Professoren nicht hinaus. Es fehlt an einem umfassenderen Ansatz, der auch bestehende Studiengänge erfaßt und nicht nur durch die Neueinrichtung eines Studiengangs die notwendigen Veränderungen erzielt.
Frage: Besteht denn überhaupt ein Interesse bei Studierenden und WissenschaftlerInnen, sich interdisziplinär mit dem Thema nachhaltige Entwicklung zu befassen?
Martin: Mein Elektrotechnik-Studium an der FH ist ein sehr technisch geprägter Studiengang, in dem ethische Fragestellungen nur eine marginale Rolle spielen. Dennoch bieten gerade die starke Technikgläubigkeit und das lineare Fortschrittsverständnis gute Anknüpfungspunkte, um das Thema Nachhaltigkeit in der Lehre zu thematisieren. Die Praxis im Studium ist jedoch leider eine andere, dort gilt das Motto: Lerne nur was wichtig ist, wichtig ist das, was der spätere Job und Arbeitgeber verlangt. Alles andere außerhalb des regulären Studienplanes ist reiner Luxus.
Frage: Warum interessieren und engagieren sich nicht mehr Studierende für interdisziplinäre Angebote sowie die Thematisierung von Umweltbelangen an und in der Hochschule?
Jörg: Einerseits existieren nur wenig Angebote, so daß der Aufwand, sich für diese Dinge einzusetzen, sehr hoch ist. Andererseits kann auch ein Grund darin liegen, daß die Hochschule für viele Studierende nicht ihr Lebensmittelpunkt ist. Es stellt sich für viele Studierende die Frage: Lohnt es überhaupt, sich an der Hochschule zu engagieren oder hat man nicht außerhalb der Universität mehr Erfolg?
Frage:Wo liegen die Barrieren für interdisziplinäre Angebote, die das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen könnten ?
Jörg: Es liegt ganz klar an den disziplinären Strukturen. Interdisziplinäre Angebote sind, wenn überhaupt, nur schwach vorhanden. Selbst interdisziplinäre Forschung hat noch keine wirksamen Auswirkungen auf die Lehre gehabt. Die Verbesserung des Studienangebotes für Studierende geschieht nur zögerlich. Es fehlt an der Umsetzung und Implementierung interdisziplinärer Studienangebote, wie beim Thema nachhaltige Entwicklung, in bereits bestehende Studiengänge.
Frage: Martin teilst Du diese Ansicht? Wo liegen Deiner Meinung nach Hemmnisse?
Martin: Ja, ich erkenne die gleichen Probleme, zusätzlich sehe ich in der Altersstruktur der Lehrenden ein wesentliches Hemmnis, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität zu beschäftigen. Viele unserer Professoren sind über 50 Jahre. Sie haben oft wenig Interesse am Ende ihrer Laufbahn noch einmal eine völlig neue Richtung, beispielsweise Nachhaltigkeit oder regenerative Energien, zu erforschen und zu lehren.
Frage: Wie könnte man dieses Problem mildern?
Martin: Man könnte stärker als bisher junge Leute aus der Praxis an der Uni beschäftigen, die einerseits ein großes Interesse an alternativen Techniken haben, andererseits ein hohes Maß an Praxiserfahrung in die Lehre einbringen.
Frage: Von der Lehre zurück zu den Studierenden. Wie könnte man das Interesse, das Engagement und das Problembewußtsein der Studierenden für Umwelt- und Entwicklungsfragen stärken? Welche Veränderungen sind notwendig?
Jörg: Ich meine, das Problembewußtsein für Umwelt- und Entwicklungsfragen ist vorhanden. Jedoch müssen die Rahmenbedingungen verändert werden. Es müssen wieder Perspektiven für studentisches Engagement geschaffen werden. Es müssen dringend die Freiräume erweitert werden. Hierzu sind Reformen sowohl im Bereich der sozialen Situation von Studierenden wie auch der Studiensituation selbst notwendig. Statt in Vorlesungen stumpf über Dingen zu brüten, müssen beispielsweise interdisziplinäre Angebote die Möglichkeit bieten, Projekte gemeinsam zu bearbeiten.
Martin: Ich denke, man muß bei Studierenden und ihrem sinkenden Engagement ganz deutlich die sich rapide verschlechternden Studienbedingungen als Ursache erkennen. Mehr Semesterwochenstunden, weniger BAföG und mehr Prüfungen in weniger Zeit sind einfach klare Einschnitte, die die Möglichkeit erheblich reduzieren, sich neben dem regulären Studienplan zu engagieren. Zudem sind immer mehr Betriebe auf junge AbsolventInnen aus, die man im Betrieb noch formen und zurechtstutzen kann.
Frage: Welche Chancen und Probleme seht Ihr bei der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Nachhaltigen Entwicklung auf Hochschulebene?
Jörg: Wenn man davon ausgeht, daß nachhaltige Entwicklung die Schicksalsfrage für die Entwicklung der Menschheit ist, müssen sich die Hochschulen viel stärker als bisher dieser Herausforderung stellen. Das Konzept ist dabei nicht nur auf die Bereiche Lehre und Forschung anzuwenden, sondern auch auf Fragen der Partizipation von Gruppen und Personen. Die universitäre Organisation und der laufende Betrieb der Universität müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Das Konzept der Nachhaltigkeit bietet die Möglichkeit, Strukturen grundlegend zu hinterfragen.
Martin: Ja, es hinterfragt automatisch das bestehende Wachstumsparadigma und die derzeitige Fortschrittsgläubigkeit. Eine intensivere Auseinandersetzung kommt mit Sicherheit zu dem Schluß, daß technische Einsparkonzepte nicht allein des Problems Lösung sind. Nachhaltige Entwicklung verlangt daher die Beschäftigung mit einem grundsätzlichen und tiefgreifenden Wandel. Probleme sehe ich darin, daß in der FH die Studierenden das Thema nur anstoßen können, durchsetzen können sie es nicht.
Jörg: Ich meine, man muß über das reine Anstoßen hinaus auch Sachen organisieren. Studierende sollten mit Unterstützung fortschrittlicher WissenschaftlerInnen gemeinsam an der Umsetzung der Vision der Nachhaltigkeit arbeiten. Gerade die Altachtundsechziger sollte man an ihre Verantwortung erinnern.
Martin Hellwig studiert elektrische Energietechnik an der FH Aachen; seit Mai 97 ist er im Vorstand des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften (fzs) tätig.
Jörg Gleisenstein studiert Raumplanung an der Uni-Dortmund, seit Juni 97 ist er AStA-Vorsitzender der Universität Dortmund.
zum AnfangDie Verbetriebswirtschaftlichung der Hochschulen und die strukturelle Verantwortungslosigkeit der Wissenschaft
von Torsten Bultmann
Wer in Orientierung an den Prämissen »nachhaltiger Entwicklung« einen fordernden oder kritischen Blick auf die Hochschulen wirft, muß davon ausgehen, daß diese selbst ein Teil des Problems sind, zu dessen Lösung sie etwas beitragen sollen. Dies ist methodisch unabdingbar, um sich politisch nicht zu verzetteln. Ökologische Gefährdungen etwa sind auch eine Krise der traditionellen Formen, in denen Wissen erzeugt, weitergegeben und (sozial-)technisch angewandt wird. Bereits ein oberflächlicher Blick etwa auf Studienordnungen, dominante Leistungsmuster, Personal- und Entscheidungsstrukturen oder die beziehungslose Abgrenzung der Fachdisziplinen gegeneinander verdeutlicht, daß die »innere« Hochschulverfassung auch ein Abbild der traditionellen ökonomisch-technischen Fortschrittsdynamik ist, welche die Probleme miterzeugt hat, die den Ausgangspunkt der Nachhaltigkeitsdebatte bilden.
Die Frage ist nun, wie die überkommenen Hochschulstrukturen so modifiziert und schrittweise verändert werden können, daß perspektivisch eine (Eigen-)Entwicklungsdynamik in Richtung Beförderung von Nachhaltigkeit entsteht. Dieser Ansatz wirkt, zugegeben, bescheiden. Die Frage nach adäquaten Strukturen, nach Möglichkeiten einer Veränderung der Prozeßdynamik, scheint mir jedoch wesentlich politischer und radikaler zu sein, als etwa auf die ökologische Krise vor allem mit emphatischen normativ-moralischen Selbstverpflichtungen – Stichwort »wachsende Verantwortung der Wissenschaft« – zu reagieren, welche im Regelfall die tragenden Konstitutionsbedingungen des Wissenschaftssystems unangetastet lassen. Die Minimalvoraussetzung einer neuen Entwicklungslogik ist etwa die Verankerung fachlicher Alternativen zum akademischen Mainstream und die Repräsentation unterschiedlicher Interessen in der Entwicklung von Bildungsprogrammen und wissenschaftlichen Prioritäten. Nur entscheidungsoffene – und in letzter Konsequenz: nicht-hierarchische – Strukturen sind fehlertolerant, lernfähig und ermöglichen eine umfassendere Sichtweise auf Probleme (Stichwort Komplexität). Als notwendige, wenn auch nicht hinreichende, Bedingung von Nachhaltigkeit würde ich folglich formulieren, daß das Hochschulsystem öffentlich finanziert, politisch reguliert und – weit über das bisher systemprägende ProfessorInnenkartell hinaus – demokratisch verfaßt ist.
Sicher nichts Neues, aber diese Prämissen wirken in dem Moment nicht mehr altbacken und zeitlos, wenn man sich vor Augen führt, daß damit auch die entscheidende Konfliktlinie mit der offiziellen Hochschulpolitik beschrieben ist. Deren konzeptionelle Quintessenz, wie sie sich als Schnittmenge von Ministerien, Wirtschafts- und führenden Wissenschaftsverbänden herausbildet, läßt sich im Kern in zwei Hauptansatzpunkten beschreiben.
Erstens: Eine Reform der Organisations- und Leitungsstrukturen in Richtung einer betriebswirtschaftlich verfaßten »Selbststeuerung«. Die so bedingte Aufwertung von Exekutiv- und Managementfunktionen ist folgerichtig verbunden mit der schrittweisen Relativierung und perspektivischen Abschaffung kooperativer Selbstverwaltungsgremien – bis hin zur öffentlich effektvoll inszenierten Absage an das historisch überlieferte Modell einer politisch konstruierten »Gruppenuniversität«. So der ehemalige WRK-Präsident George Turner im Handelsblatt (31.5.96): „Als ein wesentliches Hindernis zur Effizienzsteigerung der Hochschulen erweist sich die Entscheidungs- und Gremienstruktur. Die Hochschulen sind nicht aufgabenorientiert, sondern politisch konstruiert.“ Die Aussage unterstellt, es gäbe so etwas wie eine Aufgabe der Hochschule an sich, welche jenseits politischer und gesellschaftlicher Vereinbarungen bestimmbar sei. Darüber läßt sich vielleicht philosophisch streiten. Die praktische (und juristische) Konsequenz dieser Position wäre jedoch eine ganz unphilosophische: in dem Maße, wie politische Strukturen abgebaut werden, verschiebt sich die Definitionsmacht über wissenschaftliche Prioritäten folgerichtig stärker auf traditionelle akademische Eliten und diejenigen wissenschaftsexternen Kräfte, die dem Rest der Gesellschaft ihren Effizienzbegriff aufherrschen – womit wir wieder das alte »Gespensterdreieck« aus politischem Konservatismus, Patriarchat und Kapital stabilisiert hätten.
Zweiter Ansatzpunkt: eine stärkere administrative Regulierung des Studienverhaltens, wie sie insbesondere im aktuellen Entwurf der 4. HRG-Novelle ablesbar ist. Dazu gehören die Verdichtung von Prüfungen, Zwangsberatungen, Studienstandsnachweise ebenso wie Absichten einer stärkeren internen Stufung von Studiengängen. Im Referentenentwurf der HRG-Novelle wird Studienerfolg vor allem als ökonomische Größe definiert, die sich an der Studienzeit mißt. Organisatorisches Ziel ist die Erhöhung der studentischen Durchlaufgeschwindigkeit. Die darauf abzielenden Regulierungsansätze sind signifikanterweise vollständig von Aufgabenstellungen einer inhaltlichen Studienreform entkoppelt. Zu dieser ausschließlich wirtschaftlichen Bewertung der sozialen Funktion Bildung gehört ebenso die Festschreibung einer besonderen »Studierfähigkeitsfeststellung« in Form von Hochschulaufnahmeprüfungen zusätzlich zum Abitur. Aus wirtschaftlichem Blickwinkel sind Investitionen in Studienplätze nur dann potentiell rentabel, wenn ihre Inanspruchnahme an eine vorhergehende individuelle Leistungsprognose gekoppelt ist – womit in letzter Konsequenz das Recht auf Bildung abgeschafft wäre.
Der zentrale politisch-ideologische Modus operandi der gegenwärtigen Hochschulreform ist der Begriff der Effizienz. Unter Bedingungen rigider öffentlicher Haushaltskürzungen wirkt dies alles plausibel; etwa wenn die Hochschulen künftig stärker nach Leistung finanziert werden sollen. Die Stichworte dazu lauten: Indikatorisierung, leistungsorientierte Differenzierung der staatlichen Grundmittel, Übergang von der Input- zur Output-Finanzierung, deren Maßstab im Kern die quantitative Messungen isolierbarer wissenschaftlicher Resultate in Zeiteinheiten ist (Absolventen, Drittmittel, akademische Grade, Preise und Patente etc.). Uns wird eine Qualitätssteigerung durch mehr Wettbewerb versprochen.
Die Formel »Effizienz« ist zunächst sehr suggestiv, weil sie die Vorstellung einer rein funktionalistischen Sachneutralität erzeugt. Die Suggestion, es gäbe eine Effizienz an sich, ist jedoch Quatsch. Effizient kann ein Vorgang – etwa ein individueller Studienprozeß oder ein erfolgreiches Forschungsvorhaben – nicht in sich selbst (oder bezogen auf ein zeitliches Maß), sondern nur in Relation zur Erreichung definierter Ziele sein. Ebensowenig wie man generell den qualitativen gesellschaftlichen Nutzeffekt von Bildung und Wissenschaft quantitativ bestimmen kann, läßt sich aus der bloßen Relation von Menge und Geschwindigkeit ein Kriterium für die wissenschaftliche Beförderung nachhaltiger Entwicklung gewinnen. Meine These ist, daß wir uns in dem Maße von dieser sozialökologischen Zielsetzung entfernen, wie derartige Hochschulsteuerungsfunktionen nach dem Vorbild kapitalistischer Betriebswirtschaft Erfolg haben.
Natürlich spricht nichts gegen eine wirtschaftlich transparente Verwendung knapper Mittel. Wenn dies jedoch in Relation zu einem öffentlich legitimierbaren Nutzen von Wissenschaft erfolgen soll, müssen quantitative Kennziffern auf ein gesellschaftliches – und im Kern nur gesellschaftspolitisch definier- und legitimierbares – Konzept bezogen werden. Das jedoch ist eine genuin politische Frage, die durch ökonomische Selbststeuerungsmechanismen nicht beantwortbar ist. Die Frage lautet in einem demokratietheoretisch exakten Sinne: Wer entscheidet worüber? Eine wirkliche Hochschulreform müßte – anstelle der bloßen Quantifizierung und Beschleunigung von Arbeitsabläufen – an der Frage der Zielvereinbarungen ansetzen, welche den Wissenschaftsprozeß inhaltlich bestimmen. Im Kern ist dies die demokratische Frage.
Wenn ich als Gegenposition abschließend die Prämissen einer wirksamen politischen Hochschulreform grob umreißen sollte, dann müßte diese auf der Anerkennung zweier Tatsachen beruhen:
- Hochschulen sind marktkomplementäre Einrichtungen: Die Aufgabe von Wissenschaft und Studium ist es gerade, Probleme und Aufgaben der langfristigen gesellschaftlichen Daseinsvorsorge zu bearbeiten, die in der Ware-Geld-Beziehung nicht erfaßbar sind.
- Hochschulen sind hochgradig interessenpluralistische und zielambivalente Institutionen. Aus neoliberaler Sicht ist dieser Sachverhalt, d.h. die Tatsache, daß zu viele politisch organisierte Interessen mitreden, das entscheidende Hindernis für Effizienz und Zielklarheit. Ich drehe diese Aussage um: Interessenvielfalt ist kein Hindernis, sondern ein Vorteil, der entsprechende strukturelle Konsequenzen für innere Organisationsstrukturen der Hochschule und deren äußere gesellschaftliche und politische Einbindung haben müßte. Erstens: weil in einer pluralen Gesellschaft keine Gruppe aufgrund ihrer Marktmacht oder Nähe zum Staat beanspruchen kann, Wissenschaftsentwicklung ausschließlich in ihrem Sinne zu beeinflussen. Zweitens: weil die Vielfalt an Kooperationsbeziehungen, in denen Hochschulen stehen, unterschiedliche und umfassendere Sichtweisen auf Probleme fördert, und somit diese Vielfalt auch der wissenschaftlichen Entwicklung dienlich ist – vor allem jedoch der Vermeidung von Verengungen und Fehlentwicklungen. Hochschulinterne Demokratisierung und Öffnung zur Gesellschaft bedingen sich gegenseitig. Beides zusammengenommen ist eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende, Entwicklungsform potentiell ökologisch verantwortbarer Wissenschaft.
Torsten Bultmann ist Geschäftsführer des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi)
zum Anfang„… solange wir nicht die unbezahlte Hausarbeit aller Frauen in Frage stellen.“
Feministische Wissenschaft und Verzerrungen in der Nachhaltigkeitsdebatte
Barbara Nohr
Am Anfang war die Lücke: Frauen und ihre Lebenswelt kamen in der durch die männliche Optik beschränkten Wissenschaft entweder gar nicht vor oder wurden aus einer einseitigen Männerperspektive heraus als Objekte beschrieben. Das war und ist nicht verwunderlich – hat sich doch die Wissenschaft in all ihren Zweigen weitgehend ohne die Beteiligung von Frauen entwickelt. So wurde beispielsweise die Rolle von Frauen in der Geschichtsforschung weitgehend ignoriert, ihre Leistungen (z.B. durch unbezahlte Arbeit) für die Erschaffung und den Erhalt der Gesellschaft, Werke von Frauen in den Literatur- und Kulturwissenschaften blieben weitgehend unberücksichtigt. Dieser offensichtlich eingeschränkte Blick ließ feministische Wissenschaftlerinnen zunehmend am Gesamtgebäude Wissenschaft zweifeln: „Was ist das für eine Wissenschaft, die es, was uns betrifft, mit der Wahrheit nie sonderlich ernst genommen hat?“ – fragten sich die Veranstalterinnen der ersten Sommeruniversität für Frauen in Berlin 19761. Die Berliner Sommeruniversität für Frauen sollte den Versuch darstellen, Wissenschaft neu zu denken und gestalten: „Wir wollen nicht nur die akademische Wissenschaft um einen sogenannten Frauenaspekt additiv ergänzen, wir wollen nicht nur Forschungslücken erst entdecken und dann ausfüllen. Wir wollen mehr als nur Objekt und Subjekt der Wissenschaft werden: wir wollen sie und die Gesellschaft verändern“ (18).
Folgende Anforderungen stellten die Frauen an Hochschule und Wissenschaft:
- Die Hochschule soll für alle (Frauen) offen sein und allen etwas bieten.
- In der Hochschule soll interdisziplinär geforscht werden.
- Die Wissenschaft soll sich an einer kollektiven Praxis von gesellschaftlicher Macht für alle Frauen orientieren, „sei es in unseren Kämpfen im Umkreis der Frauenzentren, sei es in denen an unseren Arbeitsplätzen“ (20).
- Die Situation von großen Massen, von Klassen und vor allem der vernachlässigten weiblichen Bevölkerung soll behandelt werden.
- Die Geschlechterhierarchie soll – ebenso wie andere Formen sozialer Ungleichheit – aufgedeckt und kritisiert werden. Gleichzeitig geht es darum, Konzepte für ihren Abbau zu entwickeln.
- Bezogen auf die Frauenuniversität geht es um Autonomie, im Sinne von Selbstbestimmung und institutioneller Unabhängigkeit.
- Die eigenen (weiblichen) Erfahrungen sollen wissenschaftlich fruchtbar gemacht werden.
Die letztgenannte Forderung knüpft an die Parole der neuen Frauenbewegung »Das Private ist politisch« an. Dabei sollte es in erster Linie darum gehen, sogenannte private (und damit tabuisierte) Erfahrungen von Frauen wie Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung in der Ehe zu politisieren und als Strukturkomponente der patriarchalen Gesellschaft zu entlarven. Ein zweites wesentliches Thema bildete die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die daraus resultierende Ausbeutung und Unterdrückung: „Wir wissen, daß wir uns an der Universität nicht befreien können, solange wir nicht die unbezahlte Hausarbeit aller Frauen in Frage stellen,“ so die Organisatorinnen der Berliner Sommeruniversität.
Mit der Zeit hat sich das, was sich feministische Wissenschaft oder Wissenschaftskritik nennt, wesentlich ausdifferenziert.2 Nachdem feministische Wissenschaftskritik insbesondere in die Geistes- und Sozialwissenschaften (halbwegs, aber immerhin …) Eingang finden konnte, werden zunehmend die Technik- und Naturwissenschaften kritisch durchleuchtet und in ihrer patriarchalen Prägung kritisiert.
Frauen für eine andere technische Zivilisation
Als herausragende (weil viel diskutierte) Veröffentlichung diesbezüglich kann die 1990 unter Federführung von Doris Janshen verfaßte »Denkschrift für eine andere Zivilisation – Hat die Technik ein Geschlecht?«3 angesehen werden. Die Autorinnen fürchten „Zerstörung und Verlust der Grundlagen für zukünftiges Leben“ (ebd. 7). Insbesondere durch Technik sind die alltäglichen Lebensgrundlagen bedroht: „Schönheit und bereichernde Kraft der Technik treten immer mehr zurück hinter ihre Nutzung als einem Werkzeug für Herrschaft und Zerstörung“ (ebd.). Die Autorinnen wollen, daß dies anders wird: „Das zivilisatorische Projekt der Technik ist fest in Männerhand. Zulange haben wir Frauen geschwiegen. (…) Wir wollen eine Technik, die Mensch, Tier und Umwelt dient“ (ebd.). Grundpfeiler ihrer Programmatik sind die »weiblichen« Eigenschaften: „Beziehungsfähigkeit, Empathie, Orientierung mehr aufs Leben als auf die Sache“ (ebd. 8). Vor allem Frauen „rückt die Technik auf die Haut“ (16ff.): „Sind die zwischenmenschlichen Beziehungen – womöglich auch die den Frauen zugeschriebene besondere Beziehungsfähigkeit – durch den kühlen Atem der Rationalisierung bedroht?“
Zur baldigen Umsetzung fordern sie eine Technische Universität der Frauen, in der nicht nur Wege zur Gleichstellung der Geschlechter erarbeitet werden sollen, sondern weit mehr: „technische Ansatzpunkte für eine Überlebenschance der Menschheit“ (Denkschrift 23) werden von ihr erwartet. Die männliche Technikdomäne soll menschendienlich umgebaut werden, die Autorinnen wollen „zum Aufbruch in die zivilisatorische Wende (…) motivieren“ (ebd. 28).
Hier fallen einige Parallelen zu Konzepten »nachhaltiger Entwicklung« ins Auge: der Wille zur Wende, die Furcht vor den Folgen bisherigen (Miß-)Wirtschaftens und nicht zuletzt der moralische Zeigefinger. Zuvor jedoch eine Kritik an der differenztheoretischen und letztlich konservativen Grundlage der Denkschrift.4
Sicherlich ist es in Anbetracht der umweltpolitischen Lage wünschenswert und notwendig, nach neuen Formen des Wirtschaftens zu suchen. Oder: nach gangbaren Wegen in Richtung »nachhaltige Entwicklung« – wie es die Agenda 21 formuliert. Aufgabe einer feministischen Wissenschaft kann es jedoch nicht sein, die »Wende« oder »Umkehr« o.ä. den Frauen zu überantworten, wie es in Konzepten der Technischen Universität für Frauen und der oben zitierten Denkschrift zu lesen ist. Mit moralischem Zeigefinger sollen hier Frauen unter Verweis auf den drohenden Untergang unseres Planeten in die Pflicht genommen werden, die Menschheit vor weiterer patriarchaler Zerstörungswut zu retten und »weibliche« Gegenkonzepte zu entwickeln. Diese differenztheoretische Glorifizierung des »Weiblichen« knüpft – wie Angelika Wetterer herausgearbeitet hat – an ganz und gar nicht feministische Traditionen an: „In die Falle sind schon Generationen von Frauen getappt, die »weiblich« wurden oder blieben oder zumindest zu leben versuchten, weil davon das Wohl der Kinder, der Familie, der Nation oder wessen auch immer (angeblich) abhing. Selten jedenfalls ihr eigenes“ (Wetterer 1996: 267). Frauenpolitische Konzepte müssen statt einer oberflächlichen Aufwertung des »Weiblichen« die Auflösung von hierarchischen Geschlechterverhältnissen zum Ziel haben. Das schließt nicht aus, kritische Fragen an die Technikentwicklung hinsichtlich der spezifischen Betroffenheit von Frauen zu stellen (s.u.).
Schnittstelle Nachhaltigkeit?
Auch die Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« formuliert als ihr zentrales Anliegen eine Wende: „die Umstellung der Weichen“ (19).
Und auch hier wird die Verantwortung – implizit – den Frauen zugeschoben. Eine nachhaltige Entwicklung erfordert – darüber ist man sich einig – ein ressourcenschonendes Wirtschaften. Im Blickpunkt dieser Ressourcenschonung stehen jedoch – zumindest was die Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« anbelangt – die privaten Haushalte5, also der Reproduktionsbereich.
„Energiebewußtes Verhalten schließt dann beispielsweise den Verzicht auf immer neue elektrische Anwendungen (zum Beispiel elektrische Dosenöffner) genauso ein, wie die Rückbesinnung auf energiesparende Verhaltensweisen, die an die natürlichen Möglichkeiten angepaßt sind (zum Beispiel Wäschetrocknen an der Leine anstatt im Wäschetrockner)“ (Zukunftsfähiges Deutschland, S. 341), lautet eine in diesem Zusammenhang vielzitierte Passage. Der o. g. Verzicht formiert sich dabei mal wieder auf dem Rücken eines unbezahlten Reproduktionssektors. Dessen Bedeutung und Wertschätzung wird zwar von den Autoren mit moralischen Appellen aufgewertet, wobei jedoch geflissentlich übersehen wird, daß gerade dieser Bereich zum »natürlichen Betätigungsfeld« der Frauen gerechnet wird.6 Insgesamt kann der Studie ein individualistischer Ansatz vorgeworfen werden, dessen konkrete Einsparungsvorschläge sich eben nicht in erster Linie an die Industrie oder gegen die Unmengen von Ressourcen, die zur Aufrechterhaltung dieser Art des Wirtschaftens und Regierens nötig sind, richten. Statt dessen werden die Abschaffung von Küchengeräten, Energieeinsparungen und Ernährungsumstellungen empfohlen, die insbesondere Frauen eine erhebliche Mehrarbeit abverlangen.
Kann feministische Wissenschaftskritik einen Beitrag leisten?
Solange wir in einer zweigeschlechtlich strukturierten Gesellschaft leben, muß eine feministische Wissenschaft auf diese als Ausgangsbedingung wissenschaftlicher Analysen und politischen Handelns Bezug nehmen. Dieser Anspruch muß auch an Studien wie »Zukunftsfähiges Deutschland« gestellt werden. Natürlich ist es sinnvoll, nach anderen Formen des Wirtschaftens zu suchen, allerdings nach solchen, die nicht auf dem Rücken von Frauen ausgetragen werden. Also nach solchen, die die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gerade nicht fortschreiben, sondern im Gegenteil aufzuheben versuchen. Hier bleibt für FeministInnen – und dabei sind nicht nur WissenschaftlerInnen angesprochen – noch eine Menge zu tun. Wenig hilfreich sind m.E. Konzepte, die auf »Weiblichkeit« als heilsbringendes Prinzip bauen. Im Gegenteil müssen sich Frauen zwar einerseits darüber bewußt sein, daß sie in einer patriarchalen Gesellschaft wie der BRD andere, untere Plätze zugewiesen bekommen und daher oftmals andere Perspektiven haben. Es gilt jedoch, gerade diese „Zumutungen“ (Wetterer) zu dekonstruieren und gleichzeitig aufzupassen, daß die vorhandenen Hierarchien nicht noch verstärkt werden.
In diesem Sinne geht m.E. das inhaltliche Konzept der Internationalen Frauenuniversität während der EXPO 2000 in die richtige Richtung (wobei sich die Frage stellt, inwieweit eine derartige Selbstinszenierung des Kapitals, wie sie die EXPO 2000 verfolgt, mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist).7
Bestimmend für die inhaltliche Arbeit an der Frauenuniversität sollen folgende Leitgedanken sein:
- Eine feministische Orientierung, indem das Geschlechterverhältnis zum Bezugspunkt der Analyse gemacht wird.
- Die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Wissenschaftsentwicklung und gesellschaftlichen Veränderungen.
- Eine interdisziplinäre Ausrichtung einzelner Projektbereiche.
- Die Diskussion und Erarbeitung der Projektthemen in ihrer internationalen, globalen Dimension.
- Die Anwendung von Methoden und Medien aus unterschiedlichen wissenschaftlichen, künstlerischen und politischen Bereichen.
Eine Wissenschaft, die feministische Ansätze, wie sie eingangs beschrieben wurden, ernsthaft umsetzt, käme sicherlich zu anderen Lösungen, als die in der Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« entworfenen.
Barbara Nohr ist Sozialwissenschaftlerin
zum AnfangFairer Sportsgeist an den Hochschulen!?
von Martin Hellwig
Die momentane Nachhaltigkeitsdebatte um ein »zukunftsfähiges Deutschland« macht auch vor den Hochschulen nicht halt. Besonders sie sind gefragt, wenn es darum geht, Deutschland fit für das 21. Jahrhundert zu machen.
Und das in zweifacher Hinsicht: Einmal geht es darum, daß die Hochschulen sich an diesem Prozeß einer »Nachhaltigen Entwicklung« mit ihrem Innovationspotential beteiligen. Zum anderen müssen die Hochschulen, um im globalen Nachhaltigkeitsspiel mitspielen zu können, sich selbst dieser Entwicklung öffnen. Dazu ist es logischer Weise nötig, den zur Zeit herrschenden Problemen an den Hochschulen, wie studentische Überlastung und finanzielle Unterversorgung, etwas entgegenzusetzen. Und zwar etwas Nachhaltiges.
Als ebenso grandiose wie einfache Lösung aller Probleme der deutschen Hochschulen wird von vielen BildungspolitikerInnen, bzw. solchen, die es sein wollen, seit einiger Zeit das Prinzip des Wettbewerbs propagiert.
Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BdA), Dieter Hundt, der in diesem Zusammenhang nicht von einer Lehrstellen-, sondern von einer Bildungskatastrophe spricht, hat da schon ganz konkrete Vorstellungen: „… es muß klar sein, daß es Bildungswettbewerb nur dann geben kann, wenn wir Vergleichbarkeit und Meßbarkeit haben. Abitur ist nur gleich Abitur, wenn wir eine einheitliche Meßlatte einziehen, über die jeder springen muß, der studieren will.“ (FR vom 17.10.97, S. 4)
Bildung muß also meßbar und vergleichbar gemacht werden. Damit Bildung auf dem freien Hochschulmarkt noch eine Chance hat, muß sie effektiver und preiswerter gestaltet werden. Sie muß sich an den Erwartungen und Forderungen von Angebot und Nachfrage orientieren, standortgerecht sein und der Profilbildung dienen. Um Meßbarkeit zu bekommen, müssen Meßgrößen eingeführt werden. Die Frage, mit welchen Größen so etwas abstraktes und komplexes wie Bildung gemessen werden kann, stellt sich zurecht. Hier bietet die Markwirtschaft technokratische Ansätze: Was in eine Hochschule hineingesteckt wird und dabei herauskommt, kann anhand von Finanzierungsdaten, Erstsemesterlnnenzahlen, Abbrecherlnnen- und Absolventlnnenzahlen sowie Durchschnittsstudienzeiten ermittelt werden. Alles innerhalb einer mathematischen Formel miteinander in Beziehung gesetzt, bekommt man die Effektivität und das Preis-Leistungs-Verhältnis der jeweiligen Hochschule. Da bei jeder Hochschule dieselben Daten und dieselbe Formel verwendet werden, können die Ergebnisse miteinander verglichen und in einer Ranking-Liste überschaubar dargestellt werden. Der Kreis schließt sich, wenn die finanzielle Ausstattung abhängig vom Listenplatz gemacht wird.
Damit eine Hochschule einen Platz in der oberen Region innehat, und damit gute Aussichten auf Forschungsaufträge, Drittmittel und internationale Anerkennung, müssen also die ErstsemesterInnenzahlen und die Abrecherlnnenquoten gesenkt werden. Wenn weniger in den Hochschulen drin sind, können weniger ihr Studium abbrechen und die, die übriggeblieben sind, ihr Studium erfolgreich abschließen.
Der Chef der Arbeitgeberverbände beschreibt das so: „Studierfähigkeit und Elitenauswahl sind die Ziele eines demokratischen Bildungsideals, nicht bloße Massenproduktion von Abschlüssen. Deutschland kann es sich nicht länger leisten, daß eine föderalistisch verbrämte Intransparenz die Schulszene (auch die Hochschulszene, M.H.) bestimmt.“ Und weiter: „Ich meine, es ist im Grunde selbstverständlich, daß wir in der Schule (auch in der Hochschule, M.H.) einen fairen Sportsgeist fördern und klar machen, daß Leistung und Belohnung zusammengehören.“ (FR vom 17.10.97, S. 4)
Nicht nur Schulen und Hochschulen sollen sich den Kräften des Marktes aussetzen, sondern auch die Schülerlnnen und Studentlnnen. Sie sollen Bildung schneller und effektiver konsumieren, auf Schnickschnack wie BAföG und Wohngeld möglichst verzichten und an einem Engagement außerhalb der (Hoch-)Schule nur interessiert sein, wenn es um Einwerbung von Drittmitteln, schul- oder studienbezogenen Kontakten ins Ausland oder das Anfertigen von Diplom- bzw Doktorarbeiten geht. StudentInnen sollen sich untereinander Konkurrenz machen, wenn sie sich bei ihrer Wunschhochschule bewerben. Die mittels Auswahlgespräch ermittelten Besten (???) bekommen einen Studienplatz; eine Zwischenprüfung nach dem vierten Semester siebt die nicht ganz so »Fleißigen und Ehrgeizigen« heraus, so daß Industrie und Wirtschaft wirklich nur noch die bekommen, die möglichst schnell, möglichst viel und möglichst kritiklos Wissen in sich aufgenommen haben; bereit zur profitorientierten Verwertung und zur Jagd nach dem Machbaren.
Tendenzen einer solchen Entwicklung sind sehr deutlich bei der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) zu sehen. Dort wird den Hochschulen die Möglichkeit gegeben, durch Auswahlgespräche und Exmatrikulation bei nichtbestandener Zwischenprüfung »Leistung« zu belohnen und ihr Profil deutlicher zu konturieren. Durch die Androhung von Studiengebühren, wie sie im neuen HRG zwar nicht steht, aber auch nicht bundeseinheitlich verboten wird, wird das Studium auf das Lernen für und das Bestehen von Prüfungen reduziert. Nicht nur die, die am besten Auswendiglernen können, kommen durch, sondern vor allem die, die sich das Auswendiglernen auch noch leisten können.
Die Vordenkerlnnen einer nachhaltigen Entwicklung haben sicherlich Recht mit der Annahme, daß es so wie bisher nicht mehr weiter gehen kann. Auch die Hochschulen müssen ihren Weg ändern. Die Frage ist nur wohin und wie?
Durch mehr Wettbewerb die angebliche Qualität der Ware Bildung und damit die des Standorts Deutschland zu sichern, ist ein Weg. Aber hierbei sind Richtung und Methode falsch. Die anstehenden ökologischen und ökonomischen Probleme lassen sich nicht mit Strategien eines Systems lösen, welches für diese Probleme verantwortlich ist. »Sustainable Development« bietet technokratische Ansätze, die sich innerhalb der Grenzen bewegen, die wir überschreiten müssen, wenn wir uns wirklich nachhaltig entwickeln wollen.
Dabei sind im Zusammenhang mit Hochschule zwei Gedanken wichtig:
- Erstens dürfen wir nicht länger alles durch die Standortbrille betrachten. Nicht alles, was höher, weiter und schneller ist, ist gleichzeitig auch besser. Und nicht alles, was gut ist für den Standort Deutschland, ist auch gut für die Menschen, die in ihm leben. Es ist fatal, das Wohlergehen einer Gesellschaft mit dem Wohlergehen der Wirtschaft gleichzusetzen und das menschliche Miteinander auf Wirtschaftsdaten zu reduzieren. Durch die Individualisierung der Probleme verschwimmt die Verantwortlichkeit und damit auch die Möglichkeit, hieraus wirksame Lösungsansätze zu entwickeln.
- Zweitens läßt sich Qualität von Bildung nicht am Input oder Output von Hochschulen messen. Weniger StudentInnen entlasten die Hochschulen nur kurzfristig, staatliche Finanzmittel werden immer spärlicher fließen und private Stiftungen oder Firmen lassen nur noch wenige Hochschulen offen. Die Reduzierung der Anzahl der StudentInnen auf ein von Industrie und Wirtschaft bestimmtes Niveau verhindert die Entwicklung der zur Problemlösung notwendigen Kreativität und lnterdisziplinarität. Nur durch die Gedanken, Vorstellungen und Ideen vieler lassen sich die drängenden und lebensbedrohenden Fragen nach dem Wie und Wohin beantworten, lassen sich Strategien entwickeln, die wirkliche menschenfreundliche Lösungen hervorbringen.
Nachhaltige Entwicklung darf nicht an den Grenzen des Systems aufhören. Für die Hochschulen bedeutet das Einstieg in einen gesellschaftlichen Diskurs um die Neubestimmung der Aufgaben, der Strukturen und der Inhalte. Diskussionen darüber müssen transparent und offen geführt und Entscheidungen demokratisch und unter Einbezug aller getroffen werden. Veränderungen dürfen sich nicht auf die technokratische Ebene beschränken, sie müssen die inhaltliche Ebene mit einbeziehen.
Martin Hellwig studiert elektrische Energietechnik und ist Vostandsmitglied des Freien Zusammenschlusses der StudentInnenschaften (fzs).
zum AnfangStatt reden – studieren. Das interdisziplinäre Studienreformprojekt »Nachhaltige UniDO«
von Jörn Birkmann
Seit gut einem Jahr bietet das interdisziplinäre Studienrefromprojekt »Nachhaltige UniDO« Studierenden die Möglichkeit, sich außerhalb des gewohnten Studienrahmens mit der Konkretisierung des Konzeptes der nachhaltigen bzw. zukunftsfähigen Entwicklung am eigenen Lern- und Erfahrungsraum – Universität Dortmund – zu beschäftigen. Studierende und WissenschaftlerInnen haben sich zum Ziel gesetzt, in interdisziplinären Projekten, nicht nur über das hehre Anliegen theoretisch zu diskutieren, sondern durch einen gemeinsamen Lern- und Gestaltungsprozeß konkrete Schritte und Maßnahmen für eine »nachhaltige« bzw. »zukunftsfähige« Hochschule zu entwickeln und umzusetzen.
Der Kontext
Nachhaltige Entwicklung (sustainable Development) wurde auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 als Leitbild einer verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Politik festgeschrieben (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1992). Mit der Agenda 21, dem zentralen Beschlußdokument der UNCED, sollen die Weichen für eine zukunftsverträgliche Wirtschafts- und Lebensweise gestellt werden. Es gilt, durch die gleichrangige Behandlung ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange, die Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Gut fünf Jahre nach der UNCED wird das Konzept Nachhaltigkeit, wie insbesondere die UN-Sondergeneralversammlung im Juni 97 zeigte, auf nationalstaatlicher Ebene im Problemstau abgestellt. Demgegenüber haben sich jedoch zahlreiche Initiativen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene gebildet, die die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu verwirklichen suchen.
In diesem Zusammenhang bewegt sich auch das interdisziplinäre Studienreformprojekt »Nachhaltige UniDO«. Das Studienreformprojekt ist von Studierenden und engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Unterstützung des Rektorates, des Hochschuldidaktischen Zentrums sowie des Institutes für Umweltforschung initiiert worden. Zentraler Ansatzpunkt des interdisziplinären Studienreformprojektes ist die Frage, welche Forderungen an Wissenschaft und Praxis aus dem Postulat der Nachhaltigkeit abzuleiten sind und wie sie umgesetzt werden können. Untersuchungsgegenstand ist die Universität selbst: Lehr- und Forschungsaktivitäten, Organisation, Infrastruktur sowie Studierende und Wissenschaftler etc. Das Gesamtprojekt setzt sich aus zahlreichen interdisziplinären Teilprojekten zusammen, die jeweils eine bestimmte Problemstellung aus unterschiedlichen Perspektiven (Fachdisziplinen) beleuchten und erforschen. Die Beschäftigung mit dem eigenen Lern- und Erfahrungsraum Universität bietet dabei einen starken Praxisbezug.
Der Ablauf
In einer öffentlichen Auftaktveranstaltung werden zu Beginn des Semesters die Projektvorschläge von den BetreuerInnen vorgestellt. Neben der interdisziplinären Zusammensetzung der BetreuerInnen muß auch die Fragestellung interdisziplinär bearbeitbar sein. Die jeweiligen Fragestellungen werden im Verlauf der Projekte je nach der Zusammensetzung der TeilnehmerInnen ergänzt und konkretisiert. Im zurückliegenden Studienjahr reichten die Projektvorschläge von der Fragestellung einer nachhaltigeren Energienutzung, über die Analyse des Mobilitätsverhaltens der Studierenden bis zur Entwicklung von Indikatoren für die Beurteilung der Nachhaltigkeit des Organismus UniDO.
Neben den interdisziplinären Studienarbeiten und der inhaltlichen Betreuung durch die WissenschaftlerInnen dient ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Exkursionen zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Konzept der Nachhaltigkeit. Im vergangenen Semester boten die unterschiedlichen ReferentInnen, vom Vertreter der Chemieindustrie über die Vorsitzende der Enquete Kommission »Schutz des Menschen und der Umwelt« bis hin zur Theologin aus Aachen, eine umfangreiche Darstellung des Konzeptes Nachhaltigkeit von verschiedenen Standpunkten aus. Die Rahmenveranstaltungen bieten den Studierenden, die sehr unterschiedliches Wissen über das Thema Nachhaltigkeit besitzen, eine gemeinsame Wissensbasis als Grundlage ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit.
Aufgrund der doch erheblichen Sprachunterschiede zwischen einzelnen Fachdisziplinen wird eine Schreib- und Präsentationswerkstatt angeboten, die die interdisziplinäre Teamarbeit in den Projektgruppen fördert und erleichtert. Ein Problem innerhalb des Projektes »Nachhaltige UniDO« stellt teilweise die Anerkennung der interdisziplinären Leistung im jeweiligen Studiengang dar. Trotz der Forderung nach mehr Interdisziplinarität verlangen die meisten Fakultäten, für die Anerkennung interdisziplinärer Studienleistungen als ordentliche Facharbeit eine tiefgreifende einzelwissenschaftliche Leistung im Sinne ihrer Disziplin. Das diese Forderung nicht immer mit dem Ziel der interdisziplinären Projektarbeit vereinbar ist, ist offensichtlich, so daß Strukturen geschaffen werden müssen, die der interdisziplinären Teamarbeit mehr Raum bieten.
Die Projekte
Das erste interdisziplinäre Teilprojekt erarbeitete Indikatoren zur Beurteilung der Nachhaltigkeit für den Organismus Uni DO. Die Hochschule wurde dabei als ein Organismus, der in vielen lebendigen Wechselbeziehungen steht, betrachtet. Neben der Thematisierung des Konzeptes der Nachhaltigkeit aus Sicht unterschiedlicher Disziplinen wurden verschiedene Indikatorenkonzepte auf ihre Fähigkeit hin analysiert, sowohl ökologische, wie auch soziale und ökonomische Aspekte abbildbar bzw. meßbar zu machen. Der Syndromansatz des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung »Globale Umweltveränderungen« (WGBU) spielte in diesem Projekt eine wesentliche Rolle. Als ein zentrales Krankheitsbild des Organismus UniDO wurde die stark steigende Daten- und Informationsflut ausfindig gemacht, die einhergeht mit ständigen Neuanschaffungen von Informations- und Kommunikationstechnologien, die wiederum mehr Daten und Informationen aufnehmen und produzieren. Daß dieses Syndrom erhebliche Umweltauswirkungen nach sich zieht, wurde am Beispiel des Elektronikschrottes verdeutlicht.
Das zweite Projekt analysierte die Wohnstandorte der Studierenden und untersuchte daraus resultierende Mobilitätszwänge und Umweltfolgen. Die Untersuchung ergab unter anderem, daß nur rund ein Drittel der Studierenden in Uninähe wohnen und von den zahlreichen Fernpendlern ein Drittel mit dem Auto zur Uni fährt. Es wurden konkrete Maßnahmenvorschläge und mögliche Alternativen zur derzeitigen Pendleruni erarbeitet.
Das dritte Projekt befaßt sich mit technischen und verhaltensorientierten Maßnahmen zur Energieeinsparung an der Uni Dortmund. Neben der Erarbeitung möglicher technischer Energieeinsparmöglichkeiten wurden mit einer Befragung unter Studierenden und WissenschaftlerInnen erhebliche Einsparpotentiale durch mögliche Verhaltensänderungen ermittelt. Diese Maßnahmenvorschläge zur Verhaltensänderung und zu technischen Neuerungen sollen nun in einem weiteren Projekt in ein konkretes Kampagnenprogramm umgesetzt werden.
Mit dem Thema Energie befaßt sich auch das vierte Projekt, daß das neue Blockheizkraftwerk (BHKW) der Uni Dortmund auf seine ökologischen und ökonomischen Vor- und Nachteile hin untersuchte. Es stellte fest: „Selbst bei Berücksichtigung der hohen Kapitalkosten reduzieren sich für das Referenzjahr 1995 die Energiekosten der Universität um über 800.000 DM. Damit wurden die ursprünglich geplanten Werte übertroffen.“ (Birkmann et al, 1997)
Leitung des Projektes
Auf Vorschlag der studentischen Initiatoren wird das Projekt von einem Koordinationskreis geleitet, in dem sowohl Studierende, WissenschaftlerInnen und die beiden Institute, das Institut für Umweltforschung und das Hochschuldidaktische Zentrum, gleichermaßen vertreten sind. Diese Strukturen des Koordinationskreises bieten die Möglichkeit, daß Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und ProfessorInnen gleichberechtigt und hierarchiefrei zusammenarbeiten.
So kann der Koordinationskreis wesentlich innovativer agieren, als die gesetzlich verankerten Selbstverwaltungsgremien.
Fazit
Obwohl es erhebliche Probleme bei der Initiierung und Anerkennung (als Studienleistung) des interdisziplinären Projektes »Nachhaltige Uni DO« gab, kann ich als Mitinitiator und Teilnehmer nur dazu motivieren, an anderen Orten gleiche Projekte ins Leben zu rufen.
Erst durch das Projekt sind die Schritte zu einer nachhaltigeren Universität klarer geworden. Die Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung wird nicht mehr in abgeschlossenen Expertenkreisen geführt, sondern am faßbaren Beispiel, dem eigenen Lern- und Erfahrungsraum Hochschule, konkretisiert. Diesen Schritt hat das Projekt »Nachhaltige UniDO« durch verschiedene Teilprojekte bereits erreicht. Trotz der noch nicht quantifizierbaren Umweltentlastungen ist die gemeinsame Betrachtung ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte in interdisziplinären Studienprojekten ein wichtiger Baustein für mehr Zukunftsfähigkeit in Lehre und Forschung.
Mit der Aufnahme des interdisziplinären Projektes »Nachhaltige Uni DO« in das Aktionsprogramm »Qualität der Lehre« des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen als innovatives Reformprojekt von überregionaler Bedeutung, kurz »Leuchturmprojekt«, sind auch die finanziellen Weichen für die Zukunft gestellt.
Zu hoffen bleibt, daß damit die fachübergreifende Beschäftigung mit dem Themenkomplex nachhaltige Entwicklung einen festen Platz an der Universität Dortmund erhält und einen Beitrag zur Reform der Hochschule leistet.
Literatur
Birkmann, Jörn; Bonhoff, Claudia; Daum, Wolfgang…(Hrsg.): Nachhaltigkeit und Hochschulentwicklung – Projekte auf dem Weg der Agenda 21, Projekt-Verlag, 1997.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (Hrsg.): Umweltpolitik. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Agenda 21, Dokumente. Bonn.
Jörn Birkmann ist Student der Raumplanung und Mitinitiator des Projektes »Nachhaltige UniDo«
zum AnfangStudienbüros an der TU Berlin
von Carsten von Wissel
Gremien – die Orte, an denen Entscheidungen in Universitäten stattfinden soll(t)en – weisen ein entscheidendes Problem auf: ihr Hang zum Minimalkonsens. Entscheidungen werden vielfach vermieden, wenn sie zustandekommen, liegt ihnen häufig ein Prinzip von Interessenausgleich an Stelle eines von Sachangemessenheit zugrunde. Für sich genommen erscheint das schon problematisch, problemverschärfend wirkt sich jedoch aus, daß es eine Vielzahl von Organisationszielen gibt. Diese sind im Sinne von Zielhierarchien nicht auskommuniziert und konkrete Organisationsziele werden schon gar nicht von jeweils allen Beteiligten konsensual geteilt.
Die Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre liegt in den Händen der HochschullehrerInnen. Orientierungsrahmen sind die Verhaltens- und Leistungsnormen ihrer Disziplinen, der organisationale Rahmen bleibt sekundär. Daraus resultiert Segmentierung und Kommunikationsreduktion. Dies wirkt sich z.B. bei der Organisation der Lehre aus, aber nicht nur dort. Disziplinübergreifende Kommunikation beschränkt sich auf ein Minimum. Die Disziplinen – so ein weitverbreitetes Bewußtsein – sind aufeinander zunächst einmal nicht angewiesen.
Diese Gemengelage kumuliert in einer nicht unbedingt konsistenten Gremienstruktur, bestehend aus modernen und durchaus vormodernen Elementen. Das Entscheidungssystem oszilliert zwischen Demokratie, ständisch geprägter Oligarchie und präsidialer – wiederum demokratisch und ständisch gebremster – Monokratie. Es läge nahe, Universitäten zumindest idealtypisch als Konsensgebilde zu denken und die Entscheidungsinstanzen dementsprechend zu strukturieren, auch die Komplexität, die Handhabung von Wissen als Basisaufgabe läßt daran denken. Die Gremienstruktur ist jedoch nicht so. Die Notwendigkeit, auch im Konfliktfall zu einem alle Beteiligten einschließenden Konsens zu gelangen, wird durch die festgeschriebene Mehrheit der HochschullehrerInnen eliminiert. Die »Ratio« des Systems ist also, daß eine Personalkategorie Konsensfähigkeit und Qualität ihrer Programmentwicklung und -formulierung vernachlässigen kann, da sie im Konfliktfall alleine imstande ist, sich durchzusetzen.
Auswirkungen, Lösungsversuche
Der Mainstream der Hochschulsteuerungsdebatte kommt ohne Umschweife zur Wurzel des Übels. Ursache sei die innere (mitunter gar zu weit getriebene) Demokratisierung der akademischen Selbstverwaltung, die dazu führe, daß die notwendigen Entscheidungen im Gewirr partizipativer Strukturen hängenblieben. Es ginge – so läßt sich vieles lesen – letztlich nur darum, Dezision einzuziehen und schon hätte man Hochschulen zu effizienten Dienstleistungseinrichtungen transformiert. Man bräuchte dann bloß noch ein effizientes Management, das die gegenüber (demnächst ja zahlenden) KundInnen fälligen Dienstleistungen erbringt und koordiniert. Es bleibt mir allerdings schleierhaft, wie und warum man mit derlei Instrumentarium die oben umrissene Situation in den Griff zu bekommen gedenkt. Die Diagnose, daß es an Entscheidungen fehlt, ist zwar richtig, es erscheint mir aber zweifelhaft, ob das Problem mit Entscheidungen von oben gelöst werden kann. Schließlich dürfte es unmöglich sein, Qualitätsverbesserung von Forschung und Lehre zu dekretieren. Soweit die nicht anschlußfähigen Fragen an die VertreterInnen der Managementlehre. Nun komme ich zum Anschlußfähigen.
Es gibt sowohl die gerne betonte Verantwortungskrise (kaum jemand der in den Gremien Mitentscheidenden hat gegenüber anderen Rechenschaft abzulegen), als auch die Managementkrise (Universitäten sind unstrittig selbststeuerungsdefizitäre tankerhafte Großorganisationen und es gibt ebenfalls ohne jeden Zweifel die den Universitäten vorgehaltene Effizienzkrise; Entscheidungsprozesse und Leistungserbringungsprozesse verlaufen in der Tat ineffizient, vieles ist teuerer als es sein müßte, nicht alle, aber viele der Gründe sind hausgemacht.
Dies sind die drei Standardkrisen, sie alle aber haben einen Kontext. Man könnte ihn schlagworthaftig als Kommunikations- und Informationskrise bezeichnen:
- Disziplinen grenzen sich gegeneinander ab, Kommunikation wird reduziert, interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht selten negativ sanktioniert, ansonsten nur instrumentell kollaboriert. Dies erschwert eine fachübergreifende Problemformulierung und bringt z.B. Umweltwissenschaften nicht gerade voran – demzufolge sind Universitäten im umweltwissenschaftlichen Bereich im Rückstand.
- Interessenartikulation und Entscheidungsfindung erfolgt statusgruppenbezogen. Dies gilt sowohl für HochschullehrerInnengruppen, als auch für Personalvertretungen; auch Viertelparität vermochte hieran kaum etwas zu ändern. Auf gleicher hierarchischer Ebene ist Kollegialität die Leitlinie: Ergebnis ist dann der vielbeklagte Minimalkonsens.
- Forschung und Lehre, Verwaltung, Leitung – alles folgt den jeweils eigenen immanenten Bewegungsgesetzen und Präferenzordnungen, wechselseitige Anforderungen werden jeweils als Zumutungen wahrgenommen, jedes Funktionssystem pflegt seine Organisationsmythen und Vorurteilssammlungen über sich und die anderen.
- Es fehlt nicht zuletzt an substantiellem Steuerungswissen. Die Organisation Universität weiß zu wenig über sich selbst. Intelligente Modelle wie Kennzahlensteuerung oder Steuerung mit Zielvereinbarung setzen Indikatoren- bzw. Zielfindung voraus. Dies kann sinnvollerweise nicht von oben nach unten dekretiert werden.
Dies alles zeigt, daß es mit Entscheidungen noch nicht getan ist. Partizipation wird hier an zwei Stellen bedeutsam: Zum einen kann nur sie eine Komplexitätsangemessenheit von Entscheidungen gewährleisten, zum anderen sind die Möglichkeiten, diese zu unterlaufen, bei weitem zu zahlreich. Das Schicksal nicht akzeptierter, von Universitätsleitungen getroffenen Entscheidungen ist in der Regel ein immer gleiches, die Projekte verlaufen im Sande. Kommunikation, die darauf zielt, einen Konsens hinsichtlich von Oberzielen (als Beispiel-Oberziel sei hier »gutes Studium« genannt) einzuholen, könnte hier Abhilfe schaffen.
Studienbüros: Potentiale des Modellversuchs
Studienbüros sind unmittelbar auf Fachbereichsebene angesiedelt. Sie sind (jeweils abhängig von der Studierendenzahl) mit ein bis zwei auf fünf Jahre eingestellten Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und einer Verwaltungskraft (leider nicht überall) ausgestattet. Über Entscheidungskompetenzen verfügen sie nicht. Bezogen auf weiter oben angerissene Krisensyndrome schalten sich die Studienbüros primär bei der Kommunikationskrise ein und das auf Ebene des Fachbereiches, wo es zwar auch Verkrustungen, aber solche mit dünneren Krusten gibt. Studienbüros könnten dann, ideale Ausgangsbedingungen unterstellt:
- Vernetzen zwischen den Instituten und zwischen den Fachbereichen, sowohl auf der Ebene der Serviceabsprachen, als auch auf der Ebene von Studienberatung, da sie wissen, wo welche Inhalte oder auch Probleme vorzufinden sind und zu anderen Studienbüros (damit zu anderen Fachbereichen) einen kurzen Dienstweg unterhalten.
- Beraten, z.B. bei der Erstellung von Studien- und Prüfungsordnungen, da sie über Regelungssystematiken und Regelungswürdigkeiten orientiert und in der Regel dagegen gefeit sind, in Studien- und Prüfungsordnungen ein Instrumentarium zur Absicherung von Lehrkapazitäten zu sehen.
- Begleiten, z.B. Studienreformprojekte oder studentische Evaluationsprojekte, da sie in einen gremien- und regelungskompatiblen Diskurs übersetzen können.
- Koordinieren, z.B. im Bereich der Studienfachberatung des Fachbereichs, da sie über die fachbereichsunmittelbare Perspektive verfügen.
- Anregen und initiieren, z.B. wiederum Studienreformprojekte etc., aber auch Selbstverständnisdiskussionen der Fachbereiche, da es zu ihren Aufgaben gehört, Relevanzen und mitunter fragwürdige Konsense zu hinterfragen.
- Entscheidungen vorbereiten, Vorlagen erstellen, Informationen in den Entscheidungsprozeß geben, am Selbstvergewisserungsprozeß des Fachbereichs mitwirken.
Im Unterschied zu anderen administrativen Steuerungsmodellen liegt die Stoßrichtung des Modellversuchs Studienbüros nicht auf Dezision und einer Zurückdrängung von Partizipation, sondern auf Kommunikation, Partizipation und Entscheidungsvorbereitung. Zentral ist dabei, daß Entscheidungsvorbereitung und Entscheidung nicht zusammenfallen. Gremien der akademischen Selbstverwaltung werden somit instand gesetzt, ihre Verantwortung im Bereich von Studium und Lehre wahrzunehmen und im besten Fall ihre strukturelle Verantwortungslosigkeit zu überwinden. D. h. es wird versucht, Entscheidungsrationalität durch Information zu erhöhen, Entscheidungsvermeidung durch Information zu überwinden. Prozesse können beschleunigt werden, da durch die Bereitstellung von Information Ungewißheit minimiert werden kann.
Carsten von Wissel ist Diplom Politologe und Mitarbeiter im Studienbüro (FB 7) der TU Berlin
Der Text ist eine stark gekürzte und überarbeitete Variante von „Chancen und Grenzen eines Modellversuchs. Studienbüros an der Technischen Universität Berlin“, erschienen in Forum Wissenschaft Heft 2/97.
zum AnfangInnovative Studienmodelle in der Ingenieurausbildung
von Thomas Pelz
Ausgangspunkt des Projektes waren folgende Einschätzungen zur Situation der Ingenieurausbildung:
- Aufgrund von Veränderungen in den Unternehmen ergeben sich neue Anforderungen an Ingenieurinnen und Ingenieure: Sie bearbeiten verstärkt Aufgaben, die sich nicht nur auf technische Themen beschränken, ihre kommunikativen Fähigkeiten werden intensiv gefordert, da sie zunehmend im Austausch mit anderen Personen arbeiten und schließlich geraten sie immer mehr in unternehmerische Verantwortung.
- An den Hochschulen bietet jedoch derzeit die Ingenieurausbildung oft ein anderes Bild: Das gängige Ingenieurstudium bezieht sich weiterhin zu einem sehr großen Anteil auf rein technische Fachinhalte und der hohe Anteil von Vorlesungen u.ä. Lehrveranstaltungsformen unterstützt die Studierenden nicht beim Erwerb kommunikativer Fähigkeiten und sozialer Kompetenzen.
- An einigen Hochschulen gibt es neue Ansätze in der Ingenieurausbildung. Doch trotz des Erfolges dieser Reformansätze, hat nur ein kleiner Teil der Studierenden die Möglichkeit an ihnen teilzunehmen, zudem laufen diese Ansätze oft zeitlich befristet.
Vor diesem Hintergrund startete Mitte 1995 das Projekt »Innovative Studienmodelle in der Ingenieurausbildung« an der TU Berlin, dessen Arbeit von einem Beirat aus Ingenieurinnen und Ingenieuren, Hochschulangehörigen und Gewerkschaftsvertretern begleitet wurde.8
Als erster Arbeitsschritt wurden sieben Leitbilder formuliert, welche die Reform der Ingenieurausbildung als eine umfassende Aufgabe beschreiben, bezogen auf Lehrinhalte, Lehrformen, Studienorganisation und Studienstruktur.
Leitbild 1: In der Ingenieurbildung müssen sich die gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Bezugspunkte der Technik und des technischen Handelns wiederfinden.
Leitbild 2: Das Ingenieurstudium muß inhaltlich und methodisch nach dem Prinzip einer lernenden Organisation gestaltet werden.
Leitbild 3: Die berufliche und gesellschaftliche Praxis sowie deren Reflexion müssen in die Ingenieurausbildung einbezogen werden.
Leitbild 4: Förderung von Frauen in der Ingenieurausbildung.
Leitbild 5: Der methodische Anteil der Ingenieurausbildung muß die Befähigung zum Handeln fördern und an den aktuellen und erwarteten realen Ingenieurtätigkeiten orientiert werden.
Leitbild 6: Große Teile der Ingenieurausbildung müssen in problemorientierten und selbstorganisierten Lehr- und Lernformen angeboten werden.
Leitbild 7: Das Ingenieurstudium muß studierbar werden.
Die Formulierung dieser Leitbilder, hier nur gekürzt wiedergegeben, geschah mit der Absicht, eine hochschul- und fachbereichsübergreifende Aussagekraft zu erreichen. Sie wenden sich in ihrer Aussage demzufolge an alle Hochschulen, ihre Konkretisierung und Umsetzung auf die jeweilige Situation vor Ort bleibt die Aufgabe der Beteiligten.
Anschließend wurden diese Leitbilder exemplarisch in ein konkretes Studienszenario umgesetzt. Dieses Studienszenario:
- verknüpft die Grundlagenvermittlung – der Begriff »Grundlagen« geht dabei weit über rein technische Inhalte hinaus – während des gesamten Studiums mit der »exemplarischen Anwendung«, d.h. mit der Durchführung von Projekten. Diese vermitteln anfangs neben den Grundlagen auch die Arbeitsweise in Projekten, im Laufe des Studiums wird ihre Ausrichtung zunehmend interdisziplinär.
- unterteilt die zehnsemestrige Ingenieurausbildung in vier Module, denen unterschiedliche Aufgaben zugewiesen sind:
Modul 1: Studieneinstieg, führt die Studierenden nicht nur in das Studium ein, sondern ermöglicht ihnen auch eine Entscheidung, ob die Ingenieurausbildung für sie das passende Studium ist.
Modul 2: Grundlagen, vermittelt die mathematischen, naturwissenschaftlichen, technischen und systemtechnischen Grundlagen und führt diese anhand von anwendungsbezogenen Lehrveranstaltungen (Projekten) zusammen.
Modul 3: Vertiefung, bietet den Studierenden die Möglichkeit der fachlichen Vertiefung, beinhaltet aber auch einen Anteil an Lehrveranstaltungen, in dem nicht-technische Kenntnisse, z.B. BWL, Arbeitsorganisation, Technikbewertung, vermittelt werden.
Modul 4: Praxisbezogene Vertiefung und Weiterbildung, bietet den Studierenden Möglichkeiten der inhaltlichen Vertiefung und der Auseinandersetzung mit zukünftigen Berufsfeldern.
- versucht durch vielfältige Zugangs- und Abgangsmöglichkeiten (u.a. auch einen vorzeitigen Bachelor-Abschluß) nicht nur Studierenden ein Studium zu ermöglichen, deren Lebenssituation ein ununterbrochenes Vollzeitstudium nicht zuläßt, sondern auch Studierende in das Studium zu integrieren, die bereits im Arbeitsleben gestanden haben und mit ihren Erfahrungen die Ausbildung bereichern.
Nahezu alle im Studienszenario vorgesehenen, derzeit ungewöhnlichen Studienanteile stützen sich auf Erfahrungen aktueller Reformvorhaben, die mit ihrer Arbeit die Möglichkeiten und den Erfolg dieser Anteile längst nachgewiesen haben.
Perspektivisch ist jetzt schon abzusehen, daß es nicht bei dem jetzigen Abschluß des Projektes bleiben wird. Angeregt durch vielfältige Diskussionen auf der Tagung »Ingenieurinnen und Ingenieure für die Zukunft«9, welche zum Abschluß des eigentlichen Projektes im April 1997 an der Fachhochschule Frankfurt/M. veranstaltet wurde, ist im September 1997 ein Netzwerk10 gegründet worden, dessen vorläufige Arbeitsschwerpunkte folgendermaßen beschrieben werden:
- Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern des Netzwerkes über die Gestaltung der Ingenieurausbildung ermöglichen;
- Informationen über aktuelle Reformansätze verbreiten und
- den hochschulübergreifenden Diskurs zu Fragen der Ingenieurausbildung zwischen den Lehrenden unterstützen.
Dieses Netzwerk wird die Reform der Ingenieurausbildung weiter vorantreiben. Interessierte können und sollten sich an diesem Prozeß beteiligen.
Thomas Pelz ist Diplomingenieur der Verfahrenstechnik und Mitarbeiter im Projekt »Innovative Studienmodelle in der Ingenieurausbildung«.
zum AnfangKommentar: Die Zukunft der Hochschule
von Knut Aufermann
Von der letzten Nachtschicht gekennzeichnete StudentInnen laufen über den Campus, auf der Stirn eine durch die Standort-Deutschland- und Globalisierungs-Debatte geprägte Sorgenfalte. Die Universität ist ein Übergangsstadium zum Geldverdienen geworden. Nur wer schnell und zielstrebig ist, kommt durch.
Unkündbar lächelnde ProfessorInnen lehnen sich zurück und erfüllen ihre Lehraufträge halbherzig. Nach dem langen Weg zur C4-Stelle erscheint am Horizont die verdiente Emeritierung.
PolitikerInnen mit spitzem Rotstift sitzen in ihren Bürosesseln und stürzen sich auf jede schwache Stelle, die sich zeigt. Gutgemeinte Evaluationen degenerieren dabei zu Datenlieferungen für unqualifizierte Kürzungen.
Aber ist denn wirklich alles so schlimm?
Es gibt sie doch, die ProfessorInnen, die ihre gesamte Freizeit darauf verwenden, Drittmittel einzutreiben, um ihren MitarbeiterInnen Promotionsstellen finanziell abzusichern. Nebenbei sind sie im Studienreformausschuß aktiv und schreiben noch an einem endlich gut verständlichen Lehrbuch.
Engagierte Studierende, die die Universität als einen Ort der Kultur begreifen, werden hochschulpolitisch aktiv und organisieren Semesterabschlußparties und Demonstrationen gegen Studiengebühren.
Und dann sind da noch die hochmotivierten DoktorandInnen. Sie forschen in interdisziplinären Teams aus mehreren Fachbereichen über sozio-ökologische Themen, die einen gesellschaftsrelevanten Hintergrund haben.
In welche Richtung geht die Entwicklung?
Leider bewegen sich die Hochschulen schon lange zu den zuerst genannten Beobachtungen. DozentInnen, die sich für eine Verbesserung der Lehrqualität einsetzen, werden wenig unterstützt und gewürdigt. Wer kann es ihnen verdenken, wenn sie sich in ihre Wissenschaft zurückziehen, um sich nicht aufzureiben. Die Beteiligungen an den Wahlen der studentischen Räte liegen im allgemeinen zwischen zehn und 20%. Die Gewählten sind von ihrer geringen Einflußnahme über kurz oder lang frustriert oder basteln an ihrer Karriere. Die Forschung wird durch ökonomische Gesichtspunkte bestimmt, bei der die Güte der Forschungsthemen und der zu erwartenden Ergebnisse z. B. durch die Förderung der DFG festgelegt wird.
Konkurrenz wird als Heilmittel für die lethargisch wirkenden Universitäten angesehen, was deren Anstrengungen verstärkt, beim nächsten Spiegel-Ranking bessere Statistiken zu präsentieren. Wen interessiert schon, wie die Bildungsanstalten von innen aussehen?
Und so beginnt leise das Sterben. Erst sind es nur Planstellen, dann Studienrichtungen, Fachbereiche und ganze Fakultäten, die verschwinden. Und es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis aus Geldmangel die erste Hochschule schließen muß.
Ich wäre darüber nicht traurig, wenn sich dadurch der Druck auf die Entwicklung alternativer Bildungsangebote erhöhen würde. Die Universitäten in ihrer jetzigen Situation sind nicht zukunftsfähig.
Es braucht viel Mut und Kraft, die ausgetretenen Wege zu verlassen und dies muß von Lehrenden und Lernenden gemeinsam getan werden. Jede neue Initiative für ein alternatives Bildungsangebot bringt einen neuen Baustein für eine bunte, vielschichtige Zukunft. Darunter verstehe ich ausdrücklich nicht die Bildung neuer Eliten, sondern es geht um die Aufweichung des linearen Ausbildungssystems in einer komplexen Welt.
Anmerkungen
1) Vgl. Gisela Bock: Frauenbewegung und Frauenuniversität. Die politische Bedeutung der Sommeruniversität. In: Gruppe Berliner Dozentinnen (Hrsg.): Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen. Juli 1976. Berlin 1977. Zurück
2) Vgl. Heike Kahlert: Wissenschaft in Bewegung. Frauenstudien und Frauenforschung in der BRD. In: Elke Kleinau/Claudia Opitz (Hg.): Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Frankfurt/New York 1996, Band 2. Zurück
3) Doris Janshen (Hg.): Hat die Technik ein Geschlecht? Denkschrift für eine andere technische Zivilisation. Berlin, Orlanda Frauenverlag, 1990. Zurück
4) Ich beziehe mich dabei auf die von Angelika Wetterer formulierte Kritik in ihrem Aufsatz: Die Frauenuniversität als paradoxe Intervention. In: Sigrid Metz-Göckel/Angelika Wetterer (Hg.): Vorausdenken-Querdenken-Nachdenken. Texte für Aylâ Neusel. Ffm/New York 1996. Zurück
5) Hier folge ich (teilweise) der feministischen Kritik an Nachhaltigkeit, wie sie u.a. von Claudia Bernhard formuliert wird in ihrem Aufsatz »Der nachhaltige Antifeminismus« in: Schwertfisch: Zeitgeist mit Gräten. Politische Perspektiven zwischen Ökologie und Autonomie. Yeti Press, Bremen 1997. Vgl. auch im selben Band: Frauen-Fisch-AG: Zwischen Sparstrümpfen und Gigabytes. Zurück
6) Frauen-Fisch-AG, S. 45. Zurück
7) Kritik am Konzept der Internationalen Frauenuniversität – insbesondere hinsichtlich der Entscheidungsstrukturen – habe ich an anderer Stelle formuliert, vgl. fzs-Rundbrief August 1997. Zurück
8) »Innovative Studienmodelle in der Ingenieurausbildung«, Abschlußbericht eines Projektes der Zentraleinrichtung Kooperation an der TU Berlin, Berlin/Düsseldorf, 2. Auflage, 1997. Zurück
9) Eine Tagungsdokumentation erscheint in Kürze: Ingenieurinnen und Ingenieure für die Zukunft, Neef, W. und Th. Pelz (Hg.), Berlin, 1997. Zurück
10) Vorläufige Adresse des Netzwerkes: Zentraleinrichtung Kooperation, TU Berlin, Steinplatz 1, 10623 Berlin; e-mail: netz.ing@zek.tu-berlin.de. Zurück
Knut Aufermann ist Student der Chemie und Mitarbeiter im INES-Student-Network. Jörn Birkmann ist Student der Raumplanung und Mitinitiator des Projektes »Nachhaltige UniDo«
Torsten Bultmann ist Geschäftsführer des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi)
Jörg Gleisenstein studiert Raumplanung an der Uni-Dortmund, seit Juni 97 ist er AStA-Vorsitzender der Universität Dortmund.
Martin Hellwig studiert elektrische Energietechnik an der FH Aachen; seit Mai 97 ist er im Vorstand des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften (fzs) tätig.
Barbara Nohr ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet in Göttingen / Bonn
Thomas Pelz ist Diplomingenieur der Verfahrenstechnik und Mitarbeiter im Projekt »Innovative Studienmodelle in der Ingenieurausbildung«
Sandra Striewski ist Studentin der Chemietechnik und Vorstandsmitglied der Naturwissenschaftler-Initiative
Carsten von Wissel ist Diplom Politologe und Mitarbeiter im Studienbüro (FB 7) der TU Berlin