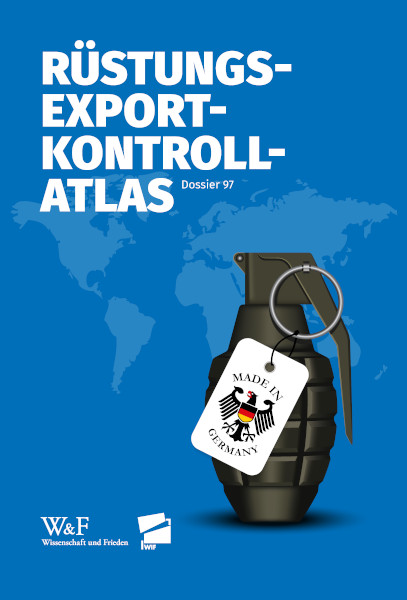W&F 2023/4
40 Jahre W&F
Rückblick
Impulse aus einem wissenschaftshistorischen Dialog
Kritik des Status quo
Heute und vor 40 Jahren: Weniger Geld für Soziales, Spendierhosen für die Streitkräfte
Neuere Geschichte der Bundeswehr und mögliche Entwicklungsperspektiven
Rückblicke auf 25 Jahre Israel-Palästina-Beiträge
Was Sprachmodelle und Massendaten im Krieg bedeuten
Neue Impulse
Mittel der Konflikttransformation für Wege aus der Klimakrise einsetzen
Migration als demokratische Chance
Zur Bebilderung
40 Jahre W&F
von Rainer Rilling, Dieter Senghaas, Claudia Brunner, Patrick T. Hiller und Mario Birkholz