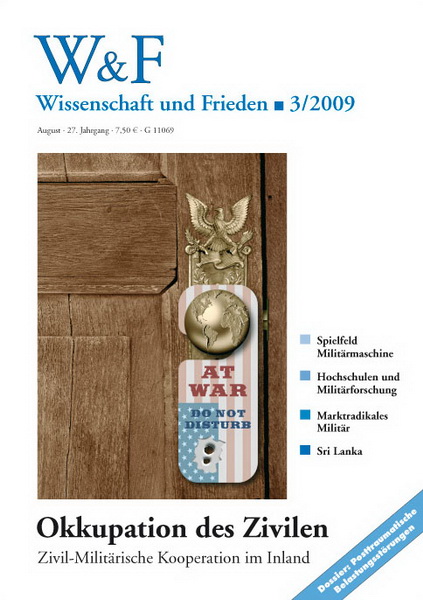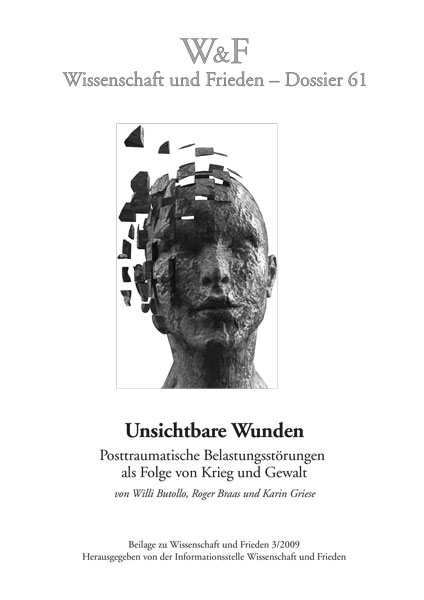W&F 2009/3
Okkupation des Zivilen
Editorial
Gastkommentar
Presseschau
Okkupation des Zivilen
Friedenswerkstätten oder zivilmilitärische Forschungskomplexe
Die Bundesregierung führt die Kategorie der Amtshilfeeinsätze ein