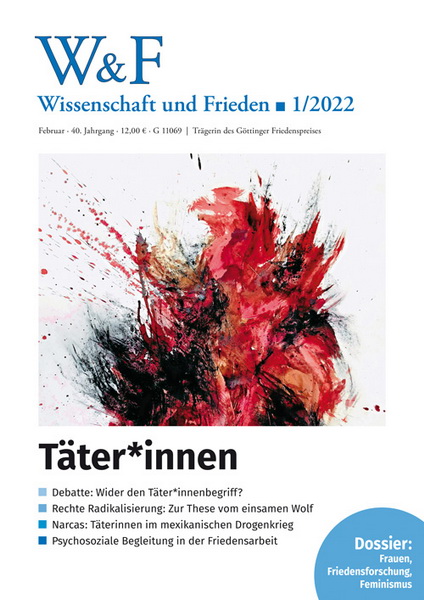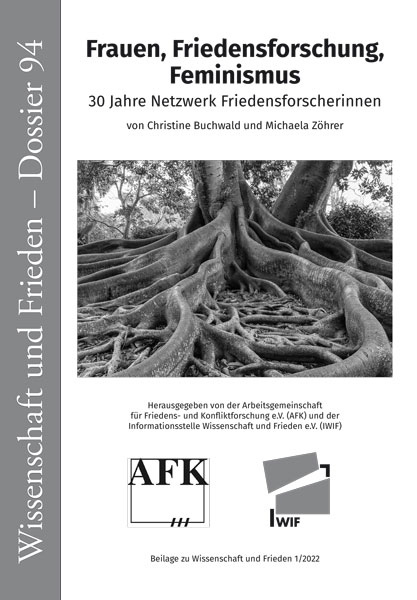W&F 2022/1
Täter*innen
Presseschau
Gastkommentar
Täter*innen
Christian Gerlach & Morgana Lizzio-Wilson & Winnifred R. Louis & Emma F. Thomas & Catherine E. Amiot
Ein Begriff und seine Komplexität
Anstifter*innen, Kontext und die These vom »einsamen Wolf«
Der Tripelallianz-Krieg und die Rolle von Kindersoldaten
Zwischenmenschliche Beziehungen nach dem Völkermord in Ruanda
Die Rolle der »Comités de Autodefensa Civil« in Peru
Aufarbeitung von Verbrechen durch zivilgesellschaftliche Organisationen
Friedensarbeit
oder „How to face the mess we’re in without going crazy?!“1
Historische Friedensforschung
Forum
Zur Notwendigkeit (inklusiver) ziviler Konfliktbearbeitung | Friedensforschung, Friedensbildung und (De)Kolonialität | Praxistransfer in der Lehre